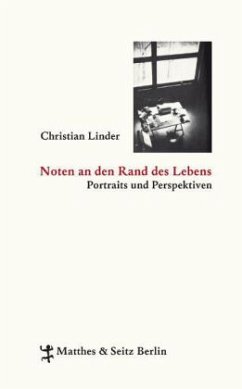"Noten an den Rand des Lebens" ist der Versuch, Literatur als Medium der Existenzerkundung zu nutzen. Die Analysen der Werke von Max Frisch oder Alexander Kluge, die luziden Portraits von Siegfried Kracauer, Claude Simon, Roland Barthes, Hans Magnus Enzensberger oder Peter Weiss, die großen freundschaftlichen Gespräche mit Jürgen Becker, Wolfgang Koeppen oder Michael Ende, die Rekonstruktionen der Träume
vom Aufbruch, wie sie Ryszard Kapuscinski, Bruce Chatwin oder Alfred Andersch in ihre Bücher hineingeschrieben haben, sowie als Betriebsprüfungen deklarierte Lektüren von Martin Walser, Botho Strauss, Marguerite Duras, Albert Camus, Dieter Wellershoff, Uwe Johnson oder John Berger.
vom Aufbruch, wie sie Ryszard Kapuscinski, Bruce Chatwin oder Alfred Andersch in ihre Bücher hineingeschrieben haben, sowie als Betriebsprüfungen deklarierte Lektüren von Martin Walser, Botho Strauss, Marguerite Duras, Albert Camus, Dieter Wellershoff, Uwe Johnson oder John Berger.

In seinen "Noten an den Rand des Lebens" fragt Christian Linder, warum Schriftsteller schreiben, wie sie es tun, und findet Antworten fernab der ausgetretenen Pfade der Literaturkritik.
In einem Essay über die Globalisierung der Literatur und ihre Folgen (F.A.Z. vom 16. Juli 2011) kam Tim Parks zu dem Schluss, dass ein Autor auf dem internationalen Markt keine Chance hat, wenn er nicht bestimmten wiedererkennbaren thematischen Vorgaben folgt und mit nationalen Markenzeichen auf den Markt geht: "Skandinavische Melancholie, irische Burleske, lateinamerikanische Volkstradition. Oder am besten mit einer Geschichte politischer Repression der einen oder anderen Sorte. Die Globalisierung der Literatur befreit also weniger, als dass sie Klischees verstärkt, da wir zum raschen Wiedererkennen so vieler unterschiedlicher Länder ein simples Katalogsystem brauchen."
Dem ist hinzuzufügen, dass ein solches Katalogsystem im modernen Literaturbetrieb schon auf nationaler Ebene notwendig ist, wo Autoren nach Alter, Geschlecht, Verlag und Charisma klassifiziert werden. Dass wir zur richtigen Zeit den richtigen Roman zum richtigen Thema haben - zum Terrorismus, zum richtigen Essen, zur Demenz, zur Finanzkrise -, versteht sich von selbst. Bei dieser Sachlage ist es nicht verwunderlich, wenn man sich an den Renner der letzten Buchsaison schon ein Jahr später nicht mehr erinnern kann. Deshalb ist in den Verlagsvorschauen jeder neue Spitzentitel wieder "ein Buch, das Furore machen wird", das angeblich eine Erstauflage von 50 000 Exemplaren hat und für das ebenso angeblich in allen großen Blättern geworben wird.
Um solche Wahrnehmungsweisen geht es in dem vorliegenden Buch nicht. Seine einzelnen Beiträge stammen gewissermaßen aus einer Zeit, als nicht nur das Wünschen, sondern auch die Literatur noch geholfen hat. Was uns hier auf knapp achthundert Seiten entgegentritt, ist die Summe aus vierzig Jahren Beschäftigung mit der "Literatur als Medium der Existenzerkundung", um den Autor selbst sprechen zu lassen. Es sind nicht aus dem Archiv zusammengesuchte Aufsätze, die man zwischen zwei Buchdeckel gepresst hat. Wenn man das Buch zu Ende gelesen hat oder auch nur auswahlweise darin spazierengegangen ist, weiß man mehr darüber, was Literatur sein kann und auch heute noch sein könnte.
Es sind immer dieselben Fragen, die Linder an das Werk von Autoren richtet, und es sind einige wenige Prämissen, von denen er ausgeht. Sie lauten: "Was in den Büchern steht, ist nicht wichtig; sondern was nicht darin steht - und warum nicht." Und: "Es ist also der Körper, der die Bücher schreibt, wie Roland Barthes uns immer wieder gesagt hat." Die ersten Sätze sind 1979 geschrieben, anlässlich eines Gedichtbandes von Jürgen Becker, der zweite war ursprünglich in der Herbstausgabe 2008 von "Lettre International" zu lesen. Das ist natürlich ein anderer Ansatz als der naive Glaube, Autoren schrieben zu "Themen", weil diese sie brennend interessieren und weil sie etwas dazu zu sagen haben.
Dass es der Körper ist, der die Bücher schreibt, führt Linder unter anderem am Beispiel Max Frischs vor. Das ist einer jener Beiträge in diesem Buch, die einen das Gruseln lehren können. Nachzulesen war er schon 1981 in dem Band "Die Träume der Wunschmaschine", Frisch lebte also noch. Linder setzt sich da zunächst mit der Formel von Max Frisch als dem "Schriftsteller der Identität" auseinander, die unsereiner schon auf der Schule im Deutschunterricht lernen musste. Ich folge jetzt einmal der Verfahrensweise des Autors, indem ich ihn ausgiebig zitiere, so wie es Linder in seinen Texten zu Autoren auch tut, zuweilen seitenlang. Das ist nur logisch, denn er nimmt die Autoren immer beim Wort, ohne ihnen allerdings auf den Leim zu gehen. Er glaubt den Autoren, dass sie etwas zu sagen haben, wenn auch nicht unbedingt das, was sie dann explizit sagen.
Frisch also: "Seine Bücher spielen mehr mit der Identitätsverweigerung, als dass Personen darin auf die Suche nach ihrer Identität gehen ..., diese Personen reiten auf der Behauptung herum, dass sie es auf jeden Fall nicht sind, bestehen also auf ihrer Nichtidentität." "Was aber könnte einen Menschen zwingen, sich über Jahrzehnte versteckt zu halten, seine Identität zu verbergen - welches Vorstellungs-Ich soll dadurch geschützt werden?" "Schauen wir uns mit diesem Gedanken im Hinterkopf einmal den Körper Max Frischs an, so wie er in seinen Büchern, in seiner Ausdrucksweise, in seinen Phantasien erscheint ... Dann wird sofort klar, dass Frisch ein gestörtes Körper-Ich hat, das hinter der Eleganz seiner Bücher, hinter dem Gewand des Verführers, als der er auftritt, immer hervorscheint, er weiß das selbst, und sobald es ihm einfällt, kann er sich selbst nicht mehr ausstehen. Die Klage über sein gestörtes Körper-Ich durchzieht all seine Bücher." Dann wird das vorgeführt, anhand von "Stiller", "Gantenbein" und "Montauk" vor allem, und gezeigt, "wie dieser gekränkte Narziss mit der Kränkung, der Bestrafung der anderen" antwortet. Man muss dieser Argumentation nicht folgen (mich hat sie sehr überzeugt), man könnte sich auch ganz anders mit Frisch auseinandersetzen. Dass aber in den Biographien und Würdigungen zum 100. Geburtstag Frischs im vergangenen Jahr nirgendwo ein Hinweis auf Linders großen Essay zu finden war, ist schon sehr aussagekräftig. Da hat Frisch gewonnen, man sieht ihn so, wie er sich selbst gern gesehen haben wollte, oder, noch einmal mit Linder: "Frisch kann wunderbare Fragebögen aufstellen, aber die Fragen sind so raffiniert gestellt, dass niemand zurückfragte, warum er sie denn für sich nicht einmal zu beantworten versucht hat."
Nun soll hier nicht der Eindruck entstehen, als sei das vorliegende Buch eine Folge akribisch recherchierter Abrechnungen, in denen jemand die Bücher von Autoren daraufhin liest, was sie vor uns verbergen und was für schlechte Menschen sie eigentlich sind. Abgesehen von dem Frisch-Essay und einem sehr schlecht gelaunten Text zu Wolf Wondratschek (aus dem Jahr 1987), folgt Linder eher dem Motto Simenons: "Nicht urteilen, nur verstehen." Dem Romantiker und Spieler Enzensberger zum Beispiel, "der mal dies und mal das sagt", bescheinigt er durchaus, dass seine "Widersprüche zu dem Interessantesten" gehören, was die deutsche Nachkriegsliteratur hervorgebracht hat.
Dass es der Körper ist, der die Bücher schreibt, weiß natürlich jeder Schriftsteller, aber ansonsten ist das Bewusstsein davon weitgehend verlorengegangen in einem Betrieb, der glaubt, dass Autoren "Themen bearbeiten" oder "Ideen haben", so wie auch diese Erkenntnis verschüttet zu sein scheint: "Literatur ist das Gegenteil von Kommunikation, sie kommt aus verhinderter Kommunikation ..." Denn schließlich besteht der Literaturbetrieb hauptsächlich aus Kommunikation um ihrer selbst willen, sorgfältig der Inhalte entkleidet.
Das Schimpfen auf den Betrieb soll aber hier gleich relativiert werden. Man kann ja nicht so tun, als habe es früher, in den goldenen Zeiten der Literatur, nicht ebenfalls einen Betrieb gegeben, mit seinen Seilschaften, Vermarktungsmechanismen und Gemeinheiten. Und der Autor Christian Linder hat sich sehr früh in diesen Betrieb hineinbegeben. Der früheste Beitrag aus diesem Buch ist ursprünglich am 15. Januar 1972 in dieser Zeitung abgedruckt worden; da war Christian Linder noch nicht ganz dreiundzwanzig Jahre alt. Jürgen Becker, Wolfgang Koeppen und Peter Handke hat er 1972 besucht und mit ihnen gesprochen, Kempowski 1973, Nathalie Sarraute 1974, später Claude Simon. Das sagt sehr viel über einen Autor, der schon als ganz junger Mann die Welt und das Leben durch das Medium der Literatur gesehen hat und glaubt, dass diese uns Erfahrungsweisen und Erkenntnisse aufschließen kann wie nichts sonst. Deshalb zitiert er so ausführlich und hört auf die Melodie, die Stimme der Autoren, dringt ein in ihre Schreibweise.
"Schreibweise" (écriture) ist ein Schlüsselbegriff bei Roland Barthes. Linders Aufsatz über "Roland Barthes, Écrivain" ließe sich durchaus als Schlüsseltext zu diesem ganzen Buch lesen. Barthes hat uns die Lust (und die Wollust) am Text gezeigt und wusste, dass der wollüstige Leser nicht liest, um irgend etwas zu lernen, sondern damit sich das Buch in sein Leben einmischt, ein Teil davon wird. Christian Linder ist ein solcher wollüstiger Leser, und deshalb haben seine Texte auch nichts mit Literaturkritik im gängigen Sinn zu tun.
Es versteht sich von selbst, dass Linder, indem er zum Beispiel über Barthes oder Kracauer schreibt, immer auch über sich selbst schreibt. Auch ihn könnte man also danach fragen, was er in seinen Texten von sich selbst versteckt und was er über sich mitteilt, ohne es explizit zu sagen. Barthes wusste, so Linder, "dass nicht das Werk dem Leben ,ähnelt', sondern das Werk das Leben ,steuert'". Anders gesagt: Die Existenzweise des Schriftstellers konstituiert ein bestimmtes Verhältnis zur Welt, zum Leben, und nicht notwendigerweise, aber oft positioniert ihn das eher am Rand als im Zentrum (Barthes hatte es gegen Ende seines Lebens vorgezogen, den Schriftsteller als "Mensch des Zwischenraums" zu bezeichnen). Die "Noten an den Rand des Lebens" sind ihrerseits sehr vom Rande aus geschrieben. Ihr Autor lebt seit Jahrzehnten in kleinen Orten am Rhein, im Sauerland und bevorzugt in der Eifel. Schließlich kommt diese Stimme auch vom Rand des Betriebs, dem Linder gleichwohl angehört wie alle, die veröffentlichen. Der Verlag Matthes & Seitz wenigstens verspricht gar nicht erst, für dieses Buch in maßgeblichen Blättern zu werben. Man kann ihm aber gar nicht genug dafür danken, dass er es überhaupt auf den Markt bringt. Denn es wird wohl kaum mehr als ein paar hundert Leser finden. Die allerdings gehören wirklich zu den happy few, und ihnen wünsche ich beim Umherstreifen in diesen Seiten unendliche Lust am Text.
JOCHEN SCHIMMANG
Christian Linder: "Noten an den Rand des Lebens". Portraits und Perspektiven.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2011. 797 S., geb., 44,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Lust am Text, wollüstig lesen - das will Jochen Schimmang und ist dem Verlag deshalb sehr dankbar für dieses vom Rand des Literaturbetriebs her geschriebene Buch. Darin: 40 Jahre Beschäftigung mit Literatur und den mit ihr verbundenen Wahrnehmungsweisen. Wie Christian Linder mit Roland Barthes die versehrten Körperverhältnisse von Autoren wie Max Frisch oder Peter Handke erkundet, deren Verfahrensweisen, die Rückseite ihrer Texte, quasi versucht zu verstehen, scheint Schimmang immens erkenntnishaltig zu sein. Nicht als Abrechungen liest er das (nicht alles jedenfalls), sondern als Horchen auf die Stimme des Autors. Mit Literaturkritik im üblichen Sinn hat das nichts zu tun, das weiß Schimmang, doch eben dies macht die hier versammelten Texte für ihn so aufschlussreich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH