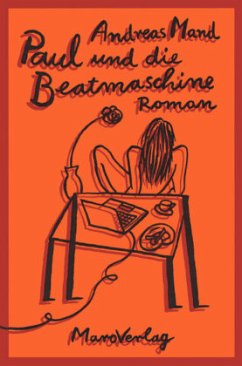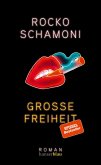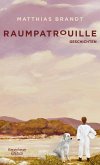Produktdetails
- Verlag: Maro-Verlag
- Seitenzahl: 190
- Deutsch
- Gewicht: 280g
- ISBN-13: 9783875122787
- ISBN-10: 387512278X
- Artikelnr.: 20788899

Andreas Mand schreibt mit "Paul und die Beatmaschine" seinen großen Lebensroman fort
Kurz vor der Performance bekommt Suzanna dann doch noch Skrupel: "Vielleicht ist es besser, die Ministerin nicht zu schlagen?" "Nein", sagt Paul, "ich will erschossen werden. Für meine Karriere wäre es das Beste."
Natürlich bleibt dann doch alles im Rahmen: Die Ministerin, die auf Schloß Solitude die Arbeiten der Stipendiaten besichtigt, bleibt von der schlagfreudigen Installation "Beat Machine" ungeschoren, Paul bleibt am Leben, mit der Karriere läuft es wie bisher, also nicht besonders gut, und auf der Party nach der Performance knüpft die Künstlerin Suzanna nützliche Kontakte.
Wäre es das gewesen? Der kalkulierte Eklat, der Schlag ins Gesicht einer Kulturbürokratie, die Stipendien verteilt, Bücher subventioniert und dafür sorgt, daß Musiker, bildende Künstler und Schriftsteller monatelang grübeln, was sie denn nun mit all der Freiheit anfangen sollen? Paul jedenfalls hadert, provoziert einen Riesenkrach mit Suzanna, weil es zum Fanal nicht gekommen ist. Aus Feigheit? Um ein neues Stipendium nicht zu gefährden? Aus Mangel an Phantasie?
Der Schriftsteller Andreas Mand, 1959 in Duisburg geboren, kennt das Problem. Seine Romane sind meist nicht besonders weit von seiner Biographie entfernt angesiedelt, der neueste, "Paul und die Beatmaschine", ist aus der Erfahrung als Stipendiat auf Schloß Solitude entstanden. Das war im Winterhalbjahr 1992/93, Mand, der damals seit zehn Jahren Bücher publizierte, war irgendwo zwischen Geheimtip und etablierter Autor, seine besten Texte standen kurz bevor, die Kritik sollte sie feiern.
Keine Kompromisse
Heute sind viele seiner Bücher vergriffen, und obwohl Mand zu den interessantesten deutschen Autoren der Gegenwart zählt, ist er für viele Leser immer noch ein unbeschriebenes Blatt. Dabei entgeht ihnen mit Paul Schade, der Hauptfigur einer ganzen Reihe von Mands Romanen, nicht nur ein äußerst sensibler Chronist der letzten dreißig Jahre: Paul, der sich seinen Weg als Musiker und Schriftsteller bahnt, hat vor allem ein waches Gespür für Korruption.
Zumal wenn sie im Gewand linker Ideologie oder der Kunstfreiheit einherkommt. Wenn die Seminarschwätzer im richtigen Moment den Absprung in die akademische Karriere schaffen, wenn Songschreiber die richtigen Ratschläge annehmen, um ein größeres Publikum zu erreichen, oder aber wenn sich bildende Künstler mit den richtigen Leuten anfreunden, damit sich das Stipendiumskarussell für sie weiterdreht, von Solitude nach Wiepersdorf, vielleicht sogar einmal nach Rom?
Paul jedenfalls beobachtet all dies mit dem Wissen um die Unausweichlichkeit der Anpassung, des Alterns, und weil er sich selbst am genauesten seziert, findet er den Korruptionskeim nicht zuletzt im eigenen Wesen. Wie alles gekommen ist, wie es ist, fragt der achtundzwanzigjährige Paul zu Beginn des großen Romans "Das rote Schiff": das Zusammenleben mit der ungeliebten Freundin Ursi, der Job, den er nie wollte, die Isolation von den Weggefährten, die umfassende Tristesse. Er schält sich, Kapitel für Kapitel, zu den Anfängen zurück, drückt, wie er es nennt, die Rückspultaste am Bandgerät. In diesem vielschichtig musikalisch strukturierten Roman, in dem Kassetten eine große Rolle spielen, paßt die Metapher gut.
Tatsächlich verleiht diese umgekehrte Chronologie dem Roman einen gehörigen Charme, weil sie den Zauber des Beginnens noch in der unerfreulichen Gegenwart leuchten läßt, aber weil eben auch in der Offenheit des zwanzigjährigen Träumers der desillusionierte Werbetexter durchscheint. Im Zentrum steht das titelgebende rotbemalte Holzschiff, so riesig, daß es beim Umzug zersägt werden muß, eigentlich ein Bett, das auch als Versteck von Nahrung und Klopapier vor den Mitbewohnern dient - alles mag man dann doch nicht miteinander teilen, und die anderen halten es ebenso.
Denn trotz mancher Anflüge von Nostalgie beschreibt Mand die Szene, in der sich Paul Schade in den Achtzigern bewegt, vielschichtig und widersprüchlich, aber nicht verklärt: Dem heftig suchenden, oft frustrierten und ewig widerborstigen Paul ist der verbreitete Drang zur Gemeinsamkeit Trost und Folter zugleich, und wo der Übergang von Anarchie über notwendige Regeln des Zusammenlebens bis hin zur versuchten Diktatur der radikalen Mehrheit fließend ist, eckt an, wer Floskeln haßt, gruppendynamische Prozesse angewidert analysiert und in Seminaren leidet, wenn seine Mitbewohnerin ungefragt aus ihrem Tagebuch vorliest. Oder wenn es auf der Zivildienstschule, die Paul aus nachvollziehbaren Gründen als Zwang erlebt, darum geht, einen "Vertrauensmann" zu wählen: "Dieser sollte auch und vor allem mit dem Schulleiter ,vertrauensvoll' zusammenarbeiten. Ich fand es peinlich, daß sich überhaupt Leute für den ,Wahlausschuß' meldeten. Moralische Münchener, widerliche Typen, die sich die zweifelhafte Ehre nur allzugern an ihre Jeansjacken hefteten. Mich wollten sie auch überreden, als wir uns nachts vor dem Kühlschrank trafen. Zur Kandidatur und zum Organspenden. Als ich beides ablehnte, nannten sie mich ,unsozial' und analysierten ,eine Einstellung, die im Terrorismus endet'."
Diesem Grundmißtrauen jedenfalls, das sich auch auf die Sprache des Milieus erstreckt und vor der eigenen keineswegs haltmacht, verdankt Pauls Lebensbericht, wie Mand ihn schreibt, seine kalkuliert reduzierte Prosa, die sich kunstlos und authentisch gibt und doch meilenweit entfernt ist von all dem ungeformten Geschwätz, das gern unter dieser Flagge segelt.
Feine Strategien
Am Ende des "Roten Schiffs", am Anfang des Erzählten also, berichtet Paul vom Ende einer aufgeregten Nacht: "Ich ging nach Hause. Ich versuchte nicht mehr, mich vor dem Regen zu schützen. Jetzt ist die Gegenwart, dachte ich. Jetzt ist die Zeit, von der ich immer geträumt habe. Und ich dachte, ich muß es festhalten, wie es ist. Aber ich wußte nicht, wie."
Die Technik, die Mand sich im Lauf der Zeit erarbeitet hat, fußt auf Dokumentarischem, auf dem Gebrauch von Fotos, Briefen und Notizen, auf Schülerzeitungsheften und selbstaufgenommenen Kassetten, auf der Ausbeutung des Alltags. "Meine ganze Jugend war Recherche, hört sich das typisch an oder nur skurril?" fragt Paul einmal, und wenn es dabei geblieben wäre, müßte man sich mit Mands Romanen nicht weiter beschäftigen. Doch gerade die beiden Bände, die am weitesten in die Kindheit des Helden (der sich hier einmal nicht Paul Schade nennt) reichen, "Grovers Erfindung" und "Grover am See", zeigen, wie aus Recherche und einem feinen Ohr große Literatur werden kann: Der junge Erzähler, der altklug und gewitzt aus seinem Leben als Pfarrerssohn berichtet, faßt seine Miniaturen in eine Sprache, in der sich die kindliche Beobachtung mit den Floskeln der Erwachsenen verbindet und dabei auf erstaunliche Weise beiden Welten gerecht wird.
Natürlich kann, wer mag, all dies als Archiv einer längst vergangenen Zeit ansehen, als Quellentext für die Hausbesetzerszene der Achtziger, den Protest gegen Kernkraftwerke, die "Kleinstadthelden" im gleichnamigen Roman, die sich zwischen Studium und Revolte, Flugblättern, Polizisten und Liebeswirren bewegen und doch keinen Schritt vorwärtskommen.
All dies ist in "Paul und die Beatmaschine" nur noch Erinnerung. Allerdings eine, die Paul heraufbeschwört, als ihm das Stipendium für Schloß Solitude zugesprochen wird. Dort verliebt er sich in Suzanna und trennt sich von seiner Freundin Sabine, er kümmert sich um Suzannas Kinder, schreibt, kocht, besucht seinen Verlag, seine Eltern, und daß nach all dem Streit am Ende die Patchworkfamilie vereint die Romanbühne verläßt, ist ein mittleres Wunder.
Denn ungeklärt ist nach wie vor, ob sich, wer im Kunstbetrieb strategisch handelt, den von beiden so verachteten "Durchschnittskünstlern" zurechnen lassen muß und wo Kompromisse in Anpassung übergehen und diese in Korruption umschlägt. Paul jedenfalls entgleitet seiner alten Welt immer mehr, und nicht einmal der Besuch bei Sigrid, der großen unerfüllten Liebe von damals, hilft da weiter. Sie sei mit den Kindern beim Arzt, sagt ihr Mann Karl zu Paul, als der auf der Durchreise vorbeischaut, er könne aber gern in der Küche auf sie warten. Und dann fällt in dem bekenntnisfreudigen Buch ein überraschender Satz: "Er hielt sich über eine Stunde dort auf, und was er noch dachte, über Sigrid und Karl, ist unbekannt geblieben."
Statt dessen erscheint nach dem Stipendium 1994 "Das rote Schiff". Was es zu sagen gibt über Sigrid und Paul, dieses rührende, kratzbürstige, verhinderte Liebespaar, ist dort aufbewahrt. Mit einer Menge zerstobener Utopie.
TILMAN SPRECKELSEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Mit einem Phänomen des modernen Literaturbetriebs, der sogenannten Stipendiatenliteratur, setzt sich der Roman von Andreas Mand auseinander. Dabei habe der Autor selbst, über den Rezensent Wilhelm Genazino sonst kein weiteres Wort verliert, keine solche verfasst, sondern das Nomadenleben als "Stipendiumstourist" zum Thema. Im Mittelpunkt steht der introvertierte Schriftsteller Paul, der in Stuttgart zusammen mit Freundin und Kindern eine "Stipendiatenfamilie auf Zeit" bilde, sich mit den Mechanismen des organisierten Literaturproduktion schwer tue, das Preisträgerdasein verachte und als ironische Volte den "Provinziellen Literaturpreis" erhalte. Genazino lobt die literarische Darstellung, der es nicht auf die soziologische Perspektive ankomme, sondern das Problem der "Jugendverrentung" in einer "Vielzahl von Szenen, Dialogen und knappen Erzählschnipseln" auflöse. Letztlich sei die Geschichte auch eine Variation und Verschiebung des traditionellen Künstlerromans, der davon erzähle, wie die staatlich subventionierte Auftragsarbeit eine Stagnation der Kunst hervorbringe, die sich in der tiefsten Kunstprovinz abspiele.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH