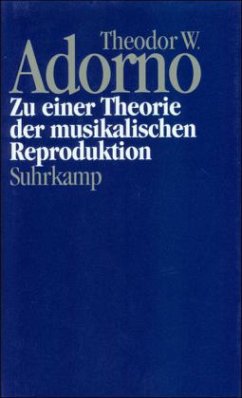Die Theorie der musikalischen Reproduktion zählt zu Adornos ältesten Buchplänen; das erste Schema dazu datiert von 1927. Wiederholt nennt Adorno das geplante Buch Mitte der dreißiger Jahre als die nächste Arbeit, die er mit Rudolf Kolisch gemeinsam schreiben wolle. Zehn Jahre später beginnt Adorno, Aufzeichnungen zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion in ein Notizbuch einzutragen, das allein dieser Arbeit gewidmet ist und bis 1959 geführt wurde. Ein maschinenschriftlicher Entwurf von 78 Seiten, der nur einen kleinen Teil der zu behandelnden Themen umfaßt, entstand noch in Amerika. Zur endgültigen Niederschrift aber kam es nicht mehr.
Adorno hat den Gedanken an das Buch jedoch nie aufgegeben. Es sollte der Frage nachgehen, ob Musik - zumal die traditionelle - nicht uninterpretierbar geworden sei. Die musikalische Erfahrung des geschichtlichen Moments der Werke, ihrer Veränderung in der Geschichte, zieht die Erkenntnis herbei, daß die Reproduktion, wie etwa die Aufführung von K ompositionen, nicht länger ein akzidentielles Moment, sondern selbst eine Form ist, deren die Kompositionen bedürfen. In den Aufzeichnungen nehmen darum nicht nur theoretische Überlegungen über das Verhältnis von Analyse der Kompositionen, ihrer Interpretation und der idealen Aufführung einen großen Raum ein, sondern auch solche, die in musikalisch-technischen Bestimmungen die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit der Interpretation zu fassen suchen.
Die Kritik der eingeschliffenen Interpretationen, die mit den berühmtesten Namen verbunden sind, führt zur Frage, ob nicht das Ideal stummen Musizierens, schließlich des Lesens musikalischer Texte die notwendige Konsequenz sei.
Adorno hat den Gedanken an das Buch jedoch nie aufgegeben. Es sollte der Frage nachgehen, ob Musik - zumal die traditionelle - nicht uninterpretierbar geworden sei. Die musikalische Erfahrung des geschichtlichen Moments der Werke, ihrer Veränderung in der Geschichte, zieht die Erkenntnis herbei, daß die Reproduktion, wie etwa die Aufführung von K ompositionen, nicht länger ein akzidentielles Moment, sondern selbst eine Form ist, deren die Kompositionen bedürfen. In den Aufzeichnungen nehmen darum nicht nur theoretische Überlegungen über das Verhältnis von Analyse der Kompositionen, ihrer Interpretation und der idealen Aufführung einen großen Raum ein, sondern auch solche, die in musikalisch-technischen Bestimmungen die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit der Interpretation zu fassen suchen.
Die Kritik der eingeschliffenen Interpretationen, die mit den berühmtesten Namen verbunden sind, führt zur Frage, ob nicht das Ideal stummen Musizierens, schließlich des Lesens musikalischer Texte die notwendige Konsequenz sei.

Suche nach dem Sinn von Tönen: Was Theodor W. Adorno von Musik-Interpretation fordert
Vielleicht war die eifersüchtige Passion für Musik Adornos liebenswerteste Begabung. In ihr verbanden sich elementare Begeisterungsfähigkeit, literarische Formulierkraft, gesellschaftskritischer Scharfsinn und amüsante, gelegentlich heiter-hämische Lust am Besser-Wissen. So finden sich vielfältig faszinierende Gedanken in Adornos nachgelassenem Text „Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion”, den Henri Lonitz sorgfältig kommentiert und herausgegeben hat. Einige Zitate aus dem neuen Buch dürften neugierig machen. „Soweit Musik interpretiert wird, ist es stets ’Rubato’.” Über den sonst gepriesenen Furtwängler heißt es hier mal hübsch hämisch: „Furtwängler wäre der größte lebende Dirigent, wenn er zufällig dirigieren könnte”.
Empfindsame Sprachkunst beeindruckt bei Adornos Erläuterung, was dem Dirigenten Robert Craft bei seinen Webern-Interpretationen fehle: „Zu direkt, ohne Furcht und Zittern, die Musik ohne Isolierschicht angefaßt. Es fehlt die Sensibilität der Hände, die das Vermittelte, Symbolische jeden Tons wahrnimmt und in der Reproduktion realisiert”. Überraschend oft, häufiger als selbst auf Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Berg, Schönberg – bezieht sich Adorno hier auf Chopin, über den es ja sonst keine größeren Arbeiten von ihm gibt. So sei etwa bei Chopins C-Dur Prélude (Opus 28 Nr.1) „die Idee des genialen Stückes ... das Verhältnis der nachschlagenden Bewegung zum guten Taktteil, auf den die Bewegung übergreift, als ob sie sich nicht halten könnte. Diese Idee ist zugleich die des Ausdrucksgehalts, des Augenblicks von überströmendem, passioniertem Enthusiasmus.” Am Schluß erfahren wir: „Ich habe das Stück nie richtig gehört, auch von mir selbst nicht”. Was freilich Alfred Cortot betrifft, dessen Interpretation jener „Préludes” mit Recht nach wie vor Kultrang besitzt, so mault Adorno geringschätzig: „Gegen eine bestimmte Art des ’Gestaltens’, z. B. von Alfred Cortot. Sie besteht darin, in einer übertriebenen, überauffälligen Weise das herauszuarbeiten, was man ohnehin hört oder was in einem äußerlichsten Sinn die Hauptsache ist. Natürlich gilt Cortot, ein alter Nazi, im Deutschland von 1957 als großer alter Mann: sacred cow.”
An manchen Aussagen Adornos fällt hier etwas Ungeschütztes, Mutwilliges, Vergnügt-Kesses auf. Das hängt zusammen mit der Privatheit dieser Texte. Wir hören Adorno beim Selbstgespräch zu: was alles noch zu bedenken wäre, wo ihm etwas dunkel oder widersprüchlich scheint, wo er über seine entstehende Theorie sich nicht sicher ist.
Pech gehabt
So begegnen wir hier keiner feinen, wasserdicht abgesicherten Reproduktions-Theorie – sondern in jahrelanger Denkarbeit notierten Einfällen. Das aber ist nicht, oder nur in einem akademischen Sinne, Schwäche, sondern im Hinblick auf die Unmittelkeit der Einsichten produktive Stärke. Autoren, die sich mit Tagebüchern an die Öffentlichkeit wenden, spielen meist Aufrichtigkeits-Komödien: Sie teilen uns mit, wovon sie möchten, dass wir es wissen. Adorno aber sucht, spekuliert hier tatsächlich nur für sich. Schreibt: „Pech gehabt” – wenn nachträglich hinzugezogene Noten genau das Gegenteil von dem offenbaren, was er zunächst vermutet hatte.
Adornos helle oder giftige Geisteskinder wirken hier noch nicht dialektisch gekämmt, hergerichtet. Vielmehr überlegt er beunruhigt: „Warum ist es legitim, Orgelwerke von Bach zu orchestrieren, scheußlich, Symphonien von Beethoven umzuinstrumentieren. Das Element der Geschichte spielt wesentlich herein. Aber ganz klar bin ich mir selbst nicht. Äußerst wichtig.” Adornos Frage, warum er Bachs Orgelwerke lieber in Bearbeitung hört (etwa von Schönberg) als Beethoven-Kompositionen, hing wohl damit zusammen, dass er ein radikaler Romantiker gewesen ist. Der starr objektive Ton von Orgel oder Cembalo befremdete ihn.
Hauptsache, Hauptteil dieser reproduktionstheoretischen Fragmente sind die „Aufzeichnungen I und II”, welche, samt den von Adorno mitunter hinzugefügten knappen Notenbeispielen, ungefähr 200 Seiten einnehmen. Danach folgen durchgeschriebene „Entwürfe”: Ein umfangreicher sowie ein rasch abgebrochener zweiter Anlauf. Adorno unternahm offenbar den Versuch, aus allem Vorbereitenden etwas Geschlossenes zu kondensieren. Das gelang nicht. Es fehlte wohl auch an Zeit.
Überdies verbiss sich Adorno bei diesen Anfängen allzusehr in ebenso gelehrte wie uferlos spekulative Erörterungen der Notenschrift. „Notation reguliert, bändigt, unterdrückt immer zugleich das, dem sie dient, und an dieser Doppelschlächtigkeit leidet alle musikalische Reproduktion bis zu ihrem Untergang”. Seine Ehefrau Gretl, der Adorno diese von griechischer Antike bis zum Untergang ausgreifenden Entwürfe diktierte, schrieb nicht völlig zu Unrecht an den Rand: „Ist das nicht etwas zuviel Musikgeschichte?” Der sorgfältige und kundige Anmerkungs-Text des Herausgebers gibt Erläuterungen sowie Querverbindungen zu anderen Arbeiten Adornos. Alles sehr gediegen. Einzig der Hinweis auf eine Generalpause im Finale von Beethovens letzter Violin-Sonate (G-Dur, Opus 96) scheint schwer nachvollziehbar, wohl ein Irrtum. Und die übereifrige Erläuterung, Adornos Satz: „Ein Königreich für ein Piano” sei Anspielung auf Shakespeares Richard III. „ein Königreich für ein Pferd”, wirkt fast drollig.
Was deutlich heisst
Was ist nun Adornos wichtigste Forderung? Antwort: Die Deutlichkeit aller Interpretation. Doch es geht ihm nicht bloß um das Deutlich-Werden aller offenen oder verborgenen musikalischen Beziehungen des Notentextes. Sondern entscheidend kommt es an auf die Hierarchie „zwischen Deutlichem und Undeutlichem im Sinn der Deutlichkeit der Gesamtstruktur”. Das wirkt kompliziert aber auch irgendwie trivial. Adorno bemüht sich um etwas ebenso Ideales wie mit fixierenden Worten Unerreichbares: nämlich um die – erkennbar „Falsches” ausschließende, erfühlbar Richtiges dialektisch umkreisende – Darstellung eines wahrhaftig interpretierenden Musizierens. Abwiegelnd weist Adorno allerdings darauf hin, dass im Musik- „Machen” natürlich auch ein nicht-analytisches, kindliches, bloß mimetisches Nach-„Machen” (des Noten-Textes) beschlossen liegen könnte.
Dabei kreist Adorno fast zwanghaft um folgende Begriffe: „Mensural” nennt er alles das, was die Noten eindeutig wollen. „Neumisch” ist für ihn das aus diesen Notenzeichen zu gewinnende, die eigentliche Struktur des Werkes überhaupt herstellenden Sinn-Element. Wer dessen habhaft werden möchte, darf nicht seine Subjektivität durchstreichen. Solcher „Positivismus” sei tödlich. Dem Interpreten erschließe sich nur so viel vom Objekt, wie er selbst von sich hineingibt. „Aber dies Hineingeben spielt im Text, nicht als ein von ihm Abgespaltenes – und das ist die Schwelle gegen die Romantik. Das subjektive Moment der Objektivität ist die Interpretation.”
Kompliziert klingende musikphilosophische Thesen, zugegeben. Sie werden umso klarer, konkreter, auch falsifizierbarer, je näher am Einzelfall Adorno argumentiert. Exakt denkt er darüber nach, auch welche Weise wichtige zweite Stimmen zu verdeutlichen wären. Oder wie gewisse, immerwiederkehrende „fixe Ideen”, etwa das Thema von Chopins f-Moll Etüde (aus den Trois Nouvelles Etudes) durch hinweisende Akzentuierung allein ihres ersten Tones vorzuführen seien. Form-Brüche bei Schubert und Bruckner sollen nicht klassizistisch verschmiert, sondern dergestalt geboten werden, dass „die wahre Interpretation Schuberts die Darstellung des Zerfalls als eines aus der Totalität entspringenden wäre – die epische Totalität ist die, die an sich ’müde wird’, einschläft, sich dissoziert”. Was für eine riskante Spekulation. Nachzuprüfen etwa am Kopfsatz von Schuberts riesigem Es-Dur Klaviertrio Opus 100. Und doch: gewinnt nicht Adornos wunderbar gewähltes Verbum „ einschläft” hier fast magisch einprägsame Qualität?
Der Reproduktions-Theoretiker Adorno beruft sich auf zwei Helfer: auf den Anfangs zitierten Frederic Dorian („History of Music in Performance”). Und vor allem auf Richard Wagner. Dessen großer, auch von Richard Strauss bewunderter Aufsatz „Über das Dirigieren” scheint für Adorno eine Art Bibel gewesen zu sein. Er spart nicht mit Ausdrücken der Bewunderung, variiert Wagners Themen gläubig – bis hinein in die Interpretations- Sphäre des 20. Jahrhunderts. So ist Furtwängler für ihn „Erbe Wagners”, Toscanini wiederum Inbegriff stromlinienförmiger Leere, musikalischer Sinnlosigkeit.
Stets plädiert Adorno für Ausdruck. Für die tönende Manifestation von Leiden. Von Besonderem, Subjektivem und Drastischem. Darum lobt er den Pianisten Arthur Schnabel, lästert er über Toscanini, Wallenstein, Monteux, Horowitz, Heifetz, seltsamerweise auch unentwegt über den nicht-gemochten Bruno Walter. Manches wirkt qualitätsblind: Firkusny und Backhaus stellt Adorno allen Ernstes negativ nebeneinander. Sibelius war „Barbar” – Tschaikowsky, Puccini, Rachmaninow nennt er „schlechte Komponisten”. Vor Musikanten, gar mit Zigeunerton, graute ihm.
Die Träne stürzt
Dabei vermochte er Musik empfindsamer zu geniessen, als seine Espressivo-Philosophie verrät. Wie liebte er Schubert („Vor Schuberts Musik stürzt die Träne aus dem Auge, ohne erst die Seele zu befragen”). Als der alte Leopold Stokowsky einst im Frankfurter Rundfunk- Konzert-Saal Debussys „Nach mittag eines Fauns” mächtig-zart aufrauschen ließ, da flüsterte Adorno, ich durfte neben ihm sitzen, mir entwaffnet zu, wie betörend schön das doch sei. Gleichwohl: Für diesen Beethovenianer, Wagnerianer, Brahmsianer, Mahlerianer und Schönbergianer ist die „Emanzipation der Dissonanz” doch die eigentliche Antwort aller großen Musik auf die Heillosigkeit des Bestehenden gewesen. Daraus ergibt sich für ihn die Interpretations-Konsequenz, abweichende, dissonante Töne sollten stets unterstrichen werden.
Aber auch Ideen, die aus Leidensglut kommen, können zur Ideologie erstarren. In der Reprise des riesigen Adagios von Beethovens Hammerklavier-Sonate wird das gewaltig wiederkehrende Hauptthema nun von 32teln umspielt. Arthur Schnabel hebt, wie (der Schnabel-Bewunderer) Adorno es will, alle abweichenden dissonanten Verzierungstöne hervor. Die Wirkung ist panisch, reich. Claudio Arrau jedoch, umgekehrt, hebt alle (Beethovens fis-Moll Tonart grimmig bestätigenden) nicht-dissonanten Töne hervor. Die Wirkung ist gleichfalls gewichtig, von niederschmetternder Gesetzlichkeit. Pollini, als ginge es um Graphik, hebt alle visuell herausstechende Töne hervor. Die Wirkung? Kühl, konstruktivistisch, verfremdend. Kein Mensch, auch der klügste Musikphilosoph nicht, kann da einfach dekretieren, welcher Interpret recht habe.
So ideologisch-entschieden sich Adornos fertige Arbeiten manchmal auch lesen – hier, in diesen Überlegungen, war er offen für Gegenargumente. Als Rudolph Hirsch, Cheflektor des S.Fischer-Verlages, und Georg Solti seiner Karajan-Kritik widersprachen (Adorno hatte Karajans Interpretation von Bruckners VIII. Symphonie inhaltlich „leer” befunden) gab Adorno Hirsch nach. Der hatte gegen Adorno argumentiert, „wenn das Sinnliche im Kunstwerk vollkommen, so wäre damit das Geistige auch da” Also müßte, so nun Adorno, ein wenig beklommen, bewiesen werden, inwiefern das Sinnliche doch nicht hinreichte. „Aber dies zu konkretisieren bleibt unendlich schwer und noch zu leisten.”
Karajan selber hat sich, wie die Pianistin Edith Picht-Axenfeld weitergab, gegen Adornos Thesen witzig zur Wehr gesetzt. Zu Adornos Behauptung, die „wahre Interpretation” sei die Röntgenphotographie des Werkes, sie müsse alle Relationen sichtbar machen, die unter der Oberfläche des sinnlichen Klanges verborgen bleiben, fiel Karajan folgendes Gegenargument ein: Man solle nur die sinnliche Erscheinung darstellen, die Struktur teile sich dann von selber mit. „Wenn ich eine Frau liebe, will ich ihren Leib, nicht ihre Röntgenphotographie”. Freilich, einem wahren Dialektiker verschlägt es nicht so leicht die Stimme. „Sehr plausibel”, meint Adorno dazu. „Aber, wie das meiste Plausible, bloße Sophistik”. Denn – ”das Wesen muss erscheinen”.
JOACHIM KAISER
THEODOR W. ADORNO: Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001, 400 Seiten, geb., 78 Mark.
Teddie mag keinen Jazz.
Zeichnung: Volker
Kriegel
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Adornos Fragmente zur musikalischen Reproduktion: ein Hauptwerk / Von Gustav Falke
Gegenstand der Musikwissenschaft sind heute Texte. Das wäre nicht anders, untersuchte man mündliche Traditionen, Improvisationen oder Interpretationen. Sie würden als Abweichung vom Maß der Schrift genommen. Es scheint gar nicht anders sein zu können, denn erst auf die Schrift läßt sich zurückkommen, erst die Schrift ermöglicht Nachprüfbarkeit, Objektivität. In der Literaturwissenschaft verhält es sich ebenso. Doch vielleicht führt gerade die Ähnlichkeit zwischen einem literarischen und einem musikalischen Text in die Irre. Denn zugleich ähnelt ein Musikstück einem Gemälde. Wir brauchen seine sinnliche Gegenwart, und dazu genügt keine bloße Aktualisierung des Geschriebenen. Die mathematisch präzise Umsetzung einer Partitur wäre wohl noch als Musik zu erkennen, aber nur, weil wir aus der Erfahrung angemessenen Vortrags jetzt selber Gruppierungen, Gewichtungen vornähmen. Sie ließe uns kalt.
Die textorientierte musikwissenschaftliche Analyse trägt der Erfahrung der Hörer nur unzureichend Rechnung. Das zeigt sich als Unzulässigkeit der Analyse selbst. Der Text läßt uns bevorzugt auf geregelte Zusammenhänge achten: Kadenzen, Syntax, Formen, motivische Ableitungen. Die melodische Erfindung dagegen bleibt als das in den Zusammenhängen Zusammenhängende ein schlicht Gegebenes, irreduzibles Produkt des kompositorischen Genies. Und auch über Klangfarbe ist lesend wenig herauszufinden. Gelesene Musik ist immer disegno, nie colore. Am folgenreichsten aber lenkt der Text darin, daß er als das, worauf ich zurückkommen kann, eine ideale Gleichzeitigkeit unterstellt. In dieser Gleichzeitigkeit muß ich nicht mehr zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem unterscheiden oder zu Erwartendes und Erinnertes aufeinander beziehen. Ob ich in Motiven oder in Melodien, melodisch oder kontrapunktisch, in Vierteln oder ganztaktig denken soll, ob eine motivische Ableitung zwei Gestalten als verwandt ausweist oder nur dem Satz eine Grundtönung gibt, ob einem Thema der tragende Boden entzogen wird oder ob es energisch einem Ziel zustrebt, diese für den ausführenden Musiker wie für den Hörer höchst wichtigen Fragen haben am reinen Text gar keinen rechten Sinn. Überall, wo der Musiker sich entscheiden muß, ob er dies oder jenes hervorhebt, kann sich der Analytiker zurücklehnen: Es ist eben beides da. Sinnvoll aber wird das Stück für den Hörer erst aus dem Ineinander der gewichtenden Entscheidungen.
"Aller bestehenden Musik ist das Interpretiertwerden wesentlich." Dieser Satz aus Adornos Aufzeichnungen zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion müßte für die Musikwissenschaft wie für die orthodoxen Adorno-Anhänger ein Skandal sein. Es gibt für Adorno das reine Werk, aber nur als (regulative) Idee der wahren Interpretation. "Der verantwortliche Musiker läßt die Unterscheidung von richtiger und falscher Interpretation so wenig sich verkümmern wie die eines richtig oder falsch gegriffenen Akkords, eines reinen oder unreinen Tons." Er sucht im Text nach Hinweisen für den richtigen Vortrag, aber erst bei dieser Suche zeigt sich, was im Text steht. Der Text hat Wirklichkeit, musikalischen Sinn, nicht schon in der analytischen Lektüre, sondern erst im Versuch, ihn vorstellend oder vortragend zu realisieren.
"Ausgehen von der Frage: was ist ein musikalischer Text. Keine Anweisung zur Aufführung, keine Fixierung der Vorstellung, sondern die notwendig lückenhafte, der Interpretation bis zur endlichen Konvergenz bedürftige Notation eines Objektiven." Für den Begriff von Interpretation entwickelt Adorno, was man bei ihm nicht ohne weiteres vermutet: eine Wahrheitstheorie, eine Hermeneutik des Textverstehens (lange vor Gadamer) und zumal (lange vor Derrida) eine Metaphysik der Schrift. Grundsätzlich steht für ihn auch die Notenschrift natürlich im Horizont der Dialektik der Aufklärung. "Die ersten Schriftzeichen sind die starr regelmäßigen Trommelschläge der Barbaren, und vielleicht ist die musikalische Schrift überhaupt Nachahmung jener rhythmisch-disziplinären Systeme, die selber bereits die musikalischen Zeitverhältnisse durch die zeitfremde Regelmäßigkeit der Abstände verräumlichen. Jedes Notenzeichen ist das Bild eines Schlages." Doch anders als die Buchstabenschrift ist die Notenschrift doppelten Ursprungs. In ausführlichen Frühmittelalterstudien (man glaubt es kaum!) kommt Adorno zur Unterscheidung eines neumischen von einem mensuralen Moment. Die Neumen koordinieren, mit Vorlauf in der Cheironomie des antiken Chorführers mit ihren festgelegten Handzeichen, eine schriftlose kollektive Praxis, mit der Mensuralnotation werden Dauer und Höhe der Töne fixiert.
Adornos etwas seltsame paläontologische Divinationen, in denen Mittelalter (die Zeit vor Monteverdi), Barbaren, Griechen, Buschmänner, Slawen bunte Reihen bilden, haben ihren philosophischen Sinn in dem materialistischen Bemühen, Musik auf ursprüngliche somatische Impulse zurückzubeziehen. Musikhistorisch wird die Unterscheidung von Neumischem und Mensuralem dagegen erst relevant, wo es nicht nur wie im achtzehnten Jahrhundert um den richtigen Vortrag zeitgenössischer, sondern wie seit der Romantik um die richtige Interpretation historischer Kompositionen geht. Da nämlich macht sich bemerkbar, daß die scheinbar mathematisch genaue Notation eine wesentliche, wie Adorno es nennt, Unbestimmtheit hat. Das Geschriebene fußt auf musiksprachlichen Selbstverständlichkeiten, die wir nur unzureichend kennen. Ebendiese prinzipielle Unbestimmtheit des Textes ist der legitime Ort der Subjektivität des Interpreten. Das Idiomatische seines Spiels greift ein, um das Neumische am Text, die mehr oder weniger expliziten Anweisungen für den richtigen Vortrag, zu übersetzen. "Kategorien wie Geigenton, Anschlag und so weiter, überhaupt ein Die-Sprache-des-Instruments-Sprechen. Auch Caruso. Ohne dies Moment keine große Interpretation." Adorno kommt gleich zur philosophischen Sache: der falschen Vorstellung, es könne das Werk an sich aufgeführt werden. Doch damit soll nicht der Geist gegen den Buchstaben gehalten werden. "Unter keinen Umständen darf die Theorie je mit Kategorien wie Persönlichkeit und so weiter sich abspeisen lassen." Die ganzen Bemühungen um eine Theorie der Notenschrift haben ihren Sinn überhaupt nur im Nachweis, daß der Historismus nicht wider den Geist, sondern wider den Buchstaben sich vergeht. Seine Texttreue ist treulos, weil sie übersieht, daß der Text in seiner prinzipiellen Unbestimmtheit nach dem mitdenkenden Interpreten verlangt.
Gemeinhin bringen die Adorno-Anhänger hier den fortgeschrittensten Stand der Kompositionsgeschichte herbei, verstehen unter dem mitdenkenden den strukturanalytischen Vortrag und kämpfen in seinem Namen gegen die authentische Aufführungspraxis. Doch das Geviert von Mensuralem, Neumischem, Musiksprachlichem und Idiomatischem bewährt sich gerade an dieser Praxis. Adorno kannte nur Historisten, die den Text Note für Note umsetzen wollten und dann in der Tat die einsetzende Langeweile mit Aura bekämpfen mußten. Die spätere Rekonstruktion von Spieltechniken dagegen führte zu der manche überraschenden Einsicht, daß, je mehr wir von den zeitgenössischen Praktiken wissen, um so unterschiedlicher die Interpretationen ausfallen. Harnoncourt und Gardiner sind einander so fern wie Toscanini und Furtwängler. Die Kenntnis der Musiksprache verleiht dem Neumischen eine textuelle Dichte, die dem Idiomatischen überhaupt erst einen Spielraum eröffnet.
Um so schärfer fällt der Vorwurf treuloser Texttreue auf die Modernisten zurück. "Alle Formen des Objektivismus, von Stockhausen bis Walcha, meinen eigentlich dasselbe", sind Flucht in die abstrakte Negation des Espressivo. Es werde zuwenig phrasiert, heißt es fast schon wie bei Sandor Végh, obwohl doch Musik einzig vermöge der Phrasierung spricht. Und zumal das Kauderwelsch, die Sinnlosigkeit von Aufführungen Neuer Musik resultiere daraus, daß niemand mehr sich eine Melodie zu spielen getraut. Natürlich verlangt der angemessene Vortrag eine genaue analytische Lektüre. Das Idiomatische muß das Neumische aus dem Mensuralen heraus bestimmen, darf sich zum Text nicht wie die Kolorierung einer Postkarte verhalten. Doch die Analyse bleibt Mittel. Interpretation ist die "Wiederherstellung des mimischen Elementes durchs analytische hindurch". "Espressivo spielen heißt: den immanenten Vollzug der Musik durchs Subjekt sich zueignen." Das wäre in der Endfassung sicher viel dialektischer, ideologiekritischer und wohl auch strategischer formuliert worden. Hier jedoch ist ganz klar: Es geht Adorno um ein Mehr an interpretatorischer Subjektivität. So ist auch unübersehbar, daß die Adorno-Anhängerschaft unrecht hatte, Michael Gielen oder Walter Levin mit dem Öl der philosophischen Theorie zu salben. Das Öl ist nicht geweiht.
Die Auseinandersetzung mit Adornos Musikphilosophie hat durchgängig den Antagonismus von Ausdruck und Konstruktion, Mimesis und Rationalität zugunsten der analysierbaren Strukturen aufgelöst. In den Fragmenten zum Beethoven-Buch wie jetzt in denen zur Reproduktionstheorie wird deutlich, daß es sich bei Adorno selber genau umgekehrt verhält. Musik ist "mimischen Wesens und der musikalische Sinn als Zusammenhang nichts anderes als die Totalität ihres Gestus. Das impliziert aber die unabdingbare Verpflichtung der musikalischen Erkenntnis auf das sinnliche Erscheinende als ihr strenges Objekt. Man könnte sagen, das konsequente, zum Bewußtsein seiner selbst gesteigerte Aushören der Musik." Mit der gegenwärtigen Musikwissenschaft ist das nicht zu machen. Adorno zielt auf eine Analyse, die nicht aus Angst vor dem Subjekt auf die Daten des Textes starrt, sondern sich Rechenschaft gibt über das eigene Hören, das wiederum notwendig ein Hören von Interpretationen ist - er zielt auf eine interpretierende Musikwissenschaft. Demgegenüber haben die Adorno-Anhänger Adorno betriebskompatibel gemacht. Man kann auch sagen, daß sie ihrer eigenen konventionellen Praxis den lauten Anstrich avanciertester Theorie gegeben haben.
Darin liegt freilich nicht nur Verfälschung. Rolf Tiedemann vermutet im Herausgebervorwort der Beethoven-Fragmente, daß sie nicht zum Buch werden konnten "in einem Zeitalter, in dem die ,besseren Welten', von denen Florestan sang, nur noch blutiger Hohn auf diese Welt hier sind, neben der Pizarros Kerker sich idyllisch ausnimmt". Vielleicht hatte Adorno hier ebensolche Hemmungen. Wahrscheinlicher ist, daß er sich der Mittel nicht sicher war, die Rede über musikalischen Ausdruck zwischen tönend bewegter Form unbeschadet hindurchzusteuern.
Ästhetischer Ausdruck soll intentionslos sein. "Es ist die These des Buches, daß Musik keine Sprache sei." Der Sinn einer Komposition kann in der Tat unmöglich in dem bestehen, was sich der Komponist bei ihr gedacht hat. Wir kämen in einen unendlichen Regreß. "Eine pathetische Stelle bedeutet nicht Pathos, sondern verhält sich pathetisch." Diese Sich-Verhalten bringt dann die lange Kette der Mimesis mit sich. Der Theoretiker verhält sich mimetisch zum Gehörten, der Hörer zum Vorgetragenen, der Interpret zum Text, der Text zur Idee der Musik, die Musik zu den körperlichen Gesten. Aber die genetische Kette hält überhaupt nur zusammen, weil bei jedem neuen Glied die Unmittelbarkeit des Verstehens neu entsteht. Für den musikalischen Interpreten betont Adorno das. Warum sollte das nicht auch für den Wissenschaftler gelten? Ob eine Phrase pathetisch ist, läßt sich rhythmisch, harmonisch, diastematisch genau analysieren, aber um diese Analyse zu vollziehen, muß ich sie als pathetisch bereits verstanden haben.
Aus der Furcht, die leibliche Unmittelbarkeit der Musik, Schopenhauers und Nietzsches Erbe, an die Intentionalität zu verraten, zieht sich Adorno auf ein kategoriales Philosophieren zurück. Gegenstand des Reproduktionsbuches sei "Interpretation als Form". Da er aber zugleich der Philosophie Sachhaltigkeit vindiziert, wird er auf eben die Musikwissenschaft zurückgeworfen, gegen deren Objektivismus seine eigene ästhetische Theorie angeht. An Schubert oder Mozart sieht er die Notwendigkeit, einen "tieferen Begriff der Idealität und Konsistenz des Werkes einzuführen als den der Einheit in der Mannigfaltigkeit der motivisch-thematischen Konstruktion. Das letztere schwebt mir längst vor, aber es entfernt sich von der ,Gegebenheit' der materialen Beschaffenheit der Musik so weit, daß es in eigentlich musikalischen Kategorien kaum mehr sich fassen läßt." Der Fortschritt im Stande der Materialbeherrschung, dieser goldene Knochen all derer, die musikalisch dem Weltgeist voranzulaufen dachten, hatte Adorno schon lange nicht mehr befriedigt. Aber der Konsequenz, daß sich Musik in eigentlich musikalischen Kategorien nicht angemessen fassen läßt, wollte er nicht nachgehen.
Vielleicht bilden die vom Herausgeber gut präsentierten, in weiten Teilen ungeheuer schwer zu lesenden Fragmente zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion zusammen mit den Beethoven-Fragmenten Adornos zweigeteiltes musikphilosophisches, das heißt ästhetisches, das heißt philosophisches Hauptwerk. Sie halten sich weitgehend frei von ideologiekritischer Erbaulichkeit und parteilicher Rücksichtnahme. Und sie führen im Nachvollzug von Adornos ruheloser Selbstkritik wirksamer in die philosophische Arbeit ein, als es eine zur Lehre geronnene Darstellung überhaupt könnte.
Theodor W. Adorno: "Nachgelassene Schriften". Abteilung I: Fragment gebliebene Schriften. Band 2: Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion. Hrsg. v. Henri Lonitz. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001. 400 S., geb., 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Für Reinhard Klein stellt die Veröffentlichung von Theodor W. Adornos nachgelassenen Fragmenten "Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion" ein lang ersehntes Ereignis dar. Mit Adornos Reflexionen glaubt unser Rezensent den schmerzlichen Mangel an musiktheoretischer Fundierung praktischer Interpretationen von musikalischen Werken endlich behoben. Damit biete sich die Chance, ästhetische Erfahrung "mit den Kategorien und Kriterien von Theorie" zu verbinden. Klein hebt hervor, dass Adorno nicht primär als Hörer von Konzerten oder Platten zu seinen Interpretationen gelangte, sondern durch seine eigene künstlerische Praxis als passionierter Pianist: "Hier denkt einer über Musik nach, der ihr von frühester Jugend an verfallen war." Den Höhepunkt von Adornos Aufzeichnungen sieht Klein in dessen Entwurf "einer Hermeneutik der Notenschrift, die nicht in der Analyse des Notierten aufgeht, sondern zugleich eine Theorie der Mimesis in der Musik reklamiert". Der Hinweis auf einige kleinere Widersprüche in Adornos Aufzeichnungen schmälert den Rang dieses Werkes für unseren Rezensenten in keiner Weise: "Vor uns liegt die auf absehbare Zeit wichtigste Publikation zur Philosophie der Musik."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH