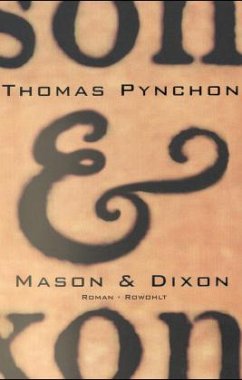Ein historischer Roman über Amerika im 18. Jahrhundert: Der britische Astronom Charles Mason und der Landvermesser Jeremiah Dixon werden von der Royal Society in London beauftragt, den Grenzdisput zwischen den amerikanischen Kolonien Pennsylvania und Maryland zu klären. Die sogenannte 'Mason-Dixon-Linie' entsteht und gewinnt als Grenzstreifen für das junge Amerika sofort symbolische Bedeutung...

Amerika im Schmortopf der Geschichte: Ausgerechnet Thomas Pynchon erneuert den historischen Roman / Von Hans-Ulrich Gumbrecht
Thomas Pynchon, darauf lassen sich schon heute Wetten abschließen, wird als ein Erneuerer des Genres "historischer Roman" in die Literaturgeschichte unserer Zeit eingehen. Bücher wie "Gravity's Rainbow", die verschrobenste aller Chroniken des Zweiten Weltkriegs, oder "Vineland", Pynchons selbstironischer Rückblick auf die Studenten- und Kulturrevolution von 1968, haben einen alten Erwartungshorizont aufgefrischt: den Wunsch, alle Vergangenheit in einer Unmittelbarkeit zu erleben, von der wir seit der Epoche der Romantik glauben, dass sie nur im Bezug auf das tatsächlich Gegenwärtige möglich sei. Im Illusionsraum der Literatur ließ sich dieser Wunsch befriedigen, seit den Mittelalter-Geschichten eines Walter Scott hat er den historischen Roman auf den Plan gerufen.
Ganz unvermeidlich ist jeder historische Roman ein Paradox. Er kann die Erwartungen seiner Leser nur erfüllen, wenn er eine Nähe zur Vergangenheit fingiert, an die wir nicht wirklich glauben. Zugleich aber präsentieren sich historische Romane mit einer Quellenbeflissenheit und intellektuellen Ernsthaftigkeit, die es ganz natürlich erscheinen lassen, dass man auf sie reagiert wie auf die allerwissenschaftlichste Geschichtsschreibung - und dann zum Beispiel (ohne mit der Wimper zu zucken) Nietzsches Unterscheidung zwischen monumentalischer, kritischer und antiquarischer Historiographie auf die Exemplare dieser literarischen Gattung anwendet.
Nichts war schwerer abzufedern für den angenehmen Pakt der Leser-Selbsttäuschung im historischen Roman als die Hoch-Moderne der zwanziger und dreißiger Jahre. Nichts hat die Literatur mehr Leser gekostet als die selbstzerstörerische Wollust, mit der die Literaten jener Jahrzehnte ihren Lesern entgegenschrien, dass alles, woran sie sich bisher erfreut hatten - "Wirklichkeits-Nachahmung", "Welthaltigkeit", "Gegenwärtigkeits-Illusion", bloß der Sündenfall eines selbstgefälligen Trugs gewesen war, für den sie von nun an mit der Extrem-Diät kaum lesbarer Texte büßen und zudem der Verpflichtung nachkommen sollten, ihre Bußfertigkeit mit ostentativer Dankbarkeit für die zugemutete Frustration unter Beweis zu stellen. Als seit den sechziger Jahren (wohl zuerst im internationalen Erfolg des lateinamerikanischen Romans) ganz vorsichtig wieder die Frage geäußert werden durfte, ob sich Gefallen am historischen Roman und literarische Respektabilität vereinbaren ließen, stellten sich rasch zwei Standardantworten ein. Entweder mussten sich die neuen "historischen Romane" unzweideutig als Parodien oder groteske Variationen der traditionellen Gattung inszenieren (das war etwa die genial ausgeführte Lösung eines Gabriel García Márquez); oder ihre Autoren hatten sich nach Verkaufs- und Leser-erfolgen durch extreme Übungen in Texterschwerung und Leser-Frustration literarisch zu rehabilitieren. Günter Grass schrieb die ästhetisch allzu ehrgeizigen "Hundejahre" nach dem anspruchsvollen Bestseller "Die Blechtrommel", Umberto Eco ließ auf den erschreckend erfolgreichen Roman "Der Name der Rose" den sehr akademischen Roman "Foucaults Pendel" folgen.
Erfolgreicher als jeder anderer Literat unserer Zeit hat Thomas Pynchon eine dritte Variante des historischen Romans in nach-hochmodernen Zeiten kultiviert. Seine Formel ist die stets prekäre Balance zwischen Leser-Frustration und Leser-Faszination; zwischen Textformen, die verwirren und das Warmlaufen jener Imagination unterbrechen, und Szenen, die so mit prallen Details und fingierten Erlebnisangeboten gefüllt sind, dass sie als Illusions-Hochstapelei selbst einen Gustav Freytag oder Émile Zola hätten erröten lassen. "Mason & Dixon" bestätigt und verstärkt diesen Zug in Pynchons Werk. Der Titel weist auf eine Episode in der Gründungsphase der Vereinigten Staaten, welche man kaum "prominent" nennen, aber doch stets als "in ihrer Bedeutung deutlich unterschätzt" ins Spiel bringen kann, eine Episode, über die man wenig weiß (die einschlägigen Artikel in den amerikanischen Enzyklopädien sind so sparsam wie die bei Brockhaus und Meyer), aber über die sich (wie Pynchon unter Beweis stellt) mit hinreichender Geduld beliebig viel herausfinden - und wohl auch beliebig viel erfinden - lässt.
Der zentrale historische Bezugspunkt dieses Romans ist die in den Jahren 1763 bis 1767 durchgeführte Ziehung der schnurgeraden Grenzlinie zwischen den damaligen kolonialen Provinzen - und späteren amerikanischen Bundesstaaten - Pennsylvania (im Norden) und Maryland (im Süden) auf 39 Grad 43' 26'' nördlicher Breite. Mit dieser Grenzziehung regelten die Familien Calvert (aus dem Süden) und Penn (aus dem Norden) gütlich ihre über Jahrzehnte dauernden Streitigkeiten, und dafür engagierten sie die englischen Astronomen und Landvermesser - im achtzehnten Jahrhundert hätte man gesagt "Philosophen" - Charles Mason und Jeremiah Dixon. Aus der Nähe besehen, ist dieser historische Bezugspunkt (wie jeder beliebige andere) natürlich viel komplexer - und davon lebt der Roman.
Die Mason-Dixon-Linie, welche zunächst nicht mehr als eine durch "Philosophen"-Namen mit einer Aura von Legitimität versehene Trennung von Besitzansprüchen war, wurde im neunzehnten Jahrhundert zur Trennungslinie zwischen den amerikanischen Nord- und den amerikanischen Süd-Staaten, zur quasi-mythologischen Grenze zwischen verschiedenen Lebensstilen, verschiedenen Konzeptionen von Recht und Politik und vor allem von diametral entgegengesetzten (verkürzt gesagt: britisch-protestantischen und französisch-katholischen) Wert-Systemen. Die "Philosophen" selbst (und das wird niemanden überraschen, der auch nur einen ersten Eindruck von der kulturhistorischen Aufklärungsforschung der letzten Jahrzehnte hat), Charles Mason und Jeremiah Dixon, waren viel weniger philosophisch, wissenschaftlich, vernünftig und neutral, als es ihr Auftrag idealisierend voraussetzte. Die von unserem historischen Bewusstsein in die Nähe eines "Beginns der Gegenwart" gerückte Natur-Philosophie der Aufklärung war theologisch inspirierter Kosmologie und hirngespinstiger Astrologie, perspektivenloser Hobby-Bastelei und der Folklore des Aberglaubens sehr viel näher, als wir wahrhaben wollen. Darüber hinaus gehörten Mason und Dixon zu jenen Kollegen und Zeitgenossen Isaac Newtons, die nie wirklich in das Establishment der britischen Natur-Philosophen aufgenommen wurden und sich deshalb mit im doppelten Sinn peripheren Aufträgen zufrieden geben mussten: astronomischen Beobachtungen in Kapstadt und auf der schon vor Napoleons Exil sprichwörtlich abgelegenen Insel Sankt Helena etwa - und eben mit einer Grenzziehung in der nordamerikanischen Provinz. Beide Komponenten des Stoffes, die nationalgeschichtliche Bedeutsamkeit jener Grenze und die Gestalten der Grenzzieher, haben also eine "dunkle" Seite, die sich gegen das offiziell-flache Selbstbild der Vereinigten Staaten kehren lässt; gegen jenes Selbstbild, welches im Staatsbürgerunterricht vom ersten Jahr der Elementary School an ganz eisern die Nation als unzweideutige Verwirklichung aller Aufklärungsideale vorstellt.
Mehr als irgendein früheres Buch Pynchons rückt der geschichtliche Bezugspunkt "Mason & Dixon" in die Nähe der Versuchung, den historischen Roman zu einer Nationalidentität stiftenden Mythologie auszubauen. Was Pynchon auf Distanz zu dieser Möglichkeit hält, die im Übrigen eher ein ästhetisches Auslaufmodell als eine ideologische Gefahr darstellt, ist seine Selbst-Verpflichtung auf das Formen-Repertoire des literarischen Modernismus. Manchmal wirkt diese Selbst-Verpflichtung ziemlich zwanghaft: zum Beispiel angesichts der unablässigen Unterbrechungen des primär linearen Erzählflusses (Mason und Dixon auf dem Weg nach Kapstadt und zurück, auf dem Weg in die amerikanischen Provinzen und zurück) durch eine obstinat wiederholte sekundäre Erzählsituation, in der "dieselbe" Geschichte als retrospektiver Bericht eines Geistlichen für die versammelten Mitglieder einer etwas bigott anmutenden amerikanischen Familie des neunzehnten Jahrhunderts inszeniert ist. Man wird das Gefühl nicht los, dass Pynchon hier sein schlechtes Gewissen über die nach modernistischen Kriterien allzu schlichte Geradlinigkeit seiner Erzählung abarbeitet.
Brillant handhabt er dagegen ein anderes - auch auf mehreren Ebenen wiederkehrendes - Verfahren, zu dem es ein Analogon in der dekonstruktivistischen Philosophie gibt. Man könnte diesen Kunstgriff das Verfahren der "verwischenden Grenzlinie" nennen. Pynchon ruft zum Klischee erstarrte binäre Unterscheidungen ab, nur um zu zeigen, dass sie sich nicht durchhalten lassen - und um auf diese Weise begriffliche und imaginative Komplexität zu stiften. Das gilt - wie schon erwähnt - für den Trivialbegriff von Aufklärung und für die offizielle historische Selbstdeutung der Vereinigten Staaten. Das gilt vor allem für die Mason-Dixon-Linie selbst, die Pynchon immer wieder anzuspornen scheint, Vernunft und Gelassenheit im "unvernünftigen" Süden, Aberglauben und Fanatismus im "rationalen" Norden zu entdecken. Und das gilt auch für die Protagonisten Charles Mason und Jeremiah Dixon - mit dem Effekt, dass in ihnen schließlich Leser-Irritation und Leser-Faszination konvergieren.
Zunächst scheinen die Gestalten von Mason und Dixon wie Allegorien der geschichtswissenschaftlichen Epochenbegriffe "Spät-Aufklärung" und "Vor-Romantik" angelegt. Auf den ersten Blick wirkt Charles Mason aggressiv vernunftgläubig, mit einem Schuss von Melancholie, die sich in der Trauer um seine jung verstorbene Frau verdichtet. Jeremiah Dixon hingegen, der Junior-Partner in der Arbeitsgemeinschaft der beiden Natur-Philosophen, sieht aus wie der sinnenfreudigere, emotionalere (aber immer noch ganz blind auf "Wissenschaft" setzende) Held. Doch am Ende des Romans "weiß" der Leser, dass Dixons erotische Bilanz die eines Versagers ist (nicht zufällig fühlte er sich nie im Süden der amerikanischen Provinzen wohl und nicht zufällig lässt er seine Zukunftsträume in der englischen Provinz versacken), während der von subdepressiven Zuständen und anderen Gespenstern geplagte Mason für den amerikanischen Süden schwärmt und schließlich mit einer jungen Gattin und je zwei Söhnen aus seinen beiden Ehen in die inzwischen von einer revolutionär brodelnden Kolonie zur jungen Republik verwandelten Vereinigten Staaten auswandert - wo er bald stirbt.
Nun aber zu glauben, dass solche Begriffs-Verwischung den Leser verpflichte, die Vereinigten Staaten als das Produkt eines mühsam, aber erfolgreich durchgehaltenen Rationalismus und eines aus ihm erwachsenden Vitalismus zu identifizieren, überhaupt zu glauben, dass eine solch klar konturierte Auslegung von Mason & Dixon möglich sei, heißt Thomas Pynchon unterschätzen. Denn selbst wenn man voraussetzen will, dass es in diesem Roman um "historisch gewachsene Identität" geht (und also für einen Moment zu vergessen bereit ist, dass dies eine ziemlich deutsche Prämisse ist), so bleibt doch unübersehbar, dass sich die Identitäts-Vergewisserungen hier nicht bloß auf dem Niveau abstrakter Begriffe und blasser Allegorien abspielen. "Mason & Dixon" ist durchsetzt von kleinen Ursprungsmythen des heutigen amerikanischen Alltags: Pynchon erzählt Mikro-Geschichten über die Entstehung der sperrigen Temperaturmessung in Fahrenheit und über die erste amerikanische Pizza, über die Erfindung des Sandwiches und die Einführung der Nichtraucherzone. Diese Geschichten erinnern an die in der amerikanischen Werbung beliebten Mini-Mythen über die "Erfindung" eines Produkts (das erste "Budweiser-Bier" oder der erste "McDonald's-Hamburger"), und wie die Werbungsmythen verwischen auch sie die Grenzlinie zwischen einer ausschließlich auf Fakten basierenden und einer frei erfindenden Vergangenheits-Vergegenwärtigung.
Am meisten beeindruckt aber hat mich eine Verwischung auf der Ebene der sprachlichen Form, welche die deutsche Übersetzung so gut es geht (aber hier gibt es kaum zu überwindende Grenzen!) einlöst: die Überlagerung von Pynchons virtuoser Mimikry mit dem amerikanischen Englisch des achtzehnten Jahrhunderts, seinen zahllosen orthographischen, lexikalischen und idiomatischen Verstiegenheiten und einem komplexen Prosa-Rhythmus, der manchmal an den Beat der großen Romanciers der Hoch-Moderne, an die Syntax von James Joyce oder Louis-Ferdinand Céline etwa, erinnert. Hier ist der erste Satz aus der deutschen Übersetzung von "Mason & Dixon", in dem jene retrospektive Erzähl-Szenerie in einer amerikanischen Familie des neunzehnten Jahrhunderts aufgerufen wird: "Schneebälle haben ihre Bahn gezogen, die Wände von Nebengebäuden ebenso wie Vettern und Basen besternt und Hüte in den frischen Wind von Delaware geschleudert - nun schafft man die Schlitten unter Dach, trocknet und fettet sorglich ihre Kufen, stellt Schuhe im hinteren Flur ab und fällt strümpfig in die große Küche ein, die von früh an in planvollem Aufruhr, untermalt vom Deckelgeklirr verschiedener Pfannen und Schmortöpfe, duftend von Küchengewürz, geschälten Früchten, Nierenfett, erhitztem Zucker - und nachdem die Kinder, in fortwährender Unrast, zum rhythmischen Geklatsch von Teig und Löffeln, alles Erdenkliche erschmeichelt und stiebitzt, begeben sie sich, wie den ganzen Advent lang an jedem Nachmittag, in ein behagliches Zimmer im hinteren Teil des Hauses, das schon seit Jahren ihrem unbekümmerten Ansturm überlassen." Manchmal gewinnt dieser ebenso komplexe wie unüberhörbare Rhythmus in der Lektüre die Oberhand - und man genießt dann das Sich-Verirren in einem verfremdenden Sprach-Stil, in Bildern und Assoziationen, die der Anlehnung an eine Handlung vielleicht gar nicht mehr bedürfen.
Die modernistischen Verfahren, mit denen Thomas Pynchon hantiert, erzielen hier und da wahrhaft unvergessliche special effects - aber auch die zahlreichen Blindgänger und erzählerischen Durststrecken prägen sich ein. Die eindrucksvollsten special effects jedenfalls sind Porträts der beiden Zentral-Gestalten aus der amerikanischen Revolution, Benjamin Franklin und George Washington. In ihnen gewinnt das Gewebe aus historischer Faktendichte und anachronistischen, sehr gegenwärtigen Sprach-Gesten jene unmögliche "Unmittelbarkeit" in der Erinnerung der Vergangenheit zurück, von der als Bedürfnis der klassische historische Roman gelebt hatte. Pynchons Aufklärungsphilosoph Benjamin Franklin ist ein geschäftsbesessener, public relations-geiler, angestrengt erotomaner Herr im fortgeschrittenen Alter - ausgestattet mit der singulären Kraft, die potenziell welthistorische Politik in den zunehmend unzufriedenen Provinzen in seine schon etwas zittrigen Hände zu nehmen. George Washington ist ein ebenso neureicher wie unangestrengt genießender Plantagenbesitzer im künftigen Süd-Staat Virginia, der unendlich Zukunft hat, obwohl er seine Sklaven - als Sklaven - liebt, eine allzu tüchtige Gattin auf Distanz hält und den Besuch der englischen Natur-Philosophen als willkommene Gelegenheit nutzt, um mit ihnen frischen Hanf zu rauchen.
Natürlich ist Benjamin Franklin (zum Beispiel) der Kennedy-Typ des amerikanischen Politikers und George Washington (zum Beispiel) der Clinton-Typ eines amerikanischen Präsidenten. Aber "Mason & Dixon" lässt sich auf den "kritischen" Typ literarischer Geschichtsschreibung nicht festlegen. Gewiss, die Bilder und die Töne, in denen er die Gründerjahrzehnte der Vereinigten Staaten erzählt, werfen ein grell ironisches Licht auf den offiziellen Anspruch, eine "unter Gott" gelungene Verwirklichung der Aufklärungs-Utopie von der idealen Gesellschaft zu sein. Aber was als die traditionell "dunkle Seite" dieser Selbstreferenz ins literarische Licht kommt und so den Ironie-Effekt stiftet, ist nicht durchaus negativ zu sehen. Der im Bürgerkrieg geschlagene Süden ist nicht gänzlich von den seither offiziell "nördlichen" Vereinigten Staaten absorbiert worden; die steife Religiosität des protestantischen Amerika könnte sich als Prinzipienstärke bewähren; individuelle Geschäftstüchtigkeit und individuelle Genusssüchtigkeit sind immerhin gut für die nationale Wirtschaft.
Nicht unähnlich dem Film "Forrest Gump" (wenn die Pynchon-Gemeinde einen so häretischen Vergleich verzeihen mag), ist "Mason & Dixon" weder eine kritische noch eine monumentalische Geschichtsvergegenwärtigung. Der Roman ist Teil und Beweis der Fähigkeit, die dunklen Seiten der eigenen Geschichte und der eigenen Identität mit Selbstironie zu sehen, ohne sich die Alternative von Selbst-Geißelung und unironischer Selbst-Affirmation aufzwingen zu lassen. Affirmierende Selbst-Ironie, die Fähigkeit über sich selbst zugleich mit Aggression und Sympathie zu lachen, ist auch eine Grenz-Verwischung - womöglich gar eine Grenz-Verwischung, von der manche Europäer lernen sollten.
Thomas Pynchon: "Mason & Dixon". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Nikolaus Stingl. Rowohlt Verlag, Reinbek 1999. 1023 S., geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Hans-Ulrich Gumbrecht feiert Thomas Pynchons Roman "Mason & Dixon" in einer ganzseitigen Besprechung des FAZ-Buchmessenbeilage als einen Erneuerer des historischen Romans. Als Hintergrund, vor dem Pynchon zu verstehen ist, schildert er die Avantgarden der Literatur im 20. Jahrhundert, die jedes "satte" Erzählen und jeden Begriff der Nachahmung von Wirklichkeit und Identifikation mit den Helden in Frage gestellt und zu "kaum lesbaren Texten" geführt habe. Große Erzähler des 20. Jahrhunderts mussten sich dazu verhalten. Gumbrecht nennt Gabriel Garcia Marquez, der sich mit dem Mittel der Parodie beholfen habe. Pynchos Technik erklärt Gumbrecht als "stets prekäre Balance zwischen Leser-Frustration und Leser-Faszination". Die Ziehung der Grenzlinie zwischen Nord- und Südstaaten der USA durch Charles Mason und Jeremiah Dixon in den 1760er Jahren wird für Gumbrecht auch zur symbolischen Trennlinie zwischen klassischem Erzählen und modernistischen Formen, wobei Gumbrecht das Gefühl nicht los wird, dass die unablässigen Unterbrechungen des linearen Erzählflusses auch ein wenig aus schlechten Gewissen gegenüber den Dogmen der Avantgarde eingebaut werden. Trotzdem erkennt der Rezensent in den "Grenzverwischungen" eine Fähigkeit zur Selbst-Ironie, die er auch den Europäern bei der Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte anrät.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"
Ein burleskes Geschichtsepos, überquellend von Sprachwitz und Aphorismen, enzyklopädischer Wissensfülle und ironischer Verfremdung. (...) Eine phantastische, verrätselte Reise in die Psyche Amerikas. Welt am Sonntag
Ein Roman wie eine gewaltige Symphonie aus der Neuen Welt, und ein Sprachkunstwerk von einem ganz Großen der US-Literatur. Stern