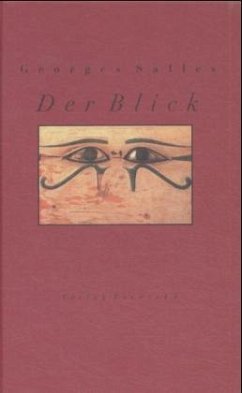Produktdetails
- Verlag: Vorwerk 8
- Seitenzahl: 128
- Deutsch
- Abmessung: 220mm
- Gewicht: 286g
- ISBN-13: 9783930916351
- ISBN-10: 3930916355
- Artikelnr.: 08936740

Cicerone des Genusses: Georges Salles beobachtet den Blick seiner Generation auf die Kunst / Von Henning Ritter
Es gibt Bücher, die einen, kaum hat man sie aufgeschlagen und ein paar Zeilen gelesen, an etwas intim Vertrautes erinnern, das man völlig vergessen hatte. Was geschieht, wenn man eine kleine Skizze von Rubens anschaut, was tut der Blick, wonach sucht er, woran findet er Halt, und was bringt er von seiner regellosen Wanderung über das Blatt mit? "Vor einer kleinen Rubensskizze, eine Himmelfahrt darstellend, einer meergrünen, perlmuttfarbenen, stellenweise feucht schimmernden Leinwand, hörte ich jemanden murmeln: ,Wie eine schöne Auster'", so beginnt Georges Salles seinen Essay über den Blick, in dem er sich auf die Suche begibt nach dem Anteil der Sinneseindrücke am ästhetischen Vergnügen. Der kulinarische Vergleich ist ihm willkommen, denn er entfernt den Betrachter am weitesten von Bedeutungen und Belehrungen, welche die kleine Leinwand auch noch transportieren mag, über die der Autor in seinem schmalen Buch aber kaum ein Wort verliert, weil ihnen nicht zuletzt in den Kunstwissenschaften eine mächtige Advokatur erwachsen ist. Ihr gegenüber ist der schlichte Kunstliebhaber oft genug machtlos, fehlen ihm doch meist die Worte, um seinen Zugang zu den Werken zu erklären.
Der heutige Leser, der diesem Plädoyer für die Sinnlichkeit im Umgang mit der Kunst verwundert folgt, spürt sofort, daß ihm die Sprache für seine Kunsteindrücke vollends abhanden gekommen ist. Neugierig vertraut er sich dem Cicerone des Sinnengenusses an, der sich auch zu seiner Zeit schon auf einem bedrohten Terrain wußte, eingeengt von den Kunstkennern, die Informationen über Handwerk und Bedeutungen häufen, und den Künstlern, die wortkarg die Farbenernte für ihre eigene Produktion einholen. Der Kunstliebhaber, der Dilettant, der die Museen, Ausstellungen und Galerien durchstreift, mit ungewissem Ziel und ohne greifbare Erträge, ist eine eigene Spezies. Er ist der Träger des Blicks, von dem Georges Salles' Essay handelt. Was läßt sich über diesen Blick sagen? Seine Gewißheiten sind augenblickliche, er urteilt so rasch, wie er sieht, formuliert sinnliche Gewißheiten, die nicht in Begriffe umgewandelt werden wollen, sondern an der Materie haften und sie beleben, das Band zum Stofflichen der Bilder nie durchschneiden, als müsse alles aus der Faktur der Werke gewonnen werden, als gäbe es ein stoffliches Denken und als sei all das, was die Kenner und Kunsthistoriker über die Werke sagen, nur ein Verrat an den Sinnen und dem bloßen Dasein der Werke.
Georges Salles beruft sich auf das Moralistenwort vom Tiefsinn, der auf der Oberfläche zu suchen sei. Die wenigen Seiten, auf denen er die Abenteuer des Blicks, seine fragende Insistenz und seine unersättliche Aufnahmefähigkeit schildert, führen aber nicht in einen Mystizismus der sinnlichen Erleuchtung. Sie wollen bloß daran erinnern, daß man über Sammeln, Ästhetik, Museen nur sprechen kann, wenn man diese "optischen Reaktionen" schildert. Es geht um keine Lehre, aus der jene Anleitungen zum Sehen zu gewinnen wären, die den Akt des Sehens meist allzu schnell hinter sich lassen, um das Gesehene zu fixieren.
Um zu verdeutlichen, was er meint, sucht Georges Salles die Sammler, die er kennt, auf ihren Pirschgängen oder in ihren Sammlungen auf. Dort findet er, was er dem Blick schon abgeluchst hatte, jene scheinbar regellose Verbindung von Dingen unterschiedlichster Herkunft und Art, die im Interieur des Sammlers in ein Kaleidoskop des Disparaten eintreten. Beim Louvre-Direktor Raymond Koechlin treffen Japan, China, Islamisches, Ägypten aufeinander, französisches Mittelalter und Impressionismus, Renoir, Monet, Fantin-Latour, Degas neben japanischen Holzschnitten, damaszenische Teller, chinesische Bronzen, fernöstliche Keramik. In jeder Entscheidung, seiner Sammlung etwas hinzuzufügen, offenbart sich ein Zug des Sammlers, eine Nuance seines Geschmacks, eine Amplitude seines Blicks. Bevor bestimmte Kombinationen Mode werden, werden sie vom Blick des Sammlers vorgefühlt und ertastet und müssen sich im Nebeneinander einer Sammlung behaupten. Dann kann der Geschmack des Sammlers andere anregen und bis in die öffentlichen Sammlungen ausstrahlen. So bekommt das so schwer in Worte zu fassende Operieren des Blicks für Kunstwerke eine Geschichte, die wir an den Sammlungen, Ausstellungen und Museen ablesen.
Der Autor versucht, die Stellung seiner Generation in der Geschichte des Blicks zu bestimmen, seine Reichweite und seine Kraft, Heterogenes zu umfassen. Es steht für ihn außer Zweifel, daß das Auge der um 1900 Dreißig- bis Vierzigjährigen ganz anders geschult war als das seiner Generation, "die in der Blütezeit des Fauvismus, des Kubismus, der Neger- oder der polynesischen Kunst und der ungezählten archäologischen Entdeckungen auf dem ganzen Erdball aufgewachsen ist". Damals ereignete sich, das macht man sich nur selten klar, die größte Erweiterung des Horizonts der Kunstwahrnehmung, die es bis dahin gegeben hatte. Deswegen setzt der Autor dem Blick seiner Generation das Denkmal dieser Essays. Es waren nicht nur die Künstler und Sammler, sondern auch die Kunstliebhaber, die sich auf dieses Abenteuer einließen. Und in dem Gestus, mit dem Georges Salles die Ansprüche der Wissenschaft auf dieses ungeheure Terrain abweist, liegt der Stolz des Erstbesteigers eines Gipfels. Er verhehlt deswegen nicht seine Geringschätzung jener Kunstliebhaber, die sich weiterhin ausschließlich auf die alten Meister kaprizierten und ihren Sinnen zuwenig zutrauten. Gegen solche Timidität verteidigt Salles den unersättlichen Blick des Kunstliebhabers, seine Raschheit, die Plötzlichkeit seiner Sehentscheidungen. Ein solcher Blick muß allem vorausgehen, was dann noch folgen mag. Es geht offenbar um eine Schicht des Verhaltens zu Kunstwerken, von der sich die später kommenden gelehrten und wissenschaftlichen Bemühungen entfernen, in dessen Bahnen sie sich aber, oft ohne es zu wissen, bewegen. Georges Salles' Essay ist eine Hommage an den unreglementierten Blick der Kunstliebhaber und Sammler, die allein ihrem Auge und dem sinnlichen Gedächtnis, dem bloßen Anblick der Werke vertrauen.
In dem Kapitel "Die Sammlungen" setzt der Autor einem Sammlertypus ein Denkmal, der schon zu seiner Zeit auszusterben schien: Kunstliebhaber ohne Namen, die die Versteigerungssäle, Ausstellungen und Antiquitätenläden durchstreifen und Tag für Tag auf Beute aus sind, auf Entdeckungen, von denen allein sie wissen und die sich doch auf geheimnisvolle Weise, wie ein Gerücht, verbreiten und unmerklich den Geschmack der Pariser Kunstwelt beeinflussen. Diese Kunstjäger sind gleichsam ein wanderndes Auge, sie verkörpern den Blick, der sich auf die Erscheinungsweise der Dinge konzentriert und ihnen ungeahnte Sensationen entlockt. Georges Salles schildert einige dieser Entdeckungsreisenden und Abenteurer, deren Vorläufer man in den Romanen Balzacs findet; Flaubert nannte sie, wie Salles mit Wohlgefallen notiert, "die tapferen Kerle in ihren Ecken". Auf wenigen Seiten werden einige namhafte Sammler der Zeit porträtiert, Sauvageot, Henry Rivière, François Poncetton, Fénéon, Madame Errazuriz. Er skizziert er ihre Vorlieben, ihre Begabungen, ihre Art, mit ihren Sammlungen umzugehen, und mußmaßt ein verhindertes Künstlertum. Daß es oft eine unentfaltete künstlerische Begabung ist, die zu solchen Mitteln des Selbstausdrucks greift, mindert deren Wert nicht, zumal Künstler, wie Salles anmerkt, nur selten gute Sammler sind: "Im Gegensatz zum schöpferischen Talent ist die Halb-Begabung und erst recht die totgeborene darauf angewiesen, nicht bei sich selbst, sondern anderswo nach jener Vollkommenheit zu suchen, die, wie sie selbst weiß, den eigenen Werken versagt bleibt."
Bei einem exorbitanten Sammler, dessen Namen er verschweigt, trifft der Autor schon im Vorraum auf den gestürzten Jockey von Degas, auf polynesische Götter, zwei dunkle Cézannes, chinesische Keramik, das Bruchstück einer hethitischen Bronze, romanische Kapitelle und dann wieder Matisse, Picasso, Braque, chinesische, griechische, mexikanische Keramik, Watteau, Goya, Chardin - eine Sammlung aus Vorliebe für Extreme. Sie kommen nur durch eine Kopfbewegung, durch wenige Schritte miteinander in Berührung: "Wir sind in jene Kammern der Ekstase eingedrungen, wo der Geist sich dem Zauber der Materie unterwirft." Von Preis und Wert ist auf diesen Seiten nicht die Rede. Zustimmend wird Raymond Koechlin, der Chef des Louvre, zitiert: "Man ist ein schlechter Sammler, wenn man zuviel Geld hat."
Ihre Intensität gewinnen diese Seiten, die an Prousts sinnliche Beschwörungskunst des Vergänglichen erinnern, eben daraus, daß sie eine Welt schildern, die vom Untergang bedroht, vielleicht schon untergegangen ist. Die Aufgabe des Kunstliebhabers werde in der modernen Gesellschaft immer schwieriger, merkt der Autor an, Privatsammlungen drohten zur Ausnahme zu werden, der Staat dränge die Privatinitiativen zurück - auf Kosten des Geschmacks, der sich in der Sammelleidenschaft auslebte und dessen Beweglichkeit und Elastizität Wirkungen der Kunst freizulegen vermag, die in keinem einzelnen Kunstwerk verankert waren.
Das Kapitel "Das Museum" beschäftigt sich mit dem Kommenden, das sich in den dreißiger Jahren abzuzeichnen begann und damals eine neue Disziplin begründete, die "Museographie", der in unseren Tagen die "Museologie" gefolgt ist. Georges Salles schildert eine Musterschau dieser neuen Didaktik, eine 1937 von René Huyghe eingerichtete Ausstellung mit Werken van Goghs. Da tauchen die belehrenden Texte an den Museumswänden auf, in großen Lettern ein Zitat aus einem Brief von van Gogh, die Bilder werden begleitet von Schrifttafeln - "ich muß an die Collagen denken, die Picasso und Braque um 1911 erfanden". Der Buchstabe legt sich über das Bild. Die Gemälde sind alle gleich gerahmt, in grellweiße Rahmen, die Bilder in Serie gehängt, entsinnlicht. Wir kennen zur Genüge, was Salles mit Verwunderung als eine Neuheit im Kunstleben beschreibt und was für ihn gleichbedeutend ist mit einem verhängnisvollen Übergriff der Wissenschaft auf die Kunstgegenstände, deren Reichtum reduziert wird, indem man sie auf ihren Zeugniswert festlegt: "Man macht sich über ihn her, um das Besondere an ihm einzuebnen und ihn auf Biegen und Brechen auf das Dokumentarische zu reduzieren."
Die Debatte über das Verhältnis von Genuß und Erziehung im Museum ist so alt wie das Museum selbst. Georges Salles reiht sich in die Reihe derer ein, die den Kunstgenuß hegen wollen, die darüber nachdenken, wie man den Sammlungen in den Museen neues Leben einhauchen kann, und die Dissonanzen und Kontraste begrüßen, wenn sie nur zur Lebendigkeit beitragen und die suggestive Kraft der Werke erhalten. All dies ist eine Frage künstlerischer Sensibilität, nicht der Didaktik. Was Georges Salles sich ankündigen sah, ist heute allgegenwärtig: die Fülle der technischen Präsentationsmöglichkeiten, die einen eigenen Ausstellungswert beanspruchen, fast immer auf Kosten der ausgestellten Werke.
Nicht weniger groß erscheint diesem Kunstliebhaber die Gefahr, die nur auf die Deutung der Werke ausgeht und sie auf eine Bedeutung festlegt, die sie von nun an wie ein Zeichen vertreten. Die Werke werden gelesen, übersetzt, in ein Dokument verwandelt, während sich jene regellosen Reflexionen, die von den sinnlichen Qualitäten der Werke angeregt wurden, verflüchtigen. Der Blick auf die Werke wird starr. Das mächtige Gegenmittel, auf das der Autor vertraute, waren die neu entdeckten Kunstregionen und Zivilisationen, die archäologischen Funde, die damals in den Bezirk der kanonischen Werke einbrachen, zu Vergleichen jenseits möglicher Einflüsse herausforderten und so heterogen waren, daß die allzu schnellen Angleichungen ans Vertraute unterbleiben mußten. In Salles'Generation waren es vor allem die Kunst Vorderasiens, die buddhistische Bilderwelt, Sumer, Gandhara, Persien und Syrien, die das Leben der Formen, wie die glückliche Prägung von Henri Focillon lautet, um ungeahnte Varianten bereicherten.
So wurden durch die Archäologie neue Spannungsfelder aufgebaut, in denen etwa die griechischen, die romanische und die Gandharakunst in eine ferne Formverwandtschaft eintraten. Jenseits der Klassifikation der Formen und Stile und jenseits der Einflüsse tat sich am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ein ungeheures Repertoire von Formen auf, eine Vermischung des räumlich und zeitlich Entfernten. Am Ende überrascht es den Leser nicht, wenn der Autor den Anteil der Surrealisten an dem von ihm gefeierten Blick auf die Kunst hervorhebt: "Ihr systematischer Kampf gegen alle Konformismen, die sie aus dem Tuffstein unserer Gewohnheiten herausrissen; ihre Entschiedenheit, Wort, Gegenstand und Idee aus ihren angestammten Sphären hinaus- und in die Luft zu jagen; der Einfallsreichtum, mit dem sie den wimmelnden Hauch des Unartikulierten einfingen, hat die ursprünglichen Bedingungen aller Schöpfung wieder zum Vorschein gebracht."
Nicht die geringste unter den vielen Überraschungen dieses glanzvollen Kunstessays ist die Tatsache, daß der 1899 geborene und 1966 gestorbene Verfasser selbst zu den von ihm mit so großen Reserven behandelten Kunstwissenschaftlern gehörte. Er war, als er seinen Essay schrieb, seit 1932 Konservator für asiatische Kunst im Louvre und wurde nach dem Krieg Direktor der Musées de France. In dem Kapitel "Die Ausgrabung", einem 1937 in der "Revue de Paris" erschienenen Aufsatz, den er seinem Essay hinzugefügt hat, erhält der Leser einen Eindruck von dem Enthusiasmus, der die französische Archäologie damals beflügelte. Man glaubte sich der Entschlüsselung des Formenrepertoires der Weltkunst auf der Spur, man glaubte nun endlich alles zu überschauen, woraus die Kunst gewachsen war, man war dabei, ihren Code zu entziffern. In Vorderasien vor allem hatten sich ungekannte Formen offenbart, die sofort nach der Entdeckung ihren Weg in die Ateliers der Künstler und die Zeitschriften der Avantgarde fanden: "Die gegenwärtige Bedeutung der Archäologie wird eines der Kennzeichen unserer Epoche sein. In ihrem Gefolge hat sich eine überraschende Neugierde auf Formen entwickelt, die der Phantasie unserer Zeitgenossen alle Formmöglichkeiten offenbart hat und den Künstler dazu trieb, die Welt heute nach einer Formel wiederzuerschaffen, die er am nächsten Tag schon wieder verleugnete, um seine Suche anderswo fortzusetzen."
Diese erstaunliche Präsenz der Archäologie im Kunstwollen der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ist heute weitgehend vergessen. Bewahrt ist die Inspiration, die Archäologie und moderne Kunst verband, nicht nur in Georges Salles' Essay, sondern auch in den Kunstschriften von André Malraux, die im Umgang mit Georges Salles und seinen archäologischen Weggefährten angeregt wurden. Eines der schönsten und spektakulärsten Beispiele für die Annäherung des Entfernten, die den Surrealismus, die Archäologie und die Kunst jener Jahre gleichermaßen faszinierte, findet sich in Malraux' "Stimmen der Stille", wo ein buddhistischer Kopf aus Gandhara neben einen Reimser Engelskopf gestellt ist. Solchen Träumereien eines unendlichen Gesprächs der Formen hat sich auch Georges Salles gerne überlassen. Sein 1939 erschienener Essay, den Walter Benjamin gleich bei Erscheinen erkannt und gerühmt hat, ist ein bedeutendes Beispiel der von moderner Kunst und Archäologie gemeinsam inspirierten Kunstwahrnehmung - ein Essay über Kunst, der nur wenige seinesgleichen hat.
Georges Salles: "Der Blick". Aus dem Französischen übersetzt von Barbara Heber-Schärer. Verlag Vorwerk 8, Berlin 2001. 128 S., geb., 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Georges Salles kultiviert den
träumerischen Blick des Künstlers
Es muss schon ein besonderer Museumsdirektor sein, der sich über Museumsbesucher lustig macht, die „dunkel gewordene alte Meister” bewundern. Tatsächlich, so der Museumsdirektor, ist „die Gunst”, die die alten Meister vom „großen Publikum” erfahren, „ein kurioses Indiz für die Geringschätzung, mit der die meisten Menschen den Eindrücken ihrer Sinne begegnen.” Der Kunstliebhaber, der hier spricht, war 1939, als sein schmales Buch „Der Blick” erschien, Leiter der asiatischen Sammlungen des Louvre und sollte es nach dem Krieg immerhin bis zum Leiter der Musées de France bringen:
Geschrieben hat er auch dann nicht viel: Georges Salles, 1889 im Jahr der Einweihung des Eiffelturms als Enkel von Gustave Eiffel geboren, war von seiner Ausbildung her Archäologe und gehörte zur seltenen Spezies der theoretisch interessierten Feinsinnigen. Kein Wunder, dass Walter Benjamin begeistert war, als ihm „Der Blick”, von Adrienne Monnier empfohlen, in die Hände fiel: Kunstwerke, zitiert er Salles in einem Brief an Max Horkheimer vom 23.März 1940, sind nicht ausschließlich Kunstwerke. Sie sind auch „Zeugen der Epoche, die sie wieder aufgefunden, des Gelehrten, der sie studiert, des Fürsten, der sie erworben hat, und schließlich der Kunstliebhaber, die sie immer wieder neu ordnen. Auf ein und demselben Objekt kreuzen sich die Strahlen unzähliger Blicke, naher und ferner, die ihm ihr Leben mitteilen.”
Mit Schauen beschäftigt
Wenn man so will, hat hier Salles 1939 eine Rezeptionsästhetik entworfen, als diese noch nicht gängig war. Gleichzeitig fordert er eine Kunstwissenschaft als Gesellschaftswissenschaft und von dieser wiederum, dass sie sich auch mit Kunstwerken auseinander setze: „Um eine Kunst in ihren Grundlagen zu studieren, müssen wir letztlich unseren Rahmen zerbrechen und ins Herz der Halluzinationen eintauchen, von denen diese Kunst uns nur einen geronnenen Niederschlag liefert; man muss in die Tiefen verschwundener sozialer Arten reisen. Eine abenteuerliche Aufgabe, an die sich eine ihrer Mission bewusste Soziologie wagen könnte.”
Das klingt trotz aller Eleganz der Formulierung, die das gesamte Buch kennzeichnet, recht theoretisch, was als Gesamteindruck falsch wäre. Unübersehbar geht Salles zuallererst vom sinnlichen Eindruck aus, von der Materialiät des Werks. Der erste Blick soll nie der des kategorisierenden, so genannten „Kenners” sein. Bewundernd spricht Salles vom „träumerischen Blick des Künstlers”, der dieses oder jenes Detail hervor hebt, sich von dort her das Werk erschließt.
So führt das Interesse für eine Soziologie der Kunst auch keineswegs zur Anhäufung von verschriftlichtem Wissen, das vom Ausstellungs-Besucher gefälligst geschluckt werden soll. Salles mokiert sich über eine zeitgenössische Van Gogh-Ausstellung, die in seinen Augen genau dies anstrebte und dabei die einzelnen Kunstwerke, alle vierzig gleich gerahmt, unerträglich phantasielos präsentierte. Salles erzählt, wie er es selber gerne hätte, indem er eine Modell-Ausstellung beschreibt: Tizian in Venedig, 1935: „Der Palazzo”, so Salles, „zählte nicht”, dafür wurde jedes einzelne Werk „als Ehrengast behandelt. Manche hingen an den Wänden; die meisten jedoch standen auf Staffeleien, je nach ihrer Größe höher oder niedriger, und so, dass das Licht am günstigsten fiel. Keinerlei Ordnung war zu erkennen; aber die Dinge wirkten in ihrem Element.” Muffige Geister dürften eine derart „unsystematische”, „wenig pädagogische” Ausstellung skeptisch betrachten. Aber dem Pädagogen Salles geht es bei allem, was er vermitteln möchte, eben nicht um systematisch Abfragbares, sondern immer um die Schulung der Sinne.
Salles- Buch „Der Blick”, das unter diesem knappen Titel von der Archäologie bis zur Lebenskunst von beinahe allem handelt, entwirft auch eine eigene Art von Heroen: Mit wenigen Strichen skizziert Salles die großen Pariser Sammler seiner Zeit: Henri Rivière, Raymond Koechlin, Charles Vignier, Francois Poncetton, Fénéon und andere. Sammler, so Salles, der jeden von ihnen zuerst so individuell beschreibt, wie er es für ein Kunstwerk fordert, haben „bei aller Verschiedenheit” eines gemeinsam: „Mit Schauen beschäftigt, sind sie eher Zeugen als Akteure. Ihr Daseinsgrund ist das Verstehen, ihre Lust die Freiheit des Urteils”. Die meisten sind Einzelgänger, „von ein paar alten Freunden abgesehen, ziehen sie die Gesellschaft der Dinge vor; mit anderen Menschen verkehren sie nur, um einen Bauern zu ziehen oder sich mit einer Maske zu zerstreuen”. Nachdem er seine Sammler so herausgehoben hat, versetzt ihnen der geschickte Stilist Salles mit einem Zitat auch noch einen kleinen, trockenen Stoß: Anderen Menschen gegenüber könnten sie, „bei aller Selbstbeherrschung (...) ein Lächeln meist schlecht unterdrücken. Flaubert hat ihnen in seiner brüderlichen Sprache ein schönes Etikett verliehen: scherzhaft nennt er sie ‚die tapferen Kerle in ihren Ecken.‘”
Walter Benjamins Lob, das in dem schönen, kleinen Buch des Vorwerk-8- Verlags mit abgedruckt ist, ist es zu verdanken, dass Salles „Blick” erstmals auch deutsch gelesen werden kann, und das ist gut so.
HANS-PETER KUNISCH
GEORGES SALLES: Der Blick. Aus dem Französischen von Barbara Heber- Schärer. Verlag Vorwerk 8, Berlin 2001. 128 Seiten. 19 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Auf breitem Raum bespricht Henning Ritter sehr einfühlsam den bereits 1939 erschienen Essay von Georges Salles, der sich mit dem Blick des Kunstliebhabers jenseits der Kunstwissenschaft auf die Kunst beschäftigt. Kapitel für Kapitel folgt der Rezensent den Ausführungen des französischen Autors. Er erkennt in ihnen vor allem eine "Hommage an den unreglementierten Blick" des Liebhabers und Sammlers von Kunst. Deutlich wird für Ritter die "erstaunliche Präsenz der Archäologie" in der Zeit, die der Kunst eine Fülle an neuen Formen zugänglich machte. Er preist den Essay für seine große "Intensität" und hält ihn für ein Buch über die Wahrnehmen der Kunst jenseits aller Gelehrigkeit oder Belehrung, das "nur wenige seinesgleichen hat".
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"