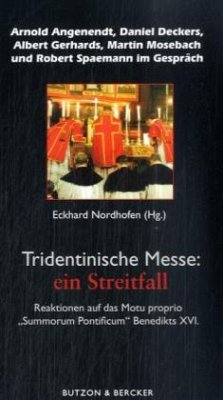Das Zweite Vatikanische Konzil, das mit PapstPaul VI. das Ende der alten römischen Liturgieanordnete, hatte einen revolutionärenKulturbruch zur Folge. Als Benedikt XVI. mitder Veröffentlichung seines Motu proprioSummorum Pontificium die lateinische Messenach tridentinischem Ritus im Jahre 2007rehabilitierte, schlug dies in der Öffentlichkeithohe Wellen. Dieser Band dokumentiertdie spannenende Debatte, die der SchriftstellerMartin Mosebach mit dem christlichen PhilosophenRobert Spaemann, dem KirchenhistorikerArnold Angenendt und dem LiturgiewissenschaftlerAlbert Gerhards über die InterventionBenedikts XVI. und den neu entfachtenStreitfall "Lateinische Messe" führte.

Traditionsbildung gehört zum Kerngeschäft des Katholizismus. Wie man zwischen Bruch und Kontinuität laviert, zeigt die Debatte um die Liturgie.
Der Katholizismus fasziniert auch als Evolutionstheorie. Hier entwickelt sich nichts Neues, das nicht als Ausfluss der Tradition dargestellt werden kann. Der Bruch mit dem Überlieferten mag mit Händen zu greifen sein - man nehme das Beispiel der Religionsfreiheit, die im Katholizismus erst seit fünfzig Jahren amtlich ist -, er wird gleichwohl nicht als Bruch, sondern als Akt der Kontinuität dargestellt, um theologisch Bestand zu haben. Das Neue muss sich als etwas herausstellen, das im Alten bereits angelegt war - anderenfalls hätte sich die Theologie in eine Sackgasse der Evolution manövriert. Mit anderen Worten: Entwicklung in Lehre und Ritus ist nur denkbar als eine Vertiefung, als ein besseres Verständnis dessen, was früher galt. Deshalb lautet das Entwicklungsgesetz im Katholizismus: Revolution durch Interpretation.
Das Verfahren hat große und kleine Geister herausgefordert, es hat glänzende Überlegungen hervorgebracht, Engführungen und tragische Selbstmissverständnisse. In jedem Fall ist es ein unfallgefährdetes Verfahren, wie die Subkultur der Pius-Bruderschaft illustriert. Deren äußeres Kennzeichen ist die Pflege des alten römischen Ritus - die tridentinische Messe -, und schon die Debatte um diesen Ritus fasziniert, wenn man sie als Debatte über Mechanismen der Traditionsbildung liest. Wie hier Argumente und Pseudoargumente in Stellung gebracht werden, zeigte eine Frankfurter Diskussion zwischen Anhängern und Kritikern der alten, als "ausserordentliche Form des römischen Ritus" wieder rehabilitierten Liturgie. Konkret geht es um die Frage, wie das Römische Messbuch in der Ausgabe von 1962 (vulgo: "vorkonziliare Liturgie") sich mit der Ausgabe von 1970 ("nachkonziliare Liturgie") verträgt. Ein von Eckhard Nordhofen herausgegebenes Bändchen dokumentiert diese Diskussion, bei der der Philosoph Robert Spaemann, der Schriftsteller Martin Mosebach sowie die Liturgiewissenschaftler Arnold Angenendt und Albert Gerhards sich gegenübersaßen.
"Es ist zutiefst unvernünftig, seinen Seelenfrieden für den Kampf um die Liturgie aufs Spiel zu setzen", erklärt Angenendt zu Beginn und widerspricht damit der Ansicht, der alte Ritus sei vom Himmel gefallen. Er sei vielmehr ein historisch gewordener und darum prinzipiell auch wieder veränderbar, jedenfalls als solcher nicht der Zeit enthoben. Versteht man Angenendt richtig, wendet er sich damit gegen einen überzogenen Stellenwert von Liturgie im Gefüge der Religion, gegen die Verdinglichung Gottes im Ritus, die einer frommen Art des Unglaubens gleichkommt.
Angenendt macht darauf aufmerksam, dass die Liturgie nicht mit dem Messbuch von Trient begann, auf das sich die Traditionalisten wie auf eine Bibel berufen. Wie die römische Liturgie am Anfang ausgesehen habe, wisse man nicht. Im dritten Jahrhundert sei das Hochgebet der Messe noch improvisiert worden: "Es liegt nicht fest; das muss man nicht auswenig lernen, da kommt's gar nicht auf Wörter an, die so und nicht anders gesprochen werden müssen. Der Priester, der Bischof kann das jeweis selbst frei formulieren." In der Urchristenheit sei "diese Art von Wortgenauigkeit" noch gar nicht angestrebt worden.
Demgegenüber erklärt Mosebach: Liturgie ist nur als formelhaftes Geschehen denkbar. Er tendiert dazu, den Ritus mit dem religiösen Mythos schlechterdings zur Deckung zu bringen. Insofern hält er daran fest, dass "ich den Ritus als etwas von mir nicht Beeinflusstes, von mir nicht Gemachtes erleben (muss)". Das wiederum ist aber, wie an Mosebachs Argumention ablesbar, nur um den Preis einer im Ergebnis ahistorischen Einstellung möglich. Nur jemand, der sich weigert, eine Liturgiegeschichte zur Hand zu nehmen, wird die Liturgie als etwas Ungemachtes, vom Himmel Gefallenes ansehen können. Ohnehin scheint der Fluchtpunkt der ahistorischen Argumentation ein (lediglich) religionspsychologischer zu sein.
So lässt sich auch die Einlassung Robert Spaemanns verstehen: "Wenn die erlaubten Varianten (der Liturgie) zu zahlreich sind, dann kapituliert der normale Gläubige . . . Und dann hört man überhaupt nicht mehr hin." Es geht also darum, dass der normale Gläubige hinhört. Aber bedarf es dazu der Illusion, die Liturgie sei etwas nicht Gemachtes? Selbstverständlich sei sie "gemacht", antwortet Angenendt, der daran festhält, dass die Einsicht in die Historizität und Wandelbarkeit des Ritus seinen metaphysischen Gehalt überhaupt nicht berührt, zumal im Christentum nicht, wo Gott eine geschichtliche Existenz angenommen, mithin sich an endliche, veränderliche Formen gebunden hat. Der "normale Gläubige" Spaemanns wird wohl oder übel durch allen Variantenreichtum hindurch hinhören müssen, statt eine Variante zur allein vernehmbaren zu erklären. Jedenfalls reicht Schwerhörigkeit, reichen religionspsychologische Bedürfnisse als Kriterium der Wahrheitsfindung nicht aus.
Umso verstörender, wenn der Eindruck entsteht, die Verfechter der tridentinischen Messe machten mit religionspsychologischer Attitüde aus der Ritusfrage eine Wahrheitsfrage. In diesem Sinne scheinen sie einem Positivismus der Formel zu frönen nach dem Motto: Wo sich in der Theologiegeschichte Formeln etablieren, da erst wird Rechtgläubigkeit möglich, ja Glaube überhaupt: "Eigentlich", so Mosebach, "ist das Christuserlebnis, die Begegnung mit einem Christus, der nicht ich bin, sondern der ein anderer ist, erst jetzt möglich, indem ich mich der Formel unterwerfe."
Solcher Glaube an die Formel gehorcht dem Prinzip: Die fitteste Lehre setzt sich im Schlachtfeld der Häresien schließlich als "überlieferte und feste Formel" durch, sie ist unmittelbar zu Gott. Mit diesem darwinistisch getönten Formeloptimismus pariert Mosebach den Hinweis auf das Gewordensein der tridentinischen Messe: "Natürlich hat die junge Kirche nicht angefangen mit dem Messbuch von Trient", räumt der Schriftsteller ein. "Natürlich nicht. Natürlich sind diese Dinge gewachsen. Aber warum wurden aus Improvisation Formeln? Weil diese frühe Christenheit eben ein grauenvolles Schlachtfeld der Häresien war. Gnostische Gruppierungen dringen hier ein, die den Glauben umformulieren und sich charismatisch gebärden. Das war für die Kirche eine ungeheuer harte Zeit, in der man kaum fassen kann, dass sie bei der Fülle von wahnhaften Sekten nicht zerfällt. Wo sie wirklich zusammenbleibt und dieses Sektierertum überwindet, da kommt das Bedürfnis nach der Formel auf." Abgesehen davon, dass auch Wahn und Sekte ihre Formeln haben, muss die Voraussetzung, die hier behauptet wird, doch gerade noch bewiesen werden. Oder hält es Mosebach mit der Kohlschen Wahrheitstheorie: Entscheidend ist, was hinten rauskommt?
Robert Spaemann gibt in der Diskussion eine Anekdote preis, die geeignet ist, die Zufälligkeit dessen, was sich als Formel durchsetzt, zu unterstreichen, indem er auch so etwas Subjektives wie die persönlichen Vorlieben der Päpste ins Spiel bringt. Im Unterschied zu Benedikt sei Johannes Paul II. der tridentinischen Messe gegenüber deutlich reservierter eingestellt gewesen, stellt Spaemann fest. Johannes Paul II. habe die Ansicht vertreten: "Man muss diesen Leuten, die am alten Ritus hängen, die Möglichkeit geben, mit ihm zu leben. Er hat es mir selber gegenüber einmal beklagt, dass viele Bischöfe (diesbezüglich) nicht großzügig sind, wie er das erbeten hat. Aber er hat mir in einem privaten Gespräch auch gesagt, dass er selbst eigentlich nicht versteht, warum wir daran so hängen. Er sagte: ,Unser großes Problem ist doch die Krise des Glaubens.' Ich konnte nur antworten: ,Heiliger Vater, vielleicht hängen die beiden Dinge zusammen.' Genau das", fährt Spaemann fort, "war immer die Überzeugung des jetzigen Papstes, für den es sich hier nicht um pastorale Fürsorge für Fußkranke handelt, die man nun einmal nicht zu den neuen Formen bekehren kann. Er spricht vielmehr von einem Schatz der Kirche."
Am Ende sind sich die Redner einig: Solange es bei der Traditionsbildung auch auf das Für und Wider von Argumenten ankommt, ist der Katholizismus jede Feier wert.
CHRISTIAN GEYER
"Tridentinische Messe: ein Streitfall". Reaktionen auf das Moto proprio "Summorum Pontificium" Benedikts XVI. Herausgegeben von Eckhard Nordhofen. Butzon & Bercker Verlag, Kevelaer 2008. 144 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Den auf eine Frankfurter Diskussion zurückgehenden, von Eckhard Nordhofen herausgegebenen Band empfindet Christian Geyer ganz offenbar als Dokument eines erfrischenden Schlagabtauschs zu einem aktuellen Thema. Vor- oder nachkonziliare Liturgie?, lautet die Frage, die der Philosoph Robert Spaemann, der Schriftsteller Martin Mosebach und der Liturgiewissenschaftler Arnold Angenendt diskutieren. Geyer formuliert die Positionen der Diskutanten, die sich für den rituellen Charakter der Messe stark machen (Mosebach), die Zufälligkeit ebendieses Ritus' zu bedenken geben (Spaemann) beziehungsweise die Bedeutung der Liturgie insgesamt in Frage stellen (Angenendt). Wenn die drei Redner sich am Ende einig sind, dass Traditionsbildung (im Katholizismus) als Ergebnis eines argumentativen Für und Wider jedenfalls in Ordnung geht, freut sich auch der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH