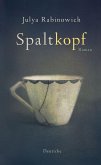In seinem beeindruckenden Debütroman erzählt Peter Truschner auf schonungslose und bildkräftige Weise vom Heranwachsen in der Hölle der Provinz - eine Geschichte vom Weg ins Freie, die die "Knoten der Erinnerung" nicht zerschlägt, sondern sie in einer teils drastischen, teils zarten Sprache auflöst. Schlangenkind - viel mehr als eine Talentprobe, ein erster, großer Roman.

Kein Erbe Leberts: Peter Truschners ungehobeltes Paradies
Ein junger Österreicher, der seinen ersten Roman mit der Schilderung seines Kindheitsdorfes und des dort ansässigen ländlich-furchterregenden Personals beginnt? Und das im Jahr 2001? Das klingt so altbekannt wie anachronistisch. Denn wenn auch, mit einem spöttischen Wort des Germanisten Wendelin Schmidt-Dengler, der "Reiz der Frage" nach den Besonderheiten der österreichischen Literatur seit jeher "wesentlich in der Gereiztheit der Disputanten" lag, so ist die österreichische Literatur nach 1945 trotzdem vor allem für eines weithin bekannt geworden: für die gnadenlose literarische Attacke auf die Provinz, für die Schilderung der physischen und psychischen Brutalität einer immer allzu engen Heimat.
"Anti-Heimat-Literatur" hat man mit Recht genannt, was bei Hans Lebert und Gerhard Fritsch begann, sich fortsetzte bei Innerhofer und Wolfgruber, seinen unerreichten Höhepunkt fand bei Thomas Bernhard und woraus der schwer zugängliche, die Heimathölle besessen exorzierende Josef Winkler als letzte, späte Blüte bis heute seine literarische Energie bezieht.
Auf dieses bereits hinlänglich bestellte Feld begibt sich nun scheinbar Peter Truschner, ein unerwarteter Enkel aus einem längst für unfruchtbar gehaltenen Stamm. Doch läßt er einem wenig Zeit, sich über die ländliche Umgebung, über das übliche Kärntner Dorf zu ärgern, in das man da ungewollt aufs neue hineingerät, denn flugs überwältigt er einen mit seiner kräftigen Sprache: "Eines Tages war das Leben auf meinen Großvater herabgefallen wie ein Tropfen Harz auf eine Fliege. Wer ihn kannte, schwor, daß er sich im Harz bewegte, als wäre nichts weiter geschehen." Peripher beginnt Truschner eine Kindheit zu erzählen, vom Großvater her, der in der Folge nicht wichtiger ist als eben ein zufälliger Großvater, doch tut er das mit derselben liebevollen Genauigkeit und analytischen Schärfe wie bei den anderen, für das "Ich", das Kind, bedeutsameren Personen. So entstehen überaus plastische Porträts bei gleichzeitig beeindruckender ironischer Distanz. Der Großvater also, das ist einer, der den Besitz verspielt, der raucht und säuft und im unappetitlichsten Wirtshaus-Zustand das Kind nächtens aus dem Bett der Großmutter vertreibt, wenn er versucht, sich einmal mehr über seine Frau zu werfen.
Die Großmutter dagegen, eine typische alte Bäuerin, der ganzen Familie unterworfen bis zur totalen Selbstaufgabe, ist die erste große, instinktive Liebe dieses Kindes. Truschner beschreibt diese Beziehung auf mutige und souveräne Weise vom Körper her - dem alternden Körper der Großmutter, einer in manchem abstoßenden, doch jederzeit verläßlichen Heimat: "die Gerüche, die wir absondern, wenn wir nach dem Mittagessen in Löffelstellung auf der Polsterbank liegen, uns dann umarmen, ich mit meiner Nase in deiner Achselhöhle, am Rande deines fleischigen, mit einem Mückenschwarm von Sommersprossen gesprenkelten Oberarms".
Vor allem in den ersten, kraftvoll-bildmächtig auf dem Dorf spielenden Kapiteln lassen sich die beiden wichtigsten und interessantesten Eigenschaften dieses Buches erkennen. Erstens: "Schlangenkind" gehört, wie es die Jugend des Autors letztlich gebietet, keineswegs zur typisch österreichischen Anti-Heimat-Literatur. Denn es macht die Provinz nicht zum Tatort, zu einem Ort des Schreckens und auch nicht zum Schuldigen an den eigenen Neurosen. Truschner scheut sich zwar nicht, deutlich zu werden, wenn es um das Grausame und Abstoßende, um das Gewalttätige und das Körperliche geht, dennoch bleibt sein kärntnerisches "Poppichl" ein ungehobeltes Paradies, jenes Paradies, das man so zwangsläufig verliert wie die Kindheit. Zweitens: Truschners größtes und überraschendes Talent ist seine Sprache - doch gleichzeitig bringt gerade diese Begabung ihn ständig in Gefahr, überzulaufen, sich zu verschätzen, danebenzugreifen. In manchen Passagen erinnert Truschner an einen Opernsänger, der so lange Koloraturen geübt hat, bis sie ihm auch an den falschen Stellen geschmäcklerisch passieren: "Die Stationen ihres Lebenswegs erscheinen mir so lückenlos aneinandergereiht wie die Perlen an ihrem Rosenkranz" - "Seine Augen hafteten an Traudis nacktem Unterleib, als wären sie die dazugehörige Unterhose". Ein Computersuchprogramm, das bloß das Wörtchen "wie" aufspürt und dann die Hälfte der vom Autor überbordend verwendeten Vergleiche im Text eliminiert, hätte geholfen.
Trotzdem: Hier kann einer wahrlich schreiben, und er riskiert dabei alles, eben auch den einen oder anderen Fehlgriff. Beeindruckend kraft- und kunstvoll sind etwa jene Szenen, in denen Großvater und Mutter ihre traditionellen Auseinandersetzungen aufführen wie ein hundertmal gespieltes Bühnenstück. Es ist das uralte Kräftemessen zwischen einem naturwüchsig autoritären Vater und der weitaus gebildeteren Tochter, die im Streit dennoch immer unterliegt, weil sie von ebenjenem väterlichen Denksystem, das sie wütend besiegen will, von klein auf geschult und abgerichtet wurde.
"Schlangenkind" ist in vieler Hinsicht ein erstaunliches Debüt. Anders als manche Autoren der jungen deutschen Literatur, die sich sprachlich auf einen trocken-distanzierten, eher auf Rhythmik denn auf plastischen Ausdruck bedachten Stil zurückziehen, schreibt Truschner barock und risikoreich wie lange keiner mehr. Distanz und Klugheit bewahrt er dennoch: auf der nächsten Ebene nämlich, in der Erzähler-Haltung zu den Figuren einerseits, andrerseits mit einer höchst ökonomischen Dramaturgie der Szenen und Dialoge, die nie zu lang geraten, den Leser im Gegenteil manchmal heilsam hungrig lassen. Truschner, Jahrgang 1967, hat in "Schlangenkind" dennoch genau dasselbe Problem wie viele seiner Altersgenossen: Ihm fehlt noch ein Stoff, der diesen Namen verdient. Wäre er ein junger Maler, würde man ihm fürs kreative Modellzeichnen, für die kräftigen talentierten Skizzen seiner Kindheit nur die besten Noten geben. Der Strich, der Stil stimmen schon genau, das eigene Thema, die runde ganze Geschichte, die so aufregend ist wie seine Sprache, kommt hoffentlich noch.
EVA MENASSE
Peter Truschner: "Schlangenkind". Roman. Zsolnay Verlag, Wien und München 2001. 175 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Eva Menasse ist tief beeindruckt von diesem Debütroman, obwohl sie zunächst darauf hinweist, dass das Feld der österreichischen Kindheitsbeschreibungen ja wohl zur Genüge beackert worden sein dürfte. Doch dieser Roman ist anders als die typische "Anti-Heimat-Literatur" und deshalb auch gar nicht anachronistisch, schwärmt die Rezensentin. Sie spricht dem österreichischen Autor ein herausragendes Talent zu und zeigt sich vor allem von seiner kraftvollen, bildreichen Sprache begeistert. Doch sie räumt ein, dass der Bilderreichtum auch seine Risiken birgt. Ein Computerprogramm, das die Hälfte der plakativen Vergleiche aus dem Text herausgenommen hätte, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. In ihrer Begeisterung lässt sich die Rezensentin davon aber nicht bremsen, denn diese Hypertrophie an Bildern, die nicht immer ganz gelungen sind, wird ihrer Ansicht nach durch die "analytische Schärfe" und die ironische Erzählerdistanz allemal wieder aufgewogen. Was sie allerdings schade findet ist, dass der Autor noch nicht den Stoff gefunden hat, an dem er sein Talent auch richtig beweisen kann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Peter Truschner fügt dem Leben seine unverwechselbare Poesie hinzu. Die Art, wie er erzählt, hat mich gefangen genommen."
Peter Turrini
Peter Turrini