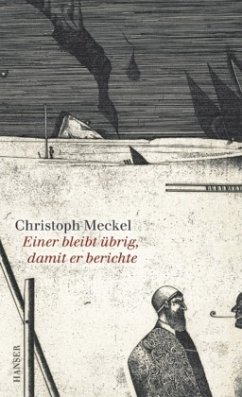Wie erlebt das Individuum die Konfrontation mit seinem Zeitalter? Christoph Meckel zeigt anhand eines genau komponierten Zyklus Schauplätze einer Zeit, die überall ihre Trümmerstätten hinterlassen hat: Kasernen, die Regierungsinsel einer Diktatur, ein Monument in der Wüste - und immer wieder stellt er diesen Orten den Einzelnen gegenüber, um sich seiner Ausgangsfrage zu nähern.

Allgegenwärtig ist der Krieg: Christoph Meckels meisterhafte Erzählungen über den Ursprung des Weltunglücks
Weltunglück geistert durch den Nachmittag": Von Christoph Meckel selbst wissen wir, daß sich die Zeile Trakls schon früh bei ihm festgesetzt hat. Ursprünglich bezeichnete sie ihm, ein leiser, "fast lautloser Ursprung", die "infernalische Gewalt des Lärms", der sich niemand mehr entziehen könne. Auch die Erzählungen aus dem letzten Jahrzehnt, die Meckel zu einem eindrucksvollen Band zusammengeschlossen hat, entspringen vielfältigen Varianten des "Weltunglücks". Dessen auffälligste Erscheinungsform aber ist nunmehr der Müll, der Schrott in jeglicher Form. Er ist allgegenwärtig.
"Schlammfang" heißt die erste dieser Erzählungen, und der Titel ist Programm: "verdeutschung von cloaca" erklärt Grimms Wörterbuch dazu. Als habe ein großes Zerbersten stattgefunden, sind die Schauplätze mit Schlamm und Müll bedeckt, mit Schutt und Trümmerfeldern, mit "Dreck und Verfaulung, Rost und Schrott", mit "Schlamm, Brühe, Morast bis ans Ende der sichtbaren Welt", mit Gebirgen aus Müll, mit "Schrott en gros". Wahre Müllkaskaden und Katarakte von Negationen setzt Meckel in Bewegung. Seine Landschaften gleichen Müllkippen, die nach großen Orgien des Demolierens übrigbleiben und ins Wesenlose übergehen. "Abraum" heißt eine andere Geschichte, und sie beginnt, irgendwo in Afrika, mit dem Job eines Söldnertrupps, der "ein Dreihundert-Meter-Quadrat Ordures aus zehn Jahren" wegzuschaffen hat, einen Berg von Müll, der einen ganzen Bahnhof samt Menschen und einen Zug mit Schlachtvieh unter sich begraben hat. Und dieser Job ist nur ein Anfang. Die Welt ist zu einem einzigen "Abraum" geworden. Wieder Grimms Wörterbuch dazu: "locus vacuefactus. bergmännisch, alles was wegzuräumen ist, bevor man zu dem erz gelangt". Kein Abräumen freilich kommt gegen den Abraum an.
Denn vor allem sind es die Toten, die in den Trümmern der Welt liegen. "Die Toten liegen in der Welt herum. Wo immer ich bin - ein Toter ist vor mir dort." Doch gilt nicht nur, gut expressionistisch, die Devise "Jedem seine Ophelia". Meist erscheint der Tod im Plural, sind da die Toten afrikanischer oder balkanischer Bürgerkriege, Hingerichtete, Erschossene, die Foltertoten von Diktatoren, die Gifttoten im Umkreis höllischer Deponien.
Die Berichterstatter Meckels berichten aus Orten, die "wesenlos" gemacht wurden. Da ist die verlassene russische Garnison, einst belebt vom Geist einer mehrtausendköpfigen Armee, die auf riesigen Manövergeländen "das Sterben der westlichen Welt" exerzierte, jetzt eine entleerte, zerschossene, hundertfach vernichtete Unterwelt, eine einzige "Leerstelle", ein "Terrain für nichts", tot, "bis unter die Erde verdorben". Oder da ist eine finnische Meereslandschaft, die sich entleert, aus der man flieht, seit der atomare Müll, der vor vierzig Jahren versenkt wurde, den Weg ins Freie sucht - "Halbtoteninseln, wohin man blickt". Manchmal begibt sich der Erzähler gleich ins Zentrum des Schreckens, in die Ruine eines Präsidentenpalastes beispielsweise ("Papa Plomb" heißt sein Erbauer), einen "Politkadaver", der von Aufständischen mit allen erdenklichen Mitteln in Schutt und Asche gelegt wird und erst so sein Geheimnis preisgibt, die Kasematten, die "private Folterkammer", in die der Berichtende absteigt. Gleich zweimal wird von einem Koloß erzählt, der geradezu eine Verkörperung des Weltunglücks darstellt - schade nur, daß Meckel den Einfall gleich verdoppelt und damit schwächt.
"Neinsein" heißt eine schöne Prägung von Meckel. Die unsentimentale und pathosferne Schilderung der vernichteten, ins absolute "Neinsein" gestürzten Orte macht die Stärke seines Erzählens aus. Sie entwickeln einen Sog des Verneinens und Verödens, der nun auch die Berichterstatter erfaßt. "Nichts geschieht", wie eine Kette durchzieht diese Formel, stellvertretend für einen wahren Furor von Negationen, die Erzählungen.
Meckels Erzähler versuchen unterzutauchen, sind Flüchtige, einsame Fremdlinge, gesellen sich manchmal gezwungen zu den Tätern, entkommen Anschlägen, ziehen sich ins Hinterland zurück. Nachdem sie ihre Nicht-Orte ausgekostet haben, verschwinden sie, gewissermaßen im letzten Augenblick, bevor sie das Nichts verschluckt hat. Manchmal scheinen sich mit ihnen Geschichten anzuspinnen, dann treten regelmäßig Frauen in Erscheinung, aber diese Geschichten und ihre kleinen humanen Gesten bleiben blaß und kommen nie zur Entfaltung. Nein, hier geht es nicht um den Widerstand von Einzelgängern, Neinsagern, Revoltierenden, schon gar nicht um das abenteuernde Vagabundieren von poètes maudits. Die "Menschheitsdämmerung" ist da, doch der Expressionismus hat abgedankt. Man hört keine Klagen oder Anklagen, die Erzähler operieren am Rande des Erstickens, im Entzug aller Zeit, "im ausgetrockneten Herzen der Zeit"; sie sind Übriggebliebene, Irrläufer. Ihre Repräsentanz gewinnen sie in der Preisgabe ihrer Individualität, als pure Berichterstatter.
Nur einmal, in der Erzählung "Nachtmantel", gewinnt die Geschichte eines Sterbenden ein eigenes Profil - sie endet in B.C., Meckels Chiffre für Babylon City oder auch Berlin. Sonst haben das Wort nicht die ausgelaugten Personen und ihr Innenleben, vielmehr die Landschaften im Stadium des Seinsentzuges, moderne Höllenterrains, die den Gedanken an Dante nicht zurückhalten.
Und das "Herz der Finsternis"? Allgegenwärtig ist der Krieg, afrikanisch oder asiatisch oder europäisch instrumentiert, Bürgerkrieg, Söldnerkrieg, Diktatorenkrieg. Konkrete Namen fehlen, Chiffren und geographische Details liefern immerhin die einschlägigen Assoziationsräume - "Weltunglück" im ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert. Meckel bevorzugt die Randzonen, in denen sich die Vernichtung bereits ausgetobt und abgelagert hat. Manchmal aber traut er sich an den Ursprung des Entsetzens heran, und dann kommt doch wieder sein expressionistisches Erbe zum Vorschein. So geschieht es in der außerordentlichen Erzählung "Aura". Ein professioneller Fotoreporter berichtet von der Sprengung eines ungeheuerlichen Kolosses irgendwo in der Wüste, an der Grenze des Iraks. Da mag man an Aktionen der Taliban oder auch an Tschernobyl denken, zugleich aber kehren Georg Heyms mythische Dämonen wieder.
Der Koloß ist ohne Geschichte, ohne Funktion, ohne Spur von Gebrauch, eine "gedunsene Mißgeburt", womöglich inhaltslos, "ein gewaltiger Witz, eine finstere Intrige ohne Substanz und Anlaß, Herz der Finsternis". Mit Dynamitschlägen und Granatenbeschuß wird er in tagelanger Anstrengung der Wüste gleichgemacht. Was dann zutage tritt, ist ein Schlund, den das Monstrum lediglich verschlossen hatte, ein "höllisches Arsenal" voller Gift. Und so drängt sich der absurde Gedanke auf: "Die Epoche, in der wir leben, war schon einmal da. Wie konnten wir ahnen oder befürchten, daß es Leute wie uns schon einmal gab - Destrukteure, Selbstschinder, Herumwirtschafter der Vernichtung, Strategen und Ausschlachter eines pauschalen Untergangs." Fassungslos räsoniert der Berichterstatter über den Ursprung des "Weltunglücks", der sich vor ihm aufgetan hat - eine mythische, doch selbstverschuldete, offenkundig manichäische Veranstaltung.
Mag auch der Koloß beseitigt sein, "Erlösung" ist nicht zu erwarten, denn "von nun an gibt es das Gift". Von der Macht solchen Giftes berichten Meckels Erzählungen, das vereint sie in einer unaufdringlichen, doch bezwingenden Logik. Mit diesem Band hat Meckel ein erzählerisches Haupt- und Meisterstück vorgelegt.
Christoph Meckel: "Einer bleibt übrig, damit er berichte". Sieben Erzählungen und ein Epilog. Hanser Verlag, München 2005. 268 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
In einer ausführlichen Besprechung des neuen Erzählungsbandes betont Helmut Böttiger zunächst den Zusammenhang zwischen dem Zeichner und Autor Christoph Meckel. Die Figuren der Texte ähneln den Figuren der Radierungen, sie "wandern in rhythmischen, suggestiven Bewegungen" durch die Geschichten, sind psychologisch nicht aufschließbar, immer wiederzuerkennen, ohne dass das je "stereotyp" würde. Auch die Meckel-Welt sei im neuen Buch der aus dem bisherigen Werk vertrauten ähnlich, wenn auch deutlicher "ins Graue verschoben", voll von Untergang, Müll, Katastrophenlandschaften. Als in gleich zwei der neuen Geschichten auftauchendes Symbol drängt ein riesiger "Koloss" sich dem Leser auf, entzieht sich aber, so Böttiger, sogleich wieder jeder eindeutigen Lesbarkeit. Besonders bewundernswert findet der Rezensent, wie es dem Autor gelingt, in jeder der Geschichten bei aller Ähnlichkeit in Anlage und Ton in seinen Variationen eine sich zusehends verdichtende Stimmung zu erzeugen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Einer bleibt übrig, damit er berichte: Christoph Meckel wird siebzig, und seine Erzählungen ziehen Schrägstriche
Christoph Meckel ätzt. Er ritzt seine Figuren wie mit einer Radiernadel aus Stahl in das Material hinein, mit harten Schraffuren, scharfkantigen Linien. Selten war die Gemeinsamkeit zwischen den Grafiken dieses Künstlers, die oft auch seine Buchumschläge zieren, und den literarischen Texten so deutlich wie in seinem jüngsten Buch: „Sieben Erzählungen und ein Epilog” lautet der Untertitel, und man könnte sie sich fast genauso als einen Zyklus seiner Radierungen vorstellen. Die Figuren sind nie fassbar. Es sind Schrägstriche, sie wandern in rhythmischen, suggestiven Bewegungen über das Blatt, und manchmal sind sie festgehalten wie in Trance; vorübergehende, magische Momente.
Diese Erzählungen erinnern nur von fern an eine Handlung, sie zitieren so etwas eher wie nebenbei, rufen es aus einer nicht genau zu umreißenden Vergangenheit hervor. So entstehen Traumbilder, die zwischen detailgenauem Realismus und märchenhaften Visionen changieren. Gelegentlich rücken sie auch die üblichen Zeitabläufe zurecht und bringen eine neue, richtige Ordnung in sie hinein.
Hausmeister im Gelände
Das Ätzen ist ein chemischer Prozess. Und in gewisser Weise geht es in Meckels neuen Texten auch darum. Es gibt keine unberührte Natur, sondern nur Zeichen ihrer Zerstörung. Häufig befinden wir uns am Rande von Endlagerungsstätten, Abraumhalden, Giftmülldeponien. Die Erzählungen dieses Bandes scheinen immer wieder dasselbe Thema zu umkreisen, aber sie wiederholen sich nicht. Die erste Geschichte heißt „Schlammfang”, die letzte, vor dem Epilog, „Staubfang”. Die eine spielt in Mitteleuropa, die andere in Afrika, im Bann der Wüste. Doch Ort und Zeit spielen keine Rolle mehr, und was uns hier als Mitteleuropa begegnet, könnte zugleich auch die Idee der Wüste selbst sein: Es ist ein, wohl in der ehemaligen DDR gelegenes, von der sowjetischen Besatzungsmacht aufgegebenes und sich selbst überlassenes Militärgelände, mit zahlreichen, unüberschaubaren Manöverplätzen und Kasernenanlagen. Hier wächst kein Gras mehr. Hier gibt es kilometerweise verseuchtes Gebiet, von Öl und anderen von der Armee verwendeten Schmutzstoffen durchtränkt, und die einsame Männerfigur, die hier einen surrealen Job als Hausmeister angenommen hat, geistert wie ein Zombie durch diese Ödnis.
Schon in der ersten Erzählung finden sich Teile eines gewaltigen Arsenals aus Beschreibungs-Versatzstücken, die etwas Zerstörtes beschwören, Zurückgelassenes. Für jenes zentraleuropäische Areal stellt es sich so dar: „Die Arten des Stinkens wechseln nach Ort und Zeit - Maschinenöl, Diesel, Sprit, verkokelte Pneus - Matratzen, Ziegelschutt, Chlor und Urin - ein trockner scharfer Geruch von Verfall und Mörtel - Eisenspäne, Lötstoff, Schweiß in Kleidern - Gärung von Kohl und Mais, verfaulte Kartoffeln - und ein dauernder Übelgeruch, nicht bestimmbar - Atem fleischfressender Wiederkäuer -”. Dasselbe findet sich aber auch in Afrika und in geographisch überhaupt nicht mehr dingfest zu machenden Zonen. Es nimmt jedes Mal eine neue Form an, verströmt einen anderen, spezifischen Geruch, doch es drückt immer die eine Gewissheit aus: Ein Leben existiert nicht mehr.
In zwei Geschichten variiert Meckel ein Symbol für das, was seine neue Prosa bewegt und umtreibt: Es ist das Bild vom „Koloss”. Es wirkt bereits im Text wie eine wuchtige, aber nicht ausdeutbare Graphik. In der irakischen Wüste, da, wo einst das legendäre Mesopotamien lag, die Wiege der Menschheit, ragt auf rätselhafte Weise seit Jahrtausenden etwas empor, das „Biur” genannt wird, ein gigantischer Koloss aus Stein. Der Autor verbindet Momente einer wie sorgsam nachrecherchiert wirkenden Reportage mit dem Magischen. Als der Koloss, aus islamischem Übereifer heraus, gesprengt wird, zeigt sich, dass das felserne Monstrum gar keine eigene Bedeutung hatte, sondern nur eine riesige Deponie unter sich versiegelte, „Stoffe aus Schleim, aus Flüssigkeit, aus Pulver, Substanzen aus Gas, für alle Zukunft unschädlich gemacht, sofern der BIUR sich selbst überlassen blieb”. Wie bei vielen großen Symbolen bleibt es im Dunkeln, obwohl viele Erklärungen bereitliegen: Es könnte ein Bild für Verdrängung sein, für den Abgrund der Zivilisation.
Am eindrücklichsten ist die Atmosphäre dieser Erzählungen in „Archipel” eingefangen. Die männliche Hauptfigur hat sich auf eine finnische Insel zurückgezogen. Romantik, unverfängliche Landschaftsgefühle entstehen auch hier nicht, und wie nebenbei erfahren wir, warum die Menschen die Inseln verlassen: Im Gebiet dieses Archipels wurde vor etlichen Jahren atomarer Müll versenkt, und durch Risse in den Behältern strömt Gift in das Wasser. Wir geraten mit der männlichen Figur in einen seltsamen Sog, sie fährt mit dem Motorboot durch die leeren Gegenden, ankert an Stellen, die jenseits von Raum und Zeit eigene Inseln zu bergen scheinen - eine schwarze Poesie, in der Leerstelle zwischen endgültiger Zerstörung und einem in sich ruhenden, von den üblichen Machenschaften losgekoppelten Dasein. Wie in jeder dieser Erzählungen taucht irgendwann eine einzelne, unbestimmbare Frau auf, die eine solitäre Existenz führt. Es kommt jedes Mal zu einer fremden, intensiven Begegnung, und die Figuren lösen sich so schnell und organisch wieder voneinander, wie sie sich getroffen haben.
Besucher im schwarzen Loch
In allen Geschichten erkennt man die männliche Hauptfigur sofort wieder. Das könnte stereotyp anmuten, da es keine differenzierte Psychologie, keine voneinander zu unterscheidenden Charakteristiken gibt - doch es geht um eine Stimmung, die sich durch die einzelnen Protagonisten hindurch immer mehr verdichtet. Fast unkenntlich kehren die vagabundierenden, frei umherschweifenden Figuren der frühen Erzählungen Meckels wieder, die Lust der frühen Gedichte, das Leben als ein schier endloser Reigen von einzelnen, unwiederholbaren, unverbundenen Momenten, die in den frühen Texten Glücksmomente waren.
Im Erzählungsband des am morgigen Sonntag siebzig Jahre alt werdenden Autors scheint dies ins Graue verschoben. Das Unbeschwerte von früher, das genussvoll Bindungslose spielt sich jetzt in einem Raum ab, der aus schwarzen Löchern besteht. Es sind Szenen nach einer Katastrophe, die nie im Mittelpunkt steht, aber umso heftiger empfunden wird. Wie das Poetische unter diesem Zeichen weiterexistieren könnte, hat der Autor in einem „Epilog” in ein Bild zu fassen versucht: Eine „reine”, märchenhafte weibliche Figur behält ihre Unantastbarkeit und ihre Würde, während um sie verheerende Kriegswirren herrschen und alle Abgründe des Menschlichen sichtbar werden.
Manchmal merkt man in den Geschichten zuvor, dass sie von einem irritierenden Licht erfasst werden - es scheint von diesem Epilog auszugehen.
HELMUT BÖTTIGER
CHRISTOPH MECKEL: Einer bleibt übrig, damit er berichte. Hanser Verlag, München 2005. 263 Seiten, 19,90 Euro.
Vagabund jenseits der Katastrophen: Christoph Meckel.
Foto: Jürgen Bauer
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
"Meisterhafte Erzählungen. Mit diesem Band hat Meckel ein erzählerisches Haupt- und Meisterstück vorgelegt."
Hans-Jürgen Schings, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.03.05
Hans-Jürgen Schings, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.03.05