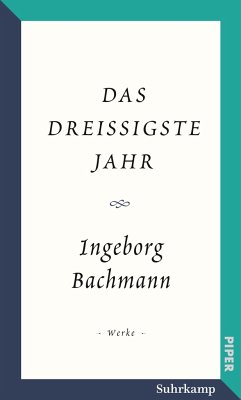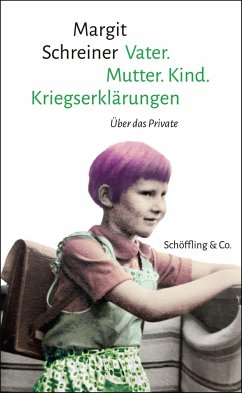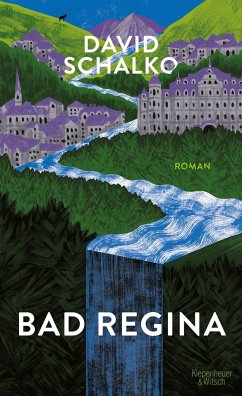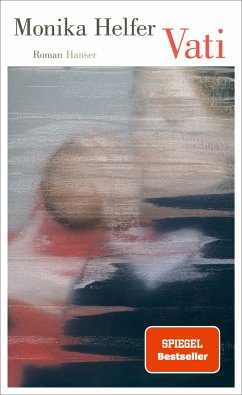Schlaganfall noch zwei Jahre als sprechunfähiger Vollpflegefall im Dämmerzustand verbrachte und nun mitteilen darf: "Das Sterben war mir, verglichen mit meinem Leben, leichter gefallen, als ich gedacht hatte."
Ein Frauenleben zieht vorbei. Allerdings bricht Schreiner die Chronologie auf. Darstellungen der leidenden Greisin, der sich die Welt immer mehr verengt, bis sie kaum noch den Weg ins Badezimmer schafft, wechseln mit Schilderungen des Kleinkinds, das seine ersten Quadratmeter Leben erobert. So schweift das Buch durch die Lebensalter, kaum bemüht um eine Stringenz, wie sie der programmatische Titel erwarten lassen könnte. Auch die Erzählhaltung wechselt nach Belieben. Mal klingt das "Wir" nach einem alle Geistesmenschen einschließenden Kollektivsubjekt à la Thomas Bernhard, mal das "Du" nach dem Kind, das noch kein "Ich" ausgebildet hat, mal das "Ich" nach Margit Schreiner und niemandem sonst. Versteht sich, daß die Moribunde mit dem Lautsprecher über dem Bett nicht dieselbe sein kann, die von ihren Schulaufsätzen als Vorstufen zur Schreibexistenz spricht.
Eindrucksvoll schildert Schreiner das Ende der Kindheit, das den ersten Desillusionierungsschub mit sich bringt. Plötzlich ist dem Leben die Poesie ausgetrieben, funktioniert die alles umwandelnde Phantasie nicht mehr. Vorher konnte ein Wohnzimmerteppich ein wogendes Meer sein, das Sofa ein Schiff, und man spielte Ozeanüberquerung. Nun ist alles nur noch, was es ist: "Der Teppich blieb der Teppich." Die Enttäuschung geht aber noch weiter: "Der Teppich wurde nicht nur zu keinem Meer mehr, sondern er wurde zu einem häßlichen abgetretenen Teppich mit einem häßlichen Blumenmuster." Auch der Vater ist nun kein "Fürst" mehr, sondern ein kleiner Angestellter. Ernüchterung auf der ganzen Linie.
Das erwachsene Leben: ein kontinuierliches Absterben von Möglichkeiten. Wenn wir wirklich wollten, denken wir mit Dreißig, könnten wir, statt ein Leben als Büroangestellter zu fristen, auch in Australien Schafe züchten. Noch zehn Jahre, und wir verstehen, daß wir keine Wahl haben, vielleicht nie hatten. Das Alter schließlich wird beschrieben als allmähliches Verschwinden aus der Wirklichkeit. Die Greisin täuscht ein Leben in der "Realität" vor, um die eigenen Kinder nicht zu beunruhigen. Und alle haben sich darauf geeinigt, Zuversicht vorzutäuschen.
Margit Schreiner liebt die Zuspitzung. Aufsässigkeit zeichnet auch noch die betagte Ich-Erzählerin aus, wenn sie der Abschiebung ins Altersheim trotzt - dort verpasse man nur den rechten Augenblick des Sterbens. Zuvor gab es eine Urszene der Renitenz: Auf fünfundzwanzig Seiten wird geschildert, wie die Einjährige während des Mittagsschlafs der Mutter munter durch die Wohnung robbt, eine Spur der Verwüstung hinterlassend. Auf die Mutter kommt ein böses Erwachen zu. Überhaupt kommt das "Mütterliche" bei Schreiner schlecht weg. Schon das Neugeborene beklagt sich über fürsorgliche Zudringlichkeit: "In deinen zum Schreien geöffneten Mund steckt eine Frau ihre Brust, unaufgefordert. Es ist einer der entsetzlichsten Vorgänge, die du bis jetzt kennengelernt hast. Du fragst dich, wer ihr eigentlich das Recht dazu gibt. Ihre Brust ist ein großer, wabbeliger, schwabbeliger, gummiartiger Ball."
Ganz abgesehen davon, daß die Erzählperspektive hier vielleicht doch ein wenig zu elaboriert daherkommt - als fundamentale "Enttäuschung" will der von Mutter Natur konzipierte Vorgang nicht einleuchten. Da macht sich eher eine Aversion gegen gewisse Formen der Weiblichkeit geltend. Im Gegenzug ist in Schreiners Prosa eine latente Sympathie mit den männlichen Gestalten zu spüren. Bereits frühere Bücher wie "Haus, Frauen, Sex" - die vom Bier befeuerte Suada eines sitzengelassenen Mannes - sind bei allem vordergründigen Entlarvungsfeminismus um erzählerische Gerechtigkeit und Geschlechterproporz bemüht: Die Argumentationsmuster und Klischees des Geschlechterkampfs sind ziemlich vollständig versammelt. Alles, was Frauen und Männer sich gegenseitig so an die Köpfe werfen, wenn die Gäste gegangen sind.
"Buch der Enttäuschungen" - das klingt nach routiniertem Lamento und pflichtschuldiger Depression. Wer aber von der Enttäuschung sprechen will, muß auch von der Erwartung und vom Glücksverlangen reden. Muß einen lichten Horizont der Hoffnung erzeugen, auf daß er sich verdüstere. Wirkliche Bücher der "Enttäuschung" sind deshalb oft besonders vitale Bücher. Mit matter Misanthropie ist es jedenfalls nicht getan. Und sie ist auch nicht Schreiners Fall. Schmerzvolle wechseln mit komödienhaften Passagen. Für Zustände der Beglückung sorgen euphorisierende Wald- und Wiesenerlebnisse: die Natur mit ihren Farben, die das Auge laben. Und dann stimmt Schreiner sogar, kontrapunktisch zum Enttäuschungsgeschehen, ein kleines Loblied auf die Liebe an - "der komplexeste Zustand, den wir erreichen können. So viele Fäden verknüpfen wir nur hier. Deshalb durchschauen wir ja auch meistens unsere Liebeswahl nicht. Zu viele Verbindungen, zu viele Bezüge, zu viele Fäden, als daß wir sie entwirren könnten."
Und die Schrecken des Alters, der Verfall zu Lebzeiten? Auch in diesem Zusammenhang hat Schreiner überraschenden Trost parat: "Je hinfälliger der Körper im Alter wird, desto funktionsfähiger wird der Geist." Wie bitte? Hat die Autorin mit "Nackte Väter" nicht einen krassen Bericht vom Alzheimer-Elend ihres Vaters gegeben? Gemeint ist hier eine neue Klarheit im Verständnis der Lebenszusammenhänge, ein Wissen darüber, was uns gut- oder eben nicht guttut, ganz im Sinne einer existentiellen Diätetik, wie sie auch Thomas Bernhard zur Lebenskunst stilisierte.
Gut tut jedenfalls dieses von der Tragik und Komik des Lebens gleichermaßen durchdrungene, angenehm unberechenbare Buch. Die Autorin hat damit ihr bisher poetischstes Werk vorgelegt.
WOLFGANG SCHNEIDER
Margit Schreiner: "Buch der Enttäuschungen". Schöffling Verlag, Frankfurt am Main 2005. 174 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
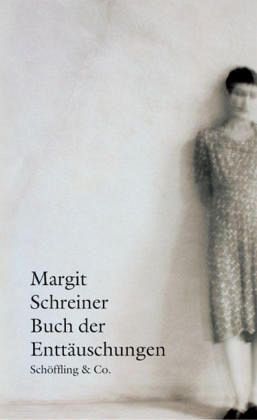





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2006