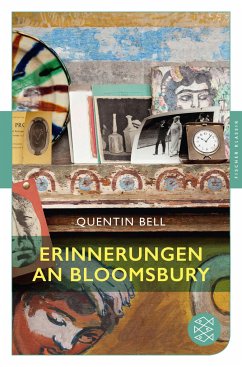Der legendäre Bloomsbury-Kreis von Künstlern und Literaten um die Schwestern Virginia Woolf und Vanessa Bell, geschildert von einem, der darin aufgewachsen ist: dem Sohn von Virginia Woolfs Schwester. Aus der Innensicht entwirft er in sechzehn biographischen Porträts eine ganze Welt.
»Ein heiteres, charmantes Buch.« Janet Malcolm, The New York Times
»Ein heiteres, charmantes Buch.« Janet Malcolm, The New York Times

Zwei, die fast alles konnten: Roger Fry und Quentin Bell · Von Ulrich Raulff
An den Ideenfeuerchen, die Intellektuelle und Lebenskünstler um 1900 entzündeten, wärmen sich bis heute die Epigonen der Lebensreform. Auch der Name des Londoner Stadtviertels, das im Schatten der Elektronikshops von Tottenham Court Road einen schmutzigen Schlaf schläft, weckt Assoziationen an die Zeit, als Kunst und Leben einander zu befreien versprachen. Bloomsbury - der Name verspricht alle Schauer der Romantik, die Knospe und das Grab, aber auch den etwas flotteren Garten Eden; später hat man seine Adepten die "Bloomsberries" genannt, eine ziemlich wilde und stachlige Art Beeren. Aber anders als Schwabing und Ascona ist dieser Inselgarten nicht versackt in politischen Räuschen und Kleinbürgeranarchie. In London wurde alles zu Literatur, gleichgültig ob Leben, Libido oder Ökonomie, es wurde zu einigen großen Kapiteln Literatur und zu einem kleinen, aber hübschen Kapitel Malerei.
Daß es nach zwei, drei Jahrzehnten Grabesruhe Ende der sechziger Jahre wiederauferstand, verdankte Bloomsbury nicht allein dem Geist von "Swingin' London", sondern auch den ironischen Schilderungen der Welt von einst, vor allem der großen Biographie von Virginia Woolf, die ihr Neffe Quentin Bell 1972 veröffentlichte. Mit "Virginia Woolf", damals als großer Wurf, als Akt der Denkmalspflege und der Demystifizierung in einem gefeiert, war der Lebensstil von Bloomsbury als Gegenstand der Scholarentinte etabliert. Quentin Bell fuhr fort, das Andenken Bloomsburys zu hüten, als Schriftsteller aber schienen ihn die einstigen Kreise nicht mehr zu beschäftigen. Erst ein Jahr vor seinem Tod, 1995, trat er wie ein alter Gärtner, kulleräugig lächelnd hinterm Tolstoibart, aus dem literarischen Treibhaus, in seinen Händen eine späte Hybridzüchtung aus Autobiographie und biographischen Essays, "Portraits in miniature", wie sein Beinaheonkel Lytton Strachey gesagt hätte. Als "Erinnerungen an Bloomsbury" sind diese letzten Seiten jetzt auf deutsch erschienen.
Man findet nicht leicht ein weniger spannendes Buch über die Welt der Bloomsberries. Dem Kenner bietet es wenig Neues, und wer von dem ganzen verschrobenen Verein noch nie gehört hat, mag sich bei des alten Bell Abendgeläute fragen, was an diesem Kränzchen so aufregend gewesen sein soll. Seine "Erinnerungen an Bloomsbury" verdichten sich nicht zu Bildern, wie sie Strachey gelangen, von John Aubrey ganz zu schweigen. Selbst die autobiographischen Seiten flattern wie alte Hemden auf der Leine. Wie anders haben wir doch die Lektüre der Jugenderinnerungen ("Freundliche Täuschungen") von Angelica Garnett, Quentin Bells Schwester, in Erinnerung. Oder täuscht uns das Gedächtnis? Auch die "Virginia Woolf" von 1972 erscheint dem zerstreut Blätternden von heute als ein wenig inspiriertes Werk: Vanitas, vanitas, denkt man, auch Bücher werden nicht jünger.
Der Gerechtigkeit halber sei vermerkt, daß unter all den Anekdoten und Erinnerungsbildern, die Quentin Bell unfertig oder schlecht erzählt verschenkt, gelegentlich auch eine Scherbe ist, die Licht einfängt. Wie etwa die von dem verstaubten Grammophon, das er mit acht oder neun Jahren in einem Winkel von Charleston entdeckte: "Ich wußte, daß man eine Nadel brauchte, und es war keine vorhanden, doch da war ich bereits entschlossen, das Ding zum Laufen zu bringen. Ich nahm ein Taschenmesser und ging aufs Feld vor dem Haus. Dort fand ich einen Schwarzdornstrauch, von dem ich einen Zweig abschnitt; er lieferte mir mehrere Nadeln. Ich zog den Apparat auf. In Charleston gab es keine Musiker und keine Musikinstrumente. Was ich hörte, war daher ganz wider jegliche Erwartung, gespenstisch leise, aber ganz klar und rein. Heute weiß ich, daß es eine Partita von Bach war, aber damals konnte ich diese Musik nicht benennen. Sie rührte mich zu Tränen."
Leider sind solche Passagen die Ausnahme. Ausgerechnet Quentin Bell, der wie kein anderer der Jüngeren die Ströme der Literatur und der bildenden Kunst, die das englische Eden der Moderne umflossen, in einer Person zu sammeln schien - Quentin Bell verweigert uns das erhoffte Lokal- und Epochenkolorit. Alle anderen frühen und späten Bloomsberries waren Literaten wie Virginia und Lytton, oder sie waren Maler wie Vanessa und Duncan (sofern sie nicht, drittens, Theoretiker waren). Einen, der wie Quentin Bell das Beste zweier Welten in sich vereinigte, die Talente des Schreibers und des Malers, des Kritikers und des schöpferischen Künstlers, hatte es unter den Älteren nur einmal gegeben: in Gestalt von Roger Fry. Und da Fry nicht nur ein vielseitig Begabter, ein im Zeichen Saturns geborener Phantast und Melancholiker, sondern auch ein wunderbarer Freund und Lehrer, ein großer Plauderer und Verzauberer war - ist es da ein Wunder, daß Quentin Bell, gefragt, wen aus dem Himmel über Bloomsbury er am liebsten wiedersehen würde, seinen Namen nannte?
Wer war Roger Fry? Bevor man sich an einer Antwort versucht, sollte man die Biographie zur Hand nehmen, die ihm Virginia Woolf gewidmet hat. Es ist das letzte vollständige Buch aus ihrer Feder und die einzige "wirkliche" Biographie, die sie geschrieben hat - so als habe sie einmal wissen wollen, wie es ist, wenn man eine Person im Text wiedererfindet, die sich schon einmal jenseits der Texte selbst erfunden hat. "Roger Fry" ist keines ihrer "großen" Bücher, nicht einmal ein ausgeprägt "modernes" Werk. Und doch scheint die Biographie ein geheimes Ziel ihres Schreibens zu bezeichnen, das nach so vielen hochmögenden Versuchen in der Chronistendemut seinen unerwarteten Endpunkt fand. "Roger Fry", so schrieb sie, stelle "ein Experiment in Selbst-Ausschaltung" dar.
Da die bei Fischer erscheinende Virginia-Woolf-Ausgabe auf den "Roger Fry" verzichtet, greift man dankbar zu der von Diane F. Gillespie kritisch edierten und kommentierten englischen Ausgabe. Aber auch der Autor Roger Fry ist wieder zu besichtigen: Der von Christopher Reed besorgte, intelligent kommentierte "Roger Fry Reader" versammelt eine Vielzahl entlegen gedruckter und vielfach vergessener Texte des wichtigsten englischen Kunstkritikers unseres Jahrhunderts. Zwei Dinge fallen bei ihrer Lektüre besonders ins Auge: die rasche Wiedergewinnung der für einen Augenblick außer Kraft gesetzten Tradition - und die nie abreißende Verbindung der Kunst von Bloomsbury zu den dekorativen Künsten und zum Handwerk. In der behenden Eleganz der Rückwendung auf die eben erst scheinbar erledigte Tradition war Roger Fry einem Picasso ebenbürtig: Derselbe Mann, der in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg die "Post-Impressionisten" in England eingeführt und als "moderne Menschen auf der Suche nach einer der modernen Sensibilität angemessenen Bildsprache" gefeiert hatte, rief 1924 angesichts der französischen Maler aus: "Und wie traditionell sie sind! Ich nehme an, daß Rubens in Matisse seinen Enkel erkennen würde, ebenso wie Matisse seine Erbschaft anerkennen sollte, und daß Fra Bartolomeo unmittelbar verstanden hätte, was Picasso wollte . . ."
Um die Nähe der "reinen" Kunst Bloomsburys zu den dekorativen Künsten zu spüren, braucht man nur einen Text wie den über den Künstler als Verzierer ("The Artist as Decorator", 1917) zu lesen: Auf der Stelle begreift man, wieso Roger Fry, der Kritiker der hohen Kunst, keinen Augenblick lang bereit war, sich von seinem Alter ego, dem Möbel- und Tapetenfabrikanten, dem "Omega"-Gründer Roger Fry unterscheiden zu lassen. Noch da, wo ihre Blüten in die reine Luft der Abstraktion strebten, blieb die Kunst von Bloomsbury durch kräftige Wurzeln mit dem Boden der dekorativen Künste verbunden. Auch Roger Frys Rücken war nicht breit genug, um die Gestalt William Morris' im Hintergrund ganz zu verdecken.
Wer gute Ohren hat, der kann zuweilen das Weltgetriebe knirschen hören. Um 1910 oder 1912 mußte man schon stocktaub sein, um die Geräusche zu überhören, unter denen sich ein Zeitenbruch ankündigte. Virginia Woolf jedenfalls konnte später, im Jahr 1924, genau sagen, wann sich in England die Tür zur Moderne geöffnet hatte: Im Dezember 1910, schrieb sie, habe sich die menschliche Natur verändert. Dabei war das Ereignis, das damals ins Räderwerk der menschlichen Existenz griff, auf den ersten Blick so unbedeutend, daß viele Geschichtsbücher es bis heute verschweigen. Was war schon eine Kunstausstellung in einer Londoner Galerie gegen die sozialen Kämpfe jener Zeit, gegen den Durchzug des Halleyschen Kometen oder den Tod des Königs Edward?
Da es indes nicht irgendwelche Künstler waren, die gezeigt wurden, sondern die bedeutendsten französischen "Postimpressionisten", wie Fry sie kurzerhand getauft hatte, darunter Cézanne, van Gogh, Gauguin, Matisse, Derain und Picasso; da ihre Zurschaustellung die stärkste Wirkung auf die englische Öffentlichkeit hatte und ein heftiges, teils wütendes Presseecho fand; da sie die Lebens- und Arbeitsweise einiger Maler und Schriftsteller beträchtlich verändern sollte, ja, Bloomsbury in gewisser Weise überhaupt erst erschaffte - darum ist es vielleicht nur wenig übertrieben, mit Virginia zu sagen, die Ausstellung in der Grafton Gallery sei ein Wendepunkt der Geschichte gewesen. Und sicher ist es auch nur wenig übertrieben, die Ereignisse des Jahres 1910 ins Zentrum eines an die dreihundert Seiten langen Buches zu stellen.
Peter Stansky ist dieses Risiko eingegangen. Sein Buch über das junge Bloomsbury schneidet aus dem Jahrhundertbaum die Scheibe des Jahres 1910 heraus. Umständlich beschreibt Stansky, wie Frys Postimpressionisten-Ausstellung zustande kam und wie sie aufgenommen wurde, wie die Reaktionen des Publikums und der Kritik waren, wer sie bekämpfte und wer sie verteidigte. Daß diese dicke Baumkuchenschnitte saftig bleibt und philologisch nicht verholzt, liegt an den locker eingebauten Teilbiographien Virginias und der beiden Bells, vor allem aber Roger Frys.
Für Fry brachte das Jahr 1910 den entscheidenden Wendepunkt seines Lebens, zwar nicht den erhofften Durchbruch als Maler (der nie gelang), wohl aber den als Kritiker und führender Theoretiker der Moderne. Nach schwierigen Jahren in England und Amerika erschien Fry die jetzt anbrechende Zeit wie ein zweiter Morgen. Clive Bell zielte höher und ins Allgemeine, als er von einer "neuen Renaissance" sprach. Auch das war allenfalls leicht übertrieben. In Bloomsbury, schreibt Stansky, begann die Moderne bei den Malern. Es wurde ein hübsches, kleines Kapitel. Und dabei wäre es geblieben, hätte es Virginia Woolf nicht gegeben. Mit ihr erst änderte sich wirklich die Natur, nicht unbedingt die der Menschen, doch die der Kunst.
Quentin Bell: "Erinnerungen an Bloomsbury". Aus dem Englischen übersetzt von Claudia Wenner. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1997. 287 S., geb., 39,80 DM.
Christopher Reed: "A Roger Fry Reader". Chicago University Press, Chicago und London 1996. 440 S. geb., 50,- Dollar.
Peter Stansky: "On or About December 1910. Early Bloomsbury and Its Intimate World". Harvard University Press, Cambridge/Mass. und London 1996. 289 S., Abb., br., 27,95 Dollar.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main