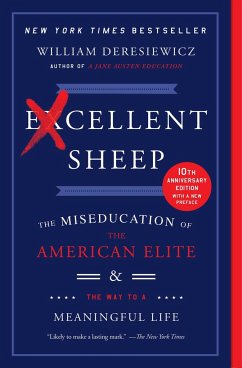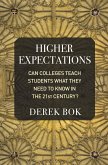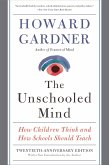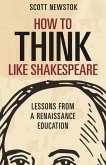Ein amerikanischer Literaturprofessor zieht mit einer provokanten These durch die Lande: Amerikas Eliteunis züchten beschränkte Konformisten heran.
Von Lisa Herzog
Man reibt sich verwundert die Augen, was der ehemalige Yale-Professor William Deresiewicz den amerikanischen Eliteuniversitäten da ins Buch schreibt. Statt aufgeklärter Bürgerinnen und Bürger würden sie "exzellente Schafe" produzieren, schreibt er in seinem gleichnamigen Buch, traurige, innerlich leere Konformisten. Statt sich im Selber-Denken zu üben, begegneten die Studenten im Punkte-Sammel-Wahn kaum einem Kursinhalt mit tiefergehendem Interesse.
Deresiewicz, ein stilsicherer Polemiker, beschreibt die Studenten amerikanischer Eliteunis als Zirkustierchen, die durch jeden ihnen vorgehaltenen Reifen hüpfen ("hoop-jumping"), weil sie durch den nervenaufreibenden Prozess, der sie überhaupt erst dorthin gebracht hat, darauf konditioniert wurden. Mit seiner These wendet sich Deresiewicz vor allem gegen Kollegen wie Yale-Professorin und "Tiger Mom" Amy Chua, die in ihrem Buch "Die Mutter des Erfolgs" vor drei Jahren unter anderem empfahl, Eltern sollten ihren Kindern drohen, deren Kuscheltiere zu verbrennen, sie sich nicht ihren Erwartungen fügten.
Deresiewicz' These stieß auf viel Resonanz: Die Artikel, die seinem Buch vorangingen, waren vor allem im Internet Hits. Gerade Studenten klickten sie vielfach an und verschickten sie an ihre Freunde. Er erhielt eine Flut von Briefen und E-Mails.
Jetzt zieht Deresiewicz in Amerika mit seiner Botschaft von Campus zu Campus. An der Stanford University sprach er im Herbst vor einem dicht mit Studierenden, Eltern, und Besuchern des heranziehenden Alumni-Wochenendes besetzten Auditorium. Dass diejenigen, über die er schreibt, ihm so aufmerksam zuhören, deutet an, dass er jenseits aller Polemik und trotz der teils groben Verallgemeinerung den Finger in eine Wunde gelegt hat. Es bringt aber auch erste Kratzer in das Bild unreflektierter Selbstgefälligkeit, das er zeichnet.
An der Debatte, die Deresiewicz' Thesen in Amerika ausgelöst haben, fallen vor allem zwei Dinge auf: das Bildungsideal, das Deresiewicz vorschwebt - und die Gründe, an denen das Ideal seiner Ansicht nach scheitert. Der Literaturprofessor hält mit wortgewaltiger Vehemenz an einem Bildungsideal fest, das wie aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Es ist der alte Ansatz der "liberal arts"-Erziehung, die zum Denken erziehen soll, zum kritischen Hinterfragen vorgegebener Werte und Ideale. Die Studenten sollen ihr eigenes Selbst finden oder auch erfinden, sie sollen zu republikanischen Bürgerinnen und Bürgern geformt werden. Nur wer seinen eigenen Charakter geformt und seine eigenen Werte entwickelt hat, so die dahinterstehende Prämisse, kann auch ein gelingendes Leben führen, nach Maßstäben, die er oder sie selbst gewählt hat. In Zeiten, wo sich schon Studenten immer stärker spezialisieren und Politiker und Arbeitgeber vor allem fordern, mehr junge Leute müssten mathematische oder naturwissenschaftliche Fächer studieren oder gleich Ingenieure werden, ist das eine ungewöhnliche Perspektive.
Deresiewicz gibt dabei offen zu, dass diejenigen, die aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus die Aussicht auf bessere Verdienstchancen in den Mittelpunkt ihrer universitären Ausbildung stellen müssen, nicht sein Zielpublikum sind. Ihm geht es um diejenigen, die es sich leisten können, weniger pragmatisch an das Studium heranzugehen. In der heutigen Zeit ist der eigentliche Luxus, so seine Botschaft, sich Zeit nehmen zu können für die wichtigen Fragen des Lebens, und in der Phase zwischen Schulabschluss und Berufseinstieg den eigenen Horizont erweitern zu können, jenseits aller Überlegungen zur späteren Verwertbarkeit. Deresiewicz setzt dabei vor allem auf die "big books" und das klassische Seminarformat. Es gehört allerdings schon viel Optimismus dazu, anzunehmen, wie er es tut, dass Diskussionen über die Charaktere von Jane Austen oder James Joyce automatisch zu Selbsterkenntnis und Selbstfindung führen.
Das amerikanische Bachelorstudium ist im Prinzip wunderbar geeignet, um solche Bildungserlebnisse zu ermöglichen. Denn es ist viel weniger als Berufsausbildung konzipiert als das Studium in den meisten anderen Ländern. Wer Arzt, Jurist oder Wissenschaftler werden möchte, beginnt erst im Anschluss ein mehrjähriges Aufbaustudium. Den "undergraduates" erlaubt das System der "Majors", einen fachlichen Schwerpunkt zu wählen. Gleichzeitig können sie dank vieler Wahlmöglichkeiten zahlreiche Themenfelder erkunden: Von Kammermusik bis zum "Volunteering" in der lokalen Suppenküche kann alles mögliche als Studienleistung angerechnet werden. Das Angenehme lässt sich also gut mit dem Nützlichen verbinden.
Der zweite interessante Aspekt der Debatte jedoch ist, dass Deresiewicz darüber schreibt, wie diese Form von Bildung scheitert. Und es ist gerade nicht das Scheitern, das ausgelöst würde durch mangelnden Zugang zu Universitäten überhaupt, durch unterfinanzierte Fakultäten oder die Unmöglichkeit persönlicher Betreuung durch chronisch überlastetes Lehrpersonal. Im Gegenteil: seine "exzellenten Schafe" sind die privilegiertesten der Privilegierten, angekommen an der Spitze eines Bildungssystems, über dessen Ungleichheiten sich viel sagen ließe. Aber gerade der Kampf darum, zu dieser Spitze zu gehören, kann eine Mentalität schaffen, die einer tiefergehenden Charakterbildung an der Universität entgegensteht.
Nach Deresiewicz' Analyse tragen dazu eine Reihe von Mechanismen bei. Da ist zum einen der irrwitzige Hürdenlauf, der nötig ist, damit der eigene Lebenslauf vor den Auswahlkomitees der Eliteuniversitäten Aussichten auf Erfolg hat: Er erfordert nicht nur gute Noten, sondern auch noch ein möglichst breites Repertoire an sogenannten "extracurricular activities", also Engagement jenseits des Stundenplans. Durch dieses Auswahlsystem ist die Studentenschaft der Eliteunis relativ homogen; das macht es unwahrscheinlich, an der Universität Menschen aus völlig anderen Lebenslagen kennenzulernen. Und nicht zuletzt ist da das Campusleben, in einer Welt für sich, mit eigenen Länden, Restaurants, Sporteinrichtungen bis hin zur eigenen Polizei. Die Tage sind ausgefüllt mit Kursen, aber auch mit anderen Aktivitäten, die oft in strukturierten Programmen auf dem Campus stattfinden. Die Studenten leben in Gemeinschaftsunterkünften, in denen das Beobachten und Beobachtet-Werden Züge eines foucaultschen Panoptikums annehmen kann.
Und so darf man sich denn Deresiewicz' "exzellente Schafe" keineswegs als glückliche Menschen vorstellen. Die Zahl der Möglichkeiten ist riesig, damit aber auch der Druck, dem Lebenslauf weitere Zeilen hinzuzufügen. Die Angst, nicht mithalten zu können, befördert das Sammeln von Leistungsausweisen, die den eigenen Wert demonstrieren sollen, und dabei vom intrinsischen Wert von Aktivitäten oder Einsichten trefflich ablenken können. Die Muße, einem Gedankengang aus einer Vorlesung bei einem Spaziergang länger nachhängen zu können - nein, der nächste Kurs ruft. Eine nächtliche Diskussion über philosophische oder politische Fragen? Keine Zeit, eine Übungsaufgabe muss fertig werden. Die psychologischen Probleme unter Studenten haben in den letzten Jahren massiv zugenommen, so sehr, dass Dozenten ausdrücklich aufgefordert werden, bei wiederholter Abwesenheit nachzuhaken - und notfalls den psychologischen Dienst zu alarmieren.
Man kann sich fragen, ob Universitäten überhaupt jemals in der Lage waren oder sind, Studenten die umfassende Charakterbildung anzubieten, die Deresiewicz vorschwebt. Falls ja, ist die Frage, ob ein umfassend institutionalisiertes, streng durchgetaktetes Campusleben dafür das geeignete Modell ist, zumal, wenn die "Kunden" der Universitäten letztlich reiche Eltern und reiche Alumni - also potentielle Spender - sind und die Namen der Universitäten als Punkte im Kampf um Status und soziale Anerkennung dienen.
Und so spielen denn auch die Statusängste der oberen Mittelschicht eine wichtige Rolle in Deresiewicz' Analyse, gemeinsam mit einem zunehmend globalisierten Wettbewerb um die Arbeitsplätze, die als erstrebenswert gelten. Er ist nicht der Erste, der die zunehmende Fokussierung von Eliteabsolventen auf die Unternehmensberatungen und Banken moniert, die besonders gut darin sind, mit den nächsten "Goldsternchen" im Lebenslauf zu locken - ohne dass diese Allokation von Humankapital gesamtgesellschaftlich sinnvoll wäre, oder auch nur die scheinbaren Gewinner glücklich machen würde.
Es wäre zu einfach, nur auf die zersetzende Kraft des "Marktes" als Ursache des Problems zu verweisen, zumindest wenn damit nur der privatwirtschaftliche Charakter vieler amerikanischer Universitäten gemeint ist. Dieser allein ist nicht das Problem; Deresiewicz kritisiert vor allem den Fetisch der diversen Rankings, denen sich die Universitäten regelmäßig unterwerfen. Und er hinterfragt die allzu menschliche Tendenz, sich mit anderen zu vergleichen, und das Bedürfnis, sich des eigenen Wertes zu versichern, indem man messbare Leistungen erbringt. Denn messbar sind eben nur die Reifen, durch die man gesprungen ist. Charakterbildung aber geht über die messbaren Faktoren hinaus. Wer sich nur auf das konzentriert, was sich nach außen darstellen lässt, verpasst möglicherweise das Beste, was ein Universitätsstudium bieten kann.
Damit hat Deresiewicz' Essay eine - möglicherweise unfreiwillige - egalitäre Pointe: Die Dinge, um die es bei einer universitären Bildung wirklich geht, sind nicht an große Namen gebunden. Sie dürften überhaupt einen sehr viel flüchtigeren Charakter haben, als seine Schilderungen nahelegen. In eine Seminardebatte so richtig hineingesaugt werden, an herausfordernden wöchentlichen Aufgaben wachsen, sich an einer Frage so sehr festfressen, dass ihre Antwort existentielle Bedeutung annimmt, Menschen treffen, mit denen tiefe intellektuelle Freundschaften entstehen: All dies lässt sich nicht erzwingen. Es sind Glücksfälle, die man vielleicht oft erst im Nachhinein als solche erkennt. Sie lassen sich nicht herbeizaubern, es lassen sich höchstens Umstände schaffen, in denen sie mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Ein hochgezüchteter, von unterschwelligen Status-Kämpfen zerfressener Elite-Campus mag nicht die optimale Voraussetzung dafür sein; ein verschultes, an einer unterfinanzierten Massenuniversität stattfindendes Bachelorstudium auch nicht. Doch finden kann man sie an beiden Orten.
Trotzdem mutet es seltsam an, dass neben dem Drama der hochgezüchteten Kinder ehrgeiziger Eltern, das Deresiewicz so wortreich beschreibt, andere bei ihm relativ kurz kommen: das Drama all derjenigen, die viel schlechtere Chancen im Leben haben, weil zu viele Arbeitgeber die Absolventen berühmter Universitäten automatisch oben auf den Stapel der Bewerbungen legen. Und das Drama derjenigen, die von den hohen Studiengebühren abgeschreckt werden, die in den Vereinigten Staaten üblich sind, und sich überhaupt nicht an ein Universitätsstudium wagen. Auch die Debatte, ob eine College-Ausbildung ihr Geld wert ist, wird dort längst geführt. Dabei gebietet es der Geist jener "liberal arts education", die Deresiewicz beschwört, dass sie nicht die Spielwiese weniger Privilegierter sein dürfen, sondern dass all diejenigen, die sich von ihm anstecken lassen, Zugangsmöglichkeiten haben müssen.
Deresiewicz' Vortrag in Stanford übrigens endete, wie er enden musste: In der Fragerunde stand ein besonders eifriger Student auf und fragte, was er tun müsse, um kein "Schaf" zu sein - freundlich, arbeitswillig und bereit, auch durch diesen Reifen zu springen. Deresiewicz' feines Lächeln deutete an, dass er diese Frage nicht zum ersten Mal gehört hat.
Die Autorin ist derzeit Postdoctoral Fellow am McCoy Family Center for Ethics In Society an der Universität Stanford.
William Deresiewicz: Excellent Sheep. The Miseducation of the American Elite and the Way To A Meaningful Life. New York: Free Press, 2014.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main