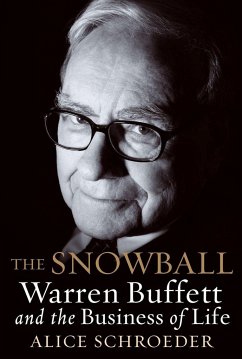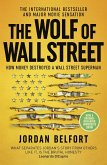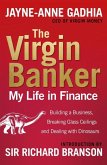Wie kann man heute noch vom Kapitalismus erzählen? So wie die Biographie des Investors Warren Buffett, das derzeit erfolgreichste Buch in den USA
In den USA ist die Biographie des Investors und derzeit reichsten Mannes der Welt Warren Buffett mit dem Titel „The Snowball” das Buch der Saison. Es ist ein Text, der einen einlässt in das rissige, verwirrende Gebäude, das der Kapitalismus ist, und das manche für einen Kerker halten und andere für einen Turm. Es ist ein Roman aus unserer Zeit und doch eine wahre Geschichte. Es hat 900 Seiten, aber anders als mit Größe, mit Wucht, mit Gewicht wird man ihm nicht Herr: diesem Monster, das manche im Kapitalismus sehen, oder diesem Menschen, der einen da vom Cover aus anschaut, mit wachen Augen und für einen sehr intelligenten Mann sehr freundlich. Die Frage, der sich dieses Buch stellt, lautet: Wie kann man heute vom Kapitalismus erzählen? Wie kann man heute eine Heldengeschichte der amerikanischen Marktwirtschaft schreiben?
Vielleicht so: Rot war der Staub, den der heiße Wind vor sich her trieb, und er schmeckte nach Armut, nach Not, nach Verzweiflung. Er klebte an den Kleidern, er färbte die Häuserwände, er setzte sich fest in den Getrieben der Automobile. Es waren die dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts, und wer in dieser Zeit in Omaha lebte, im US-Bundesstaat Nebraska, der wusste, dass Geld etwas war, das mit Stolz, Disziplin und Selbstverteidigung zu tun hatte.
Oder so: Der Junge liebte Zahlen. Er liebte seine Stoppuhr. Er sammelte leere Cola-Deckel und stapelte sie in seinem Zimmer. Er saß stundenlang auf der Veranda und schrieb die Kennzeichen der Autos auf, die vorbeifuhren. Er war ein schüchterner, introvertierter Junge, der verstanden hatte, dass Information Geld bedeutet. Und dass Geld im Grunde auch nur Information ist, eine besonders lukrative Form der Kommunikation.
Oder so: Er war geizig, unendlich geizig, so geizig, dass er sich ausrechnete, was seine Chancen waren, das Geld zu behalten, das er seinen Kindern bot, damit sie abnehmen. Denn er hasste es, wenn Menschen zu dick waren. Er war, das kann man daraus schließen, ein irgendwie unsympathischer Mensch. Aber als er viele Jahre später den größten Teil seines Vermögens, und das waren vierzig, fünfzig, sechzig Milliarden Dollar, der Stiftung von Bill Gates vermachte, den er wie einen Sohn liebte, da tat er das unter voller Verleugnung seiner selbst.
Wie also kann man am Anfang des 21. Jahrhunderts und mitten in der schlimmsten Krise seit 80 Jahren vom Kapitalismus erzählen? Indem man tief ins 20. Jahrhundert zurücksteigt und sich einen Helden sucht, der ein Antiheld ist, weil er sich weigerte, auf Ökonomen, Technologiegurus, Banker oder Börsenjongleure zu hören. Die Geschichte von Warren Buffett, des reichsten Mannes der Welt, so wie sie Alice Schroeder in ihrem Buch „The Snowball” (Bantam Books, New York, 35 Dollar) erzählt, ist deshalb auch vor allem ein Versöhnungsangebot.
Sie ist tröstlich. Sie ist einfach. Sie ist verständlich. Sie handelt von Schlüsselworten wie Zigarrenstummel und Schluckauf, um Buffetts goldenen Weg zu beschreiben. Sie ist altmodisch und darum hilfreich. Sie ist eine ausgestreckte Hand und darum gleich auf Platz eins der amerikanischen Bestsellerliste gerückt. Was die Menschen jetzt lesen wollen, ist die Geschichte eines Mannes, der reich geworden ist nicht mit Gier, sondern mit Geiz. Nicht mit Verschwendung, sondern mit Bescheidenheit. Nicht mit Jachten und Champagner, sondern mit abgewetzten Pullovern und einer Pepsi in der Hand. Was die Menschen in diesem Porträt finden, ist das Bild eines Kapitalismus mit menschlichem Antlitz.
Und Warren Buffett ist dafür die perfekte Person – ein ganz diesseitiger Prophet der schlichen Bilder und Wahrheiten, die nicht unbedingt falsch sein müssen. „Das Leben ist wie ein Schneeball”, heißt es etwa auf der Rückseite des Buches. „Wichtig ist es, feuchten Schnee zu finden und einen wirklich langen Hügel.” Der Kapitalismus also, das ist Buffetts Botschaft, als Lebenspraxis, als Lebensaufgabe, als Charakterfrage und Persönlichkeitsspiegel. Reichtum als Ergebnis einer Biographie, als Serie von Entscheidungen, Reichtum als nachvollziehbare Geschichte.
Einmal quer durch das amerikanische Jahrhundert schneidet diese Lebensgeschichte, als sei es ein Roman, den Upton Sinclair, Arthur Miller und Tom Wolfe gemeinsam geschrieben hätten. Von der Main Street zur Wall Street und zurück, durch Krisen, Börsen-Exzesse und die verschiedenen Blasen, die alle zerplatzten – aber immer, das ist das Geheimnis seiner einmaligen Erfolgsgeschichte, sah Buffett für sich nur Chancen. „Wenn der Markt gierig ist, sei ängstlich”, lautet eine seiner wichtigsten Anlageregeln. „Aber wenn der Markt ängstlich ist, sei gierig.”
1929 beginnt diese Geschichte, als Buffetts Vater Howard in die Krise hinein ein Anlagebüro gründete. Ein Jahr später wurde Warren geboren, der mit sechs Jahren anfing, erst Kaugummis an die Nachbarn zu verkaufen und dann Coca-Cola, der bald jeden Morgen um halb fünf aufstand, um auch noch Zeitungen auszutragen, und mit 14 Jahren seine erste Steuererklärung abgab – sieben Dollar nur, weil er seine Armbanduhr und sein Fahrrad als Geschäftskosten absetzte. In diesem Stil ging es weiter. Geld, das ist die Botschaft, ist eine Frage der Konzentration, folgt aus rationalen Entscheidungen und präzisem Denken. Geld an sich ist wertfrei, das heißt es hat keine ethische oder moralische Komponente.
Für Buffett war das alles erst einmal ein Spiel, das er beherrschen wollte, um sich etwas zu beweisen. Er wollte nie etwas anderes, als reich zu werden. Er nutzte sein Gedächtnis, seinen Willen, all das, was er, wie er sagte, in der „Gebärmutter-Lotterie” gewonnen hatte, um die erste Million zu schaffen. Aber er wusste immer und vergaß nie, dass Geld eine Fiktion ist, die an sehr reale Bedingungen geknüpft ist.
Er hasste Spekulanten, nicht unbedingt, weil sie Geld verbrannten, sondern weil sie im Grunde seine Intelligenz beleidigten. Was war so schwer daran zu verstehen, dass es auf lange Sicht Unsinn ist, auf den Kurswert eines Unternehmens zu setzen und nicht auf den wirklichen oder „intrinsischen” Wert? Was war so kompliziert daran, dass der Markt kein effizientes oder rationales Wesen ist, wie die Ökonomen behaupten, sondern dass „Mister Market”, wie sein Lehrer Ben Graham dieses Gebilde nannte, ein manisch-depressiver Typ war, auf den man sich nicht verlassen konnte?
Buffett selbst ging da anders vor. Er suchte nach den Zigarrenstummeln, die andere weggeworfen hatten, nach Unternehmen, die unter Wert gehandelt wurden, die aber noch einen letzten Zug in der Zigarre hatten. Und so saß er jeden Tag in seinem Büro in Omaha und auch am Wochenende zu Hause oder er verschwand auf Partys, die ihn langweilten, ins Nebenzimmer und durchforstete die Zeitungen und Börsenblätter, so wie er schon als Jugendlicher die Rennzeitungen auf der Pferdebahn durchforstet hatte, auf der Suche nach Informationen, nach Wissen, das er in Geld umsetzen konnte. Dort war er damals sogar nach den Rennen unter den Sitzen herumgekrochen, um die Wettscheine zu suchen, die nicht eingelöst worden waren, Hunderte, Tausende schmutzige Papiere schleppte er nach Hause und sortierte sie; und es machte ihm nichts aus, wenn schon jemand daraufgespuckt hatte.
Es sind diese einfachen Botschaften, die den Reiz und auch den Sog dieses Buches ausmachen, das eben nicht allein aus rauschhaften Erfolgsmeldungen besteht, sondern seine Wirkung entfaltet aus der möglichen Rückkoppelung mit dem eigenen Leben. Es ist diese manchmal fast naiv wirkende Klarheit, die auch sein eigenes Schreiben durchzieht, seine Essays, die er vor sieben Jahren so handlich auf 280 Seiten zusammengefasst hat, dass man gar nicht recht verstehen will, warum es so wenige Milliardäre gibt. Die Sätze sind am Motivationssingsang von Dale Carnegie geschult, den Buffett in den vierziger Jahren entdeckte. Die Ratschläge kann man eigentlich nicht ablehnen. Und Derivate, die viele für die gegenwärtige Krise mitverantwortlich machen, nennt Buffett hier wahlweise „Zeitbomben” oder „Massenvernichtungswaffen”.
Es ist also die alte Welt, die einem in dem Porträt begegnet,das Alice Schroeder in „The Snowball” von Warren Buffett zeichnet – mithilfe Buffetts übrigens, der Schroeder nicht nur zu dem Buch animierte, sondern auch für lange Interviews zur Verfügung stand. Die alte Welt allerdings nicht rückwärtsgewandt,sondern durchaus als Modell für die Zukunft. Buffett hasst Schulden und die, die Schulden machen. Er kritisierte immer schon die Exzesse, die seit den achtziger Jahren die Wall Street beherrschten und in deren Strudel er einige Male selbst geriet, etwa als er 1987 die durch einen Finanzskandal schwer angeschlagene Bank Salomon Brothers rettete. Geld an sich hat vielleicht keine ethische Komponente; aber die Art und Weise, wie man mit Geld umgeht, eben schon.
Seit 1982 hatte er sich, der seit langen Jahren die Demokraten unterstützte, immer wieder an den Kongress gewandt, um zu erreichen, dass bestimmte Teile der Börse besser überwacht und vor allem reguliert werden. Damals galt er als Einzelgänger. Heute ist das alles anders. „Kauft Aktien – wann, wenn nicht jetzt?!”, hat Buffett letzte Woche in der New York Times verkündet – und wusste, dass solche Worte das Gewicht von vormodernen Orakelsprüchen tragen. Und seit ihn sowohl Barack Obama als auch John McCain als möglichen Finanz-Superminister ins Spiel gebracht haben, ist er endgültig zum guten Gewissen der Gier-Gesellschaft aufgestiegen. Er ist damit, zusammen mit Bill Gates, seinem Partner in Philanthropie, der erste Über-Kapitalist, der seinen Geld-Ruhm in soziale Macht übersetzt hat.
„Er kein schlichter Mensch”, hat das Magazin Forbes 1969 über Buffett geschrieben, „aber er hat einen schlichten Geschmack.” Der Artikel hatte den Titel: „How Omaha Beats Wall Street”. Bershire Hathaway heißt die Firma, mit der Buffett dieser Triumph gelang und die er zu einem prosperierenden Imperium ausgebaut hat, seit er 1962 begann, Aktien der kleinen, kränkelnden Textilfabrik zu kaufen. Seine Schuhe hatten damals Löcher in den Sohlen und ein perfekter Anzug war für ihn einer, „in dem man einen 90-jährigen Banker aus einer Kleinstadt in Nebraska beerdigen könnte”.
Als Buffett einmal mit dem Sony-Boss Akio Morita in dessen New Yorker Appartement am Central Park zu Abend aß und vier Köche hinter einer Glasscheibe die wunderbarsten und meist rohen Dinge zauberten, ließ er ungerührt Teller auf Teller wieder zurück gehen. Heute spielt er stundenlang Bridge im Internet, er trinkt literweise Coca-Cola, er isst am liebsten Steak mit Bratkartoffeln im Restaurant Gorat’s in 4917 Center Street, Omaha. Mit 78 Jahren hat der Technik-skeptiker in diesem Jahr zum ersten Mal den Techno-Boy Bill Gates als reichster Mensch der Welt abgelöst. Warren Buffett ist ein einfacher Held. Er ist sein eigenes Denkmal. Er ist der Turm, der noch steht. GEORG DIEZ
Als hätten Upton Sinclair, Arthur Miller und Tom Wolfe geschrieben
Derivate nannte er „Zeitbomben” und „Massenvernichtungswaffen”
Er trinkt literweise Cola und isst Steak mit Bratkartoffeln
Warren Buffett: Ein Held so amerikanisch wie Apfelkuchen, Cola und Baseball. Foto: Paul Fusco/Magnum/Agentur Focus
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de