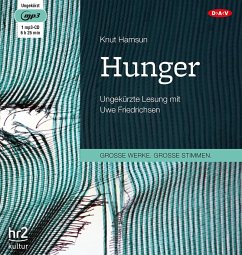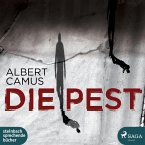In Kristiania, dem heutigen Oslo, kämpft ein junger Schriftsteller Ende des 19. Jahrhunderts um Anerkennung für seine Werke. Doch trotz großer Begabung reicht das Geld, das er verdient, kaum zum Leben. Obdachlos und halb verhungert schleppt er sich durch die Straßen der norwegischen Hauptstadt, mal voller Hoffnung, mal verzweifelt und dem Wahnsinn nahe. In seinem bahnbrechenden Roman, der literarische Größen wie Kafka und Proust beeinflusste, verarbeitet Hamsun seine persönliche Erfahrung mit Armut und Isolation. Das schonungslose Porträt eines Künstlers am Rande der Gesellschaft wird einfühlsam und eindringlich gelesen von Uwe Friedrichsen.Ungekürzte Lesung mit Uwe Friedrichsen1 mp3-CD ca. 6 h 25 min
»Keine literarische Erfahrung hat sich mir tiefer eingeprägt als Knut Hamsuns 'Hunger'.« Roger Willemsen
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Rezensent Fabian Wolff empfiehlt Ulrich Sonnenbergs Neuübersetzung von Knut Hamsuns Klassiker. Ob der Roman nun protofaschistisch ist oder nicht, sich der Unbehausheit des Menschen widmet oder schlicht dem Hunger - eine "Urfigur" des vergangenen Jahrhunderts schafft der Autor mit seinem hungernden Ich-Erzähler allemal, findet Wolff. Lesenswert findet er auch Felicitas Hoppes "kluges" Nachwort.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Man sollte diesen fulminanten Roman, den die literarische Moderne von James Joyce bis Marcel Proust gefeiert hat, jetzt wieder lesen.« Welt am Sonntag, Literarische Welt

Neu übersetzt: Hamsuns "Hunger" / Von Heinrich Detering
Mein Name sei Soundso." Alles wissen wir über den komischen Helden, der allein im Zentrum dieser Geschichte steht. Jede Seelenregung kennen wir, jeden Gedankenfetzen, jeden körperlichen Vorgang - alles, nur das Nächstliegende nicht: keine Identität, keinen Herkunftsort, keine Biographie. Den einzigen Namen, den wir erfahren, hat der polizeilich Gesuchte soeben zweckmäßig erlogen; und wenn ein einziges Mal doch sein wirklicher Name verraten wird, dann geschieht das gegenüber einer Geliebten und unter Ausschluß der Leser. Namenlos ist er auf einmal da, dieser monomanisch-monologische Held, springt auf die Bühne seiner eigenen Erzählung und rennt los durch die leicht dämonisch entstellte norwegische Hauptstadt des Jahres 1890. Ohne einmal nach Woher und Wohin zu fragen, setzt die Geschichte mit diesen rastlosen Wanderungen ein; dann tritt sie lange mit hoher Geschwindigkeit und beträchtlichem Unterhaltungswert auf der Stelle; und als es dem Helden wieder einmal zu bunt wird mit dem Hin und Her von Hunger und flüchtiger Sättigung, erotischen und beruflichen Hoffnungen und Enttäuschungen - da springt er auf ein zum Ablegen bereites Schiff, heuert rasch als Hilfsmatrose an und ist schwupp! in Richtung England aus Kristiania und aus dem Roman verschwunden, dem deshalb nichts übrigbleibt, als zu enden.
Ein ulkiger Kerl. Und was für ein erstaunlicher Schauplatz: Kristiania, das heutige Oslo, wird im vielzitierten Anfangssatz als "diese seltsame Stadt" eingeführt, "die keiner verläßt, ehe er von ihr gezeichnet worden ist". Gezeichnet! Der Ort, von dem hier die Rede ist, zählt eben 200000 Einwohner und ist allenfalls ein Küstenort am Rande Europas. Aber ob einer eine moderne Großstadt erlebt, entscheidet sich nicht an Einwohnerzahl und Straßenbeleuchtung, sondern an der Art seines Erlebens. Und wer mit diesem Ich-Erzähler Kristiania durchwandert, vom Schloß zu den Slums und vom Bahnhof zum Hafen, wird zum Augen- und Ohrenzeugen einer Metropole, die so gut die Hauptstadt des neunzehnten Jahrhunderts sein könnte wie irgendeine der anderen, in denen Edgar Allan Poe und Charles Baudelaire ebendie Spuren des Makabren und Grotesken aufgenommen hatten. Tatsächlich, einer der ersten Großstadtromane, ach was: überhaupt einer der ersten Romane der Moderne ist dieses Buch eines jungen Wilden, den es auf dem Umweg über die Vereinigten Staaten vom Polarkreis nach Kristiania verschlagen hat und der den selbstgewählten Namen Knut Hamsun trägt.
Wie im Leben, so im Buch: Ein Mann schlägt sich durch. Abgerissen im wörtlichsten Sinne, bis hin zu den Jackenknöpfen, die er in letzter Not unsinnigerweise abtrennt, um sie als letzte bewegliche Habe zu versetzen, durchleidet der einsame, auf sich selbst zurückgeworfene Vagabund, auch er übrigens ein Dichter, alle Facetten des Hungers, dem das Buch seinen lakonischen Titel verdankt. Aber nur keine Allegorie, keinen tieferen Sinne, keine Metapher! Dieser Hunger bedeutet, im Unterschied zu dem mancher deutschen Hungerpastoren, kein Verlangen nach Heil und Wahrheit und mehr Licht - dieser Hunger bedeutet Leibschmerzen und Schwindel, Schweißausbruch und Schüttelfrost, Gier nach einem Hundeknochen und die Demütigung, wenn der überforderte Leib dann die Fetzen verdorbenen Fleisches hilflos doch wieder von sich gibt.
Kein Mangel an autobiographischer Drastik also. Und dennoch kommt es dem Erzähler auf die Schilderung des Hungers selbst, die doch das ganze Buch ausmacht, gar nicht so sehr an; jede Sozialkritik gar liegt ihm vollends fern. Was er braucht, ist die Extremsituation, an der sich zeigen läßt, was so ein Mensch für ein Ding ist. Seine Neugier gilt der Frage, was eigentlich gemeint ist, wenn man "ich" sagt. Und was er sieht bei seinen so lebhaften wie sachlichen Beobachtungen an der eigenen vergangenen Person, das ist das Ich als eine Funktion des Gehirns. Zwar schläft und wacht, friert und fiebert dieser armselige Held, folgt sexuellen Begierden und wird enttäuscht, hungert und frißt und erbricht sich jämmerlich ("mal hier, mal da"), und der rückblickende Erzähler seiner selbst ist in der Schilderung dieser Vorgänge von falscher Scham ebenso frei wie von Grobheiten. Aber der Körper ist ihm in alldem doch nur der Zuträger aller Empfindungen und Entzüge, ein Instrument, das unter den höchsten Anforderungen die erstaunlichsten und differenziertesten Seelenklänge hervorbringt. Die präzise Aufzeichnung dieser Klänge ist der Roman.
Was der hitzig selbstbewußte junge Autor zur Zeit der Niederschrift auch in öffentlichen Vorträgen gegen Ibsen und die liberalen Leitbilder eines modernen Skandinavien proklamierte, erweist sich in diesem Anwendungsfall darum weniger als eine neue Psychologie denn als eine Physiologie des Seelenlebens, eine Zustandsbestimmung des Menschen in einer Welt, die an den Menschen wenig Anteil nimmt. (Das einzige Leitmotiv, das wie ein langsamer Gongschlag das turbulent stagnierende Geschehen begleitet, ist der Satz: "Und die Zeit verging.") Der physisch konkrete Hunger ist dabei nur der Katalysator einer Entwicklung, die ein nie gesehenes Menschenbild hervorbringt. Sprunghaft bis zur Lächerlichkeit, mit einer abenteuerlichen Vorliebe für grundlose Themenwechsel und unvermittelte Einfälle flattert der Held vor unseren Augen herum, ein getrieben Treibender, ein unerhört vitales Bündel aus lauter Widersprüchen. "Mein konfuses Gemüt ging mit mir durch und gab mir die verrücktesten Impulse ein", notiert er einmal und setzt hinzu: "denen ich der Reihe nach gehorchte." Dieses "der Reihe nach" ist seine Kennmarke, die lebenserhaltende Systematik in der Konfusion.
Für den Leser bedeutet diese Figur vor allem ein tragikomisches Vergnügen ohne Punkt und Komma. Von Beginn an geht ein Blitzlichtgewitter der Empfindungen, Assoziationen, berauschenden Phantastereien auf ihn nieder, und in diesem flackernden Licht enthüllen sich Innenansichten ohne Innerlichkeit - ein Seelen-Slapstick von salopper Lakonie. Ideen, von denen der Held sein "Hirn gleichsam ausgebeult" fühlt, bringen Sprachclownerien wie ebendiesen Vergleich hervor; die Gedanken hüpfen in Bocksprüngen vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Wer beispielsweise nicht umgehend in Anbetung der "himmlischen Herrlichkeit" eines Mädchens mit "Augen wie Rohseide" einstimmen will, der hält sie folglich wohl etwa "für eine Kassenbotin oder für eine von der Feuerwehr?" Wofür sonst! So ziellos wie flüchtig sinnt der philosophische Stadtstreicher Verschwörungstheorien nach, entziffert auf der Suche nach etwaigen Botschaften geheime Zeichen in den Mauerrissen und horcht vorübergehend "ohne besonderen Zweck" am Fußboden. Kaum hat er die Menschen-"Tiere" verhöhnt, denen er imponieren will, bricht er vor Rührung in Tränen aus, weil ein freundlicher Schutzmann ihm seine Hilfe anbietet; denn in Wahrheit ist der Herumtreiber ein feiner, zarter Herr, nur eben unter entwürdigenden Umständen: "inmitten all des Elends immer ehrlich geblieben, hehe, ehrlich bis auf die Knochen!" Eben noch ein verliebt schäkernder Lumpenkavalier, verfällt er unversehens in widerspenstige Wahnsinnsposen und verdirbt alles. Hat er nach unendlichen Mühen endlich den dringend notwendigen Geldschein ergattert, dann hält er inne, spielt langsam, in fassungslosem Entzücken, alle Bewegungen des Gönners pantomimisch nach und schenkt dann das Geld kurzentschlossen weg. Kaum hat er sich einmal rührselig als ein Hiob der Gosse gebärdet, kneift er sich schon ins Ohr und zappelt gleich wieder als magerer Clown durch die Nacht.
Tatsächlich hat dieser Held etwas von einer Zeichentrickfigur, die sich, nachdem sie vom Felsrand in den Abgrund gestürzt und dort vom nachfallenden Stein erschlagen worden ist, aufrappelt, kurz schüttelt und ihre Flucht entschlossen fortsetzt. Aber was wäre das für ein sonderbares Resultat der Seelenautopsie! Der besondere, einmalige Held - bloß ein komischer Akteur? Es sieht verteufelt so aus. Denn je nuancierter wir den Soundso kennenlernen und je eifriger er rückblickend von sich redet, desto mehr zerfällt er in Posen, Attitüden, Sprachspiele. So wie er dermaßen eingenommen von den eigenen Geschichten ist, daß er zwischen ihnen und sich kaum zu unterscheiden vermag, so kann er sich auch selbst dabei zusehen, wie er "anmaßend den großen Mann markiert", und daraufhin "mit mir scharf ins Gericht" gehen. Nichts macht diese Zerrissenheit verwirrender hörbar als die rapiden Tempuswechsel. Das erzählerische Präteritum versichert uns einer behaglichen Distanz, das Präsens alarmiert, und beide wechseln sich auf kleinstem Raum ab: "Ich klopfte auf die Tasche und befühle mein Manuskript." Gar nicht zu vermeiden, daß dabei schließlich auch die Eintracht des Körpers zerfällt. So wird der Blick auf die eigenen Füße für den Wanderer unerwartet zum frohen Wiedersehen: "als hätte ich einen guten Bekannten getroffen oder einen abgetrennten Teil meiner selbst zurückbekommen". Ein Sammelsurium ist dieser Held, kein Charakter und erst recht nicht dort, wo er selbst dieses Schlüsselwort einer aufgeklärten Anthropologie einmal gebraucht. Da nämlich ist er plötzlich "erfüllt von dem herrlichen Gefühl, Charakter zu haben" - nicht anders als bei anderer Gelegenheit von Liebeslust oder Sattheit.
"Und gar das Ich!" hatte zwei Jahre vor dem Auftritt dieses Sammelsuriums Friedrich Nietzsche ausgerufen: "Das ist zur Fabel geworden, zur Fiktion, zum Wortspiel." Hamsuns Ich-Geschichte nimmt diesen Satz im doppelten Sinne beim Wort. Denn was hier als "Ich" erzählt wird, ist tatsächlich eine einzige große Fabel, eine Ich-Erzählung als artistisches Wörterspiel. Gerade so aber, als Fabel eben, rettet sie das erzählte Ich doch noch vor dem drohenden Zerfall. Das ist das erstaunlichste Kunststück dieser Erzählung, der Triumph des Erzählers über seine eigene Philosophie. Sooft nämlich sein Held auf der Grenze zur Auflösung balanciert - als sein eigener Beobachter bleibt er doch immer auf dem Posten und deshalb noch im tiefsten Dreck märchenhaft unerschütterlich. "Ich hörte selbst, daß ich phantasierte", erinnert er sich einmal, "hörte es, während ich noch sprach." So, als Zuhörer, als Beobachter und schließlich als Erzähler seiner selbst, bleibt er bei Verstand und am Leben.
Freilich öffnet sich genau hier auch, unmerklich schmal noch, der erste Spalt zur ideologischen Reaktion des späteren Werks. "Schwachheit! sagte ich hart zu mir selbst, und ich ballte die Fäuste und sagte: Schwachheit." Wahrhaftig, hier flackern schon die künftigen Primärtugenden eines heroischen Vitalismus durch das Hirn dieses weichen, verletzlichen, ängstlichen Hungerleiders: Unbeugsamkeit und Härte. Noch müssen sie zwar über die Fallhöhen der Komik hinabstürzen. Immerhin als ein Auserwählter Gottes aber (der im Falle eines Mißerfolgs allerdings jederzeit zu den wildesten Blasphemien bereit ist) wandelt der Vagabund durch die bewunderte und verachtete Metropole, in der er um ein Haar vor die Hunde geht. Zwischen Größenwahn und Pfandleihkeller schwankt sein bedenklicher Weg, und daß er zwischendurch ein paar Zeilen fürs Feuilleton schreibt, macht die Sache nicht besser. Denn über die paar Zeilen kommt er selten hinaus. Keine der welterschütternden Provokationen, die er sich in seinen Fieberträumen und überwachen Nächten auf der Straße ausdenkt, schreibt er fertig - weder das Weltanschauungsdrama übers katholische Mittelalter und den Antichrist noch die Vision einer Bartholomäusnacht aus brennenden Büchern und Gehirnen, noch gar die Abhandlung "über die Verbrechen der Zukunft" (denn auch ihm, schon ihm scheint erst in der Zukunft die wahrhaft große Politik möglich). Mitleid und Zusammenbruch, Größenwahn und Obdachlosenasyl - das ist nicht nur die Lage, in der kurz zuvor sein literarischer Nachbar in Trient einen Droschkengaul umarmt und zwischen Spottlust und Jammer, Wahn- und Scharfsinn den Verstand verloren hat. Es ist auch eine Lage ähnlich jener, in der später ein nicht fertig gewordener Künstler in der Großstadt Wien den Entschluß fassen wird, Politiker zu werden, und noch später wird dann der norwegische Stadtstreicher (Nobelpreisträger inzwischen) dem österreichischen Gossenkollegen (Führer und Kriegsherr mittlerweile) zujubeln in verzücktem Starrsinn.
Das alles liegt jetzt noch in weiter Ferne, kaum in Sichtweite. Hier, im genialen Frühwerk, ist alles noch ein ungetrübtes Vergnügen. Halb Nietzsche, halb Chaplin, treibt der mißglückte Übermensch als namenloser man in the crowd durch die Gassen und Gossen. Zarathustra als Tramp: ein Anblick, gräßlich und gemein und so hinreißend, daß man nicht weggucken kann. Denn was es da zu sehen gibt, ist ja nicht nur der Hauptdarsteller selbst, sondern immer auch all das, was ihm vor die weit aufgesperrten Augen kommt. Dieser nervöse Held ist, um sein eigenes und wie immer prägnantestes Bild zu gebrauchen, ein Hirn mit Fühlhörnern. Was diese Organe ertasten, sind Wirklichkeitspartikel von überscharfer Präzision - "die Halme sträuben sich bleich der Sonne entgegen, und das gefallene Laub zischelt über die Erde mit einem Laut wie von wandernden Seidenraupen". Seine gleichbleibend gespannte Aufmerksamkeit registriert alles, was da ist. Keine Großstadtschilderung ohne vorübereilende Passanten - hier aber geht "ein Mann mit einem Paar Schuhe unter dem Arm vorbei". Je länger man das Bild anschaut, desto fremder blickt es zurück, knapp und genau und völlig bedeutungslos.
Die geplante psychologische Revolution vollzog sich also, wie man sieht, als literarische; der Umbruch von Welt-und Menschenbild war ein Sprachereignis. Das stellt denkbar hohe Ansprüche an jede Übersetzung. Die neue, die Siegfried Weibel soeben vorgelegt hat (mitsamt einem höchst instruktiven Nachwort des Bonner Skandinavisten Heiko Uecker), erscheint nach dem wilden Monsterroman "Mysterien" und der zärtlichen Schmonzette "Viktoria" in der durchweg neu übersetzten und sorgfältig kommentierten Werkausgabe, die gegen eine triste deutsche Wirkungsgeschichte den modernen Erzähler Hamsun wieder lebendig in Erinnerung bringen will. In diesem Fall ist der erste Eindruck, den der Leser von dem Ergebnis gewinnt, befremdlich. Einigermaßen verblüfft stolpert er über aufgedonnerte Formulierungen, die er von dem abgerissenen Hungerkünstler zuletzt erwartet hätte: "daß ich nirgendwo mehr als ein akzeptabler Mensch vorstellig werden konnte". Die achtbare Übersetzung von Sandmeier und Angermann aus dem Jahre 1958 hatte für diese Stelle noch die viel umgänglichere Formulierung anzubieten, daß "ich mich nirgends mehr als ein anständiger Mensch vorstellen konnte". Und so ähnlich heißt es tatsächlich auch im norwegischen Text. Befremdlich - und doch zeigt der zweite Blick, wie recht Weibel hat, wie schlau er in Hamsuns Fußspuren tritt. Denn die Schwankungsbreite in dessen Formulierungen ist ja, nimmt man den gesamten Text in den Blick, in der Tat enorm. Dem erzählten entspricht der stilistische Slapstick so genau, daß eins für das andere eintreten kann und auch Alltagsvorgänge, die für gewöhnlich nichts Erheiterndes haben, ihre elementare Komik enthüllen (oder erhalten). Er kann ja so vornehm sein, dieser Held, wenn er "in millionärischer Haltung" einherschreitet. Aber daß er nie "etwas Vergleichbaren ansichtig geworden" ist wie jener Frau, die er gerade begehrt, das hindert ihn nicht, im selben Atemzug einem "unbedarften Gnom die Hucke voll lügen" zu wollen - was für Hakenschläge! Und wie geschmeidig zeichnet die Übersetzung diese Haltungsals Tonartwechsel nach! Nicht wenige davon macht sie überhaupt zum ersten Mal für deutschsprachige Leser sicht- und hörbar. Statt des sehr berechtigten, aber keine Leser vom Hocker reißenden Ausrufs "So, nun war ich schön hereingefallen!" (mit dem sich die ältere Übersetzung noch begnügte) lesen wir jetzt das zugleich entsetzte und verblüfft-vergnügte: "Guck, jetzt war ich angeschmiert!" Die in der alten Ausgabe so bittere wie matte Klage "Herrgott, wie doch alles verkehrt ging!" lautet nun, in hamsunsch-komischer Verzweiflung: Herrgott, wie alles partout schieflaufen mußte!"
Mehr noch als überhaupt in Übersetzungsvergleichen also wäre es hier verfehlt, nur Wörter mit Wörtern, Sätze mit Sätzen zu vergleichen. Was Weibel im und mit dem Ganzen gelingt, ist die Mimikry eines Erzähltons, der so elegisch wie kratzbürstig, so hochtrabend wie demütig daherkommen kann. Den verlockend und gefährlich naheliegenden Gegenwartseffekt - als wär's eben erst geschrieben - vermeidet er gleichwohl, indem er beispielsweise mit unübersetzt belassenen Straßennamen und Ortsangaben Fremdheitssignale aufstellt. Was diese Übersetzung bietet, ist ein Hamsun der neunziger Jahre - und zwar der des letzten und der des noch andauernden Jahrhunderts gleichermaßen. Und das ist keine ganz kleine Leistung.
Da steht er nun also, dünn und herausfordernd, Hamsuns Erstling. Ein Lümmel als Klassiker und dank der Neuübersetzung so flegelhaft wie im Jahr 1890. Sie werden deshalb wohl auch weiterhin recht haben, die Kanoniker. Das Dreigestirn des modernen Romans heißt Proust, Faulkner, Joyce; dreimal ja! Aber ganz weit dahinten, dicht überm nördlichen Horizont, funkelt ein Stern erster Ordnung dazwischen, so flatterhaft, daß manche Himmelskundigen ihn zeitweise für ein Irrlicht gehalten haben. Die Weisen folgen ihm besser nicht nach, aber sein glitzerndes Licht sticht auch in ihre Augen.
Knut Hamsun: "Hunger". Roman. Aus dem Norwegischen übersetzt von Siegfried Weibel. Mit einem Nachwort von Heiko Uecker. List Verlag, München 1997. 223 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Alles ist Gemüt
Oskar Werner liest Knut Hamsuns „Hunger”
Ein Neuerer war er nicht, dem Pathos blieb er zugeneigt, dem hohen Ton und der gemessen sich an den Konsonanten abarbeitenden Stimme. Der österreichische Schauspieler Oskar Werner, der 1922 in Wien geboren wurde und 1984 auf einer Rezitationstournee in einem Hotel in Marburg an der Lahn starb, fasziniert bis heute, weil er Antirealist war und wahrhaftig zugleich. Seine Kunst hatte nichts Gekünsteltes und war doch mit jeder Faser ein Einspruch gegen die sogenannte Realität. Er wollte all das ins Wort bannen, in die sanft wienerisch eingefärbte Sprechmelodie, was im wahren Leben schnurstracks in die Verzweiflung führte. So auch hier: „Es war in jener Zeit”, hebt die Lesung an, und Werner lenkt seine tiefe, schlurfende Stimme ein wenig nach oben, setzt träumerisch und sehr effektvoll eine Pause, fährt baritonal fort, „als ich in Kristiania umherging und hungerte”.
Oskar Werner stand in seinem 38. Lebensjahr, er reüssierte am Wiener Burgtheater, als er 1961 Hamsuns monologischen Roman für den Süddeutschen Rundfunk las. Der spätere Nobelpreisträger wiederum hatte sein aufsehenerregendes Debüt 1890 veröffentlicht, im Alter von 31 Jahren. Getrennt durch zwei Generationen, treffen hier also zwei Altersgenossen aufeinander, der nervöse, hochsensible Norweger und der nach Leben hungernde Österreicher. Wäre das Wort nicht so korrumpiert, man könnte von einer Seelenverwandtschaft sprechen. Wenn Hamsuns Held, ein bettelarmer Gelegenheitsjournalist und verhinderter Dichter, hungrig durch Kristiania streicht, erlebt er jene intellektuellen Emphasen, Tagträume, Angstbilder, die dem Schauspieler nicht fremd waren: „Ein Schwarm von kleinen schädlichen Tieren hatte sich in mein Inneres gedrängt und mich ausgehöhlt.”
Fernes, tonloses Summen
Kennzeichen der vom Hunger diktierten Weltwahrnehmung ist deren Disparatheit. Euphorie und tiefste Niedergeschlagenheit, Boshaftigkeit und Trauer wechseln übergangslos einander ab. Alles ist Gemüt, nichts ist von Dauer. Vor sich selbst wird der Hungernde zum Schauspieler, um der Not eine Form zu geben. „Ich vertrug kein Essen, ich war nicht so eingerichtet; es war dies eine Sonderheit an mir, eine Eigenheit.” Werner beherrscht den Gestus der lindernden Übertreibung, ohne übertrieben zu wirken. Er wird schnell, sehr schnell, wenn die Aggressionen sich nach außen kehren, er verlangsamt das Tempo fast bis zum Stillstand, wenn die Plagegeister im Innern die Seele zermartern. Er wird laut und schreit doch nicht, er wird leise und flüstert doch kaum: „Es waren schon ein paar Tage vergangen, seit meine Miete fällig gewesen, und ich besaß nun nichts mehr, sie zu zahlen.”
Vor allem aber ist Werner hier ein Virtuose der Pausen. „Aber in der Höhe oben sauste der ewige Sang”, die Rede schweigt, „die Luft, das ferne, tonlose Summen”, nichts ist zu hören, „das niemals schweigt”. Und zwischen dem unverwechselbar kehligen „r” und dem nonchalant dahin gehauchten „t” senkt er seine Stimme am Satzende nicht, lässt im Offenen das vermeintlich Endgültige verklingen. „Ich hörte selbst mich dieses Gefasel sagen, fasste aber jedes Wort, das ich sagte, so auf, als käme es von einer anderen Person.”
So will auch der Abschied keiner sein und muss es doch. Der letzte Satz dehnt und streckt sich, und Oskar Werner fürchtet den Schlusspunkt, wird leise, krümmt die Silben, und Knut Hamsun bricht ab, weil es anders nicht geht, sagt Lebewohl zur „Stadt Kristiania, wo die Fenster so hell in allen Häusern leuchteten”. ALEXANDER KISSLER
KNUT HAMSUN: Hunger. Aus dem Norwegischen von Siegfried Weibel. Gelesen von Oskar Werner. Hörbuch Hamburg, 2009. 2 CDs, 156 Min., 19,95 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de