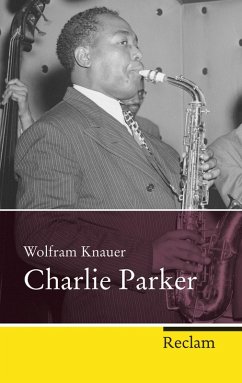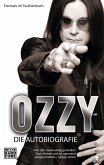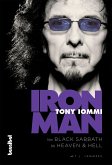Es gibt wohl keinen Jazz-Fan, der nicht ein entscheidendes Initiationserlebnis der ersten gehörten Aufnahme von Charlie Parker verdankt. Am Anfang steht meist ein tiefes Befremden über ein fast außerirdisches Tempo und die gleißende Kälte der Melodieführung, dann eine Faszination, schließlich erwacht unweigerlich der Ehrgeiz, das zu verstehen, nachzuspielen. Und dann die Trauer und das Erschrecken über ein so kurzes, so in Drogen und Depression gescheitertes Leben bei all der künstlerischen Perfektion und Virtuosität. Von dieser Spannung zwischen musikalischem Höchstniveau und einem Leben voller Abstürze erzählt Wolfram Knauer, der Leiter des renommierten Jazzinstituts in Darmstadt, in seinem Buch über den Autor der Improvisationssprache, die inzwischen der ganze Jazz spricht.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.