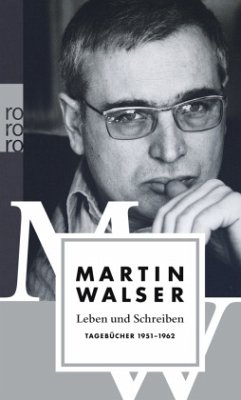«Wunderbare Tagebücher - ein zartes Gespinst aus Buchstabenmusik.» (DIE ZEIT)
Martin Walser verwandelt das Leben in Literatur. Stets werden seine Romane für autobiographisch gehalten, selten zu Recht. Wer nun seine mit Zeichnungen - «Stricheleien» - versehenen Tagebücher aufschlägt, erkennt, dass sie eher Dokumente des Schreibens als seines Lebens sind. Genau dies macht sie zu einem Kunstwerk von hohem Rang.
Martin Walser verwandelt das Leben in Literatur. Stets werden seine Romane für autobiographisch gehalten, selten zu Recht. Wer nun seine mit Zeichnungen - «Stricheleien» - versehenen Tagebücher aufschlägt, erkennt, dass sie eher Dokumente des Schreibens als seines Lebens sind. Genau dies macht sie zu einem Kunstwerk von hohem Rang.

Vom nichtsnutzigen Geschäft, dem Schreiben, das aber herrlicher ist als alles andere: „Martin Walsers Tagebücher 1963-1973”
Im Tagebuch „ist der Autor allein mit sich”, schreibt Martin Walser im Nachwort des zweiten voluminösen Bandes seiner Tagebücher. Hier fällt die Maske der öffentlichen Person ab. Hier tritt er aus Traditionen, Konventionen, Regeln heraus, folgt er keinen Weisungen, keinen äußeren Bedingungen wie in dem „für draußen Geschriebenen”. Das gilt selbst für poetische Entwürfe, die im Tagebuch oft eine andere Gestalt haben als von dem Moment an, da sie nach ,draußen‘ treten und „im Roman Dienst tun”. Walser veranschaulicht das am Beispiel Kafkas. Doch auch seine eigenen Tagebücher, in denen die kommenden Werkgestalten schwankend aus Dunst und Nebel aufsteigen, bieten dafür eine Fülle von Beispielen. Figuren tauchen auf, die wir aus seinen späteren Romanen kennen oder zu kennen glauben, Walser lässt sie walten, oder aber sie verschwinden wieder im imaginativen Dunkel, aus dem sie aufgestiegen sind.
Der Tagebuchschreiber „drückt sich als Ich, als Du, als Er aus”, so Walser. Für ihn gilt das mehr als für jeden anderen Autor. Oft können wir uns nicht ganz sicher sein, ob er persönlich spricht oder eine von ihm als Abspaltung von seiner Person gestaltete Figur, ob er selber redet oder einen anderen reden lässt – eine Eigenart seines Schreibens, die sich bis in seine Essays und Reden erstreckt, die dann prompt zu den bekannten Missverständnissen bei denen führt, die auch von einem Schriftsteller geradlinige Verlautbarung verlangen.
Das Tagebuchschreiben ist für Walser das „Unwillkürliche”, es lebt von seiner nicht redigierbaren „Hingeschriebenheit”, ist unmittelbares Organ des Lebens, des jeweiligen Existenzmoments. Das macht seine „mögliche Unschuld” aus. „Schreiben als Lebensart”, die sich keiner wie auch immer gearteten Zensur unterwerfen muss. Deshalb ist ein Tagebuch wie dieses eigentlich auch nicht rezensierbar, entzieht sich zumindest ebenso ästhetischen Werturteilen wie Schlaf-, Trink- oder Frühstücksgewohnheiten. Im Tagebuch gewinnt selbst der literarische Lebensfeind Thomas Mann für Walser die Unschuld des Schreibens zurück: „Kein bißchen die beherrschbare Manier des virtuos in allen Dimensionen tanzenden wie tänzelnden Erzählers”, sondern über Jahrzehnte hinweg der gleiche „lakonisch konstatierende Stil”.
Freilich herrscht die Unschuld des Schreibens nur in einem Tagebuch, das – wie dasjenige Goethes, Kierkegaards, Kafkas, Thomas Manns und eben Walsers – keine „literarische Gattung” sein will, das nicht „geschrieben wird, um gedruckt zu werden”. Die Paradoxie, dass es dennoch gedruckt wird, ist die Folge der Tatsache, dass die Sprache nun einmal ein „öffentliches Medium” ist. Und mit Recht fragt Walser sich, warum man Tagebücher erst nach dem Tod des Autors veröffentlichen solle, wenn sie doch so sehr aus dem Existenzmoment heraus geschrieben sind, der dem Zeitgenossen noch nahe ist, dem die Nachgeborenen aber schon entfremdet sind.
Was das Tagebuch eines Schriftstellers für andere vor allem lesbar und faszinierend macht: sie können an und in ihm – und hier sind wieder die Tagebücher Kafkas paradigmatisch – die Konstitution dessen verfolgen, was Walser mit Benedetto Croce die „poetica personalità” nennt, die Ausbildung der „poetischen” auf Kosten der „bürgerlichen” Persönlichkeit. Im Tagebuch – „allein mit sich” - wird sich der Autor zur „Figur”, ja zum „System”. In wohltuender Opposition gegen die heutige Inflation von Dichterbiographien, die wähnen, das Werk eines Autors durch seine Biographie aufschlüsseln zu können, meint Walser, man müsse umgekehrt „das Leben des Autors aus dem Werk erklären”, als Ausdruck eben seiner poetica personalità. Das gemahnt an ein Wort von Paul Bekker über Richard Wagner: Dieser habe nicht den „Tristan” komponiert, weil er in Mathilde Wesendonck verliebt gewesen sei, sondern er habe sich in Mathilde Wesendonck verliebt, weil er den „Tristan” geschrieben habe. Wenn doch Biographen so intelligent wären, das einmal zur Grundlage einer Künstler-Lebensdarstellung zu machen!
Walser weiß freilich, dass es im Tagebuch verschiedene Schichten und Arten des Schreibens gibt, zumal ein adressatenbezogenes, auf das Wiederlesen bedachtes „Aufschreiben” und das nicht adressierte „Hinschreiben”. Dieses aber bildet die eigentliche Signatur des Tagebuchs: „Veröffentlichung des Autors für den Autor, und nur für den” – das Kennzeichen der für Walser in jeder Hinsicht exemplarischen Tagebücher Kafkas. Rührend eine Bemerkung über Goethes Briefwechsel mit Schiller: Manches, was da dem Freund geschrieben werde, würde ein anderer, der über kein solches Alter Ego verfügt, sich selber mitteilen. „Was Goethe im Brief schrieb, hätte ich, der ich nie einen Schiller als Brieffreund gehabt habe, ins Tagebuch geschrieben.”
Bei der Lektüre jedes Tagebuchs stellt man sich die skeptische Frage: Inwieweit ist das Geschriebene redigiert? Fast entrüstet weist Walser den Verdacht zurück, er habe im ersten Band seiner Tagebücher manches retuschiert. Nein, er betont im Gegenteil die prinzipielle Unveränderbarkeit des ,Hingeschriebenen‘. Wirklich hat man kaum je den Verdacht, dass Walser bei der Drucklegung seines Tagebuchs mit Absicht etwas ,weggelassen‘ hat. Oft ist es nichts als eine Gedächtnisstütze. Da gibt es immer wieder Listen der Orte seiner Lesereisen und Aufführungen seiner Stücke, der Personen, die ihn besuchen und die er besucht, da wird Woche für Woche mit Aufmerksamkeit der Auf- und Abstieg eines seiner Romane auf der Bestsellerliste registriert.
Ab und zu sind Faksimiles des Originaltagebuchs eingefügt, mit Kritzeleien und abstrakt-ornamentalen Zeichnungen. Bisweilen finden sich Kinderverse, ganze Lieder und andere Zitate, eigene Maximen und Reflexionen, mal deutlich, mal kryptisch, wie: „Solange die Naturwissenschaft noch zögert, erzählen wir Geschichten”, oder: „Wahrheit und Wirklichkeit haben sich miteinander verabredet. Sie sind verheiratet. Deutlich werden sie nur durch ihr legitimes Kind, die Lüge”.
Oft hätten wir gern genau gewusst, was Walser mit seinen prominenten Gästen gesprochen hat. Da stehen vielfach nur Namen, etwa Ingeborg Bachmann und Uwe Johnson an einem Tag, während in unseren Augen ganz Nebensächliches detailliert entfaltet wird. Walser schreibt eben für sich, nicht für uns. Allzu Privates, Intimes fehlt fast vollständig. „Nichts ist dem Tagebuch, der Sprache des Tagebuchs weniger angemessen als das Private”, schreibt Walser erstaunlicherweise im Nachwort. Wir hatten eigentlich das Gegenteilige gedacht.
Nur einmal füllt das Private viele Seiten des Tagebuchs, aber doch über das Private durch seine Traueremphase weit hinausragend: der Tod der über alles geliebten Mutter im Jahre 1967. Vor allem ihretwegen ist er am Bodensee geblieben, obwohl seine Freunde (zumal Uwe Johnson) ihn immer wieder drängen, endlich nach Berlin zu ziehen. Ob schon je ein bedeutender Schriftsteller in einem Tagebuch eine so herzbewegende Totenklage um seine Mutter niedergeschrieben hat, so ganz ohne ,literarische Absicht‘ sich der Trauer hingebend, so völlig frei von Stilisierung – selbst kindliches Lallen nicht verschmähend: „Mamamamamama. So tot.”
Obwohl Walser wohl nichts aus Gründen der Selbstzensur unter den Tisch fallen lässt, hat er doch zugegebenermaßen in einigen Teilen gekürzt, und zwar im Bereich des ,Mitgeschriebenen‘ – seinem dritten Typus des Tagebuchschreibens. Das Mitgeschriebene ist bei Walser, der noch der Kurzschrift mächtig ist, das Mitstenographierte. Mitgeschrieben hat er die Verlautbarungen auf dem Moskauer Schriftstellerkongress, den er im Juni 1971 besucht hat, die Watergate-Hearings während seines USA-Aufenthalts 1973 und vor allem den Auschwitz-Prozess. Hier scheint das Tagebuch oft zum Stenogramm geworden zu sein, zur reinen, auch woanders lesbaren Dokumentation. Da durfte der Autor kürzen. Freilich verändern sich dadurch bisweilen ein wenig die Proportionen. Die Aufzeichnungen aus dem Auschwitzprozess (1963-65) sind in der gedruckten Form viel zu knapp, als dass sie die wahre Anteilnahme Walsers an dieser ersten großen gerichtlichen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik mit den Verbrechen des Nationalsozialismus spiegeln könnten. Diese Anteilnahme findet ihren gültigen Niederschlag erst in seinen Auschwitz-Essays und seinem Theaterstück „Der Schwarze Schwan”.
Freilich, was von dem ,Mitgeschriebenen‘ abgedruckt wurde, ist überaus aufschlussreich und gehört zu den bedrängendsten Passagen dieses Tagebuchbandes. Scheinbar ohne jede Emotion notiert Walser das im Auschwitzprozess Vernommene: die grauenvollen Grotesken des Verbrechens, das absurde Theater der Hölle und sein Nachspiel im Gerichtssaal. „Josef Klehr liebte runde Zahlen, rundete Selektierte auf, wenn der SS-Arzt gerade eine ungerade Zahl ausgesucht hatte.” Zeugenaussage eines ehemaligen Häftlings: „Bischoff trägt einen belgischen Ingenieur abends herein, legt ihn in der Nähe der Wäscherei auf den Boden. Bischoff stellt sich mit beiden Füßen auf den Brustkörper und wippte mit seinem ganzen Gewicht auf diesem herum, bis der Brustkörper eingedrückt war.” Wilhelm Boger, Erfinder der Hinrichtungsmethode der „Boger-Schaukel”, vom Vorsitzenden gefragt, ob er sich berechtigt gefühlt habe, all diese „Todesurteile” zu fällen: „Na klar.” „An der Wand von Block 11 im Oktober 43, ganz früh, ein kleines Mädchen, bordeauxrotes Kleidchen, einen kleinen Zopf, Händchen an der Seite wie ein Soldat, schaut einmal an sich herunter, wischt Staub von den Schuhen, steht wieder ganz still, dann kommt Boger, nimmt sie an der Hand, sie geht brav mit, er stellt sie mit dem Gesicht zur Schwarzen Wand, sie schaut sich noch einmal um, Boger dreht ihr den Kopf wieder zur Wand, geht zurück und erschießt das Kind mit seinem Gewehr.” Oswald Kaduk, Erfinder der Tötung von Häftlingen mit einem Bergsteigerstock, den er ihnen über den Hals legt, um dann daraufzutreten, beklagt sich über das „Unrecht”, vor Gericht zu stehen, obwohl er doch aus der DDR geflüchtet sei. Jetzt merke er, dass im Westen viel mehr „Ungerechtigkeit” herrsche, wenn man Opfer wie ihn so behandle. „Kaduk liest die Zeitung. Der Vorsitzende: Legen Sie die Zeitung weg. So langweilig ist es hier gar nicht.”
Wenn Walser das alles ohne Anzeichen der Emotion mitschreibt, spürt der Leser in jeder Zeile die Haltung: nur ja kein falsches Wort, nur ja keine Betroffenheitsattitüde, nur ja keinen Versuch unternehmen, einen Ausdruck für das namenlos Entsetzliche zu finden! Später erst reflektiert er über die Undarstellbarkeit von Auschwitz. Selbst Zitate seien gefährlich, denn die „groteske Unbeholfenheit des Mörderjargons” lasse sich nicht von andern in den Mund nehmen und mitteilen, da sich auf sie nicht angemessen reagieren lasse, nicht als Lachen und nicht als Weinen. „Das Zitat ist komisch wie ein Affe (. . .) der einen trauernden Menschen imitiert.” Walser richtet sich in seiner Abwehr jeder Darstellung von Auschwitz sogar gegen Celans „Todesfuge”: „Das ist schön und ohne wirkliche Verbindung zu Auschwitz. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Und das Zitat ist kulinarisch. (. . .) Es gibt keine Sprache für Auschwitz.”
Schon im Tagebuch steht die zynisch-bittere Kardinalthese von Walser: „Auschwitz war das Resultat einer langen Erziehungsarbeit, einer jahrhundertelangen Gegenaufklärung.” Schon findet sich die Formel „Unser Auschwitz” – der Titel des späteren Essays. Er ist ähnlich provozierend wie „Bruder Hitler”, Thomas Manns berühmter Aufsatz. Walser befürchtet, dass die Auschwitz-Prozesse, gerade wegen der hier zutage tretenden Greuel, dem Normalbürger eine Selbstentlastung ermöglichen. Indem man sich nämlich von den Angeschuldigten als Bestien, mit denen man nichts gemein hat, mit Schaudern abwendet, besteht die Gefahr, dass man Auschwitz von der eigenen Geschichte absondert, verdrängt, dass Auschwitz eben „unser” war. Walser hat immer wieder betont – auch noch in seiner umstrittenen Paulskirchenrede –, dass er als deutscher Schriftsteller „unsere geschichtliche Last”, die den Namen Auschwitz trägt, mittragen muss. „Ich habe es nie für möglich gehalten, die Seite der Beschuldigten zu verlassen.” So in der Rede von 1998.
Das Jahrzehnt 1963-1973 ist die Periode der zunehmenden Wendung Walsers zur littérature engagée – so scheint es. Vietnam-Krieg, Auschwitz-Prozess, Watergate-Skandal, Studentenbewegung, sie haben Walser in die politische Arena getrieben. Schon 1961 machte er als Herausgeber des rororo-Bandes „Die Alternative oder Brauchen wir eine neue Regierung” Stimmung für die SPD und Willy Brandt. Doch dessen zögerliche Haltung zum Vietnamkrieg entfremdete ihn der Sozialdemokratie, trieb ihn immer weiter nach links. Statt auf die Parteipolitik setzte er auf das gewerkschaftliche Engagement. „Sozialistisch denken” will er (obwohl ihm sein „Katholisches” immer wieder in die Quere kommt), auch in der Gruppe 47, die er politisieren und zum Entsetzen des Alleinherrschers Hans Werner Richter ,sozialisieren‘ will.
Wer nun erwarten sollte, die Tagebücher dieser Zeit enthielten einen laufenden Kommentar zu den politisch-gesellschaftlichen Zeitereignissen, hier steige der Tagebuchschreiber ständig auf die Tribüne und gebe politische Statements von sich, der sieht sich getäuscht. Und mit dem Selbstbewusstsein eines engagierten Literaten, der den Elfenbeinturm entschlossen verlassen hat, ist es nicht weit her. Nein, gerade in der Zeit der Auschwitz-Prozesse lesen wir Aufzeichnungen wie: „Nichts darf, was Wirkungslosigkeit betrifft, mit dem Schreiben verglichen werden.” Und doch: Für alle anderen Berufe fehlt ihm, Walser, ganz einfach der „Mut”. „Papier, dir allein bin ich gewachsen. Papier mein Element.” Schreiben ist „eine elende Onanie, das nichtsnutzigste Geschäft, das herrlicher ist als alles andere, weil es nichtsnutziger ist als alles andere.”
Schriftsteller ist nichts als „lebenslängliche Hochstapelei”. Wie nahe ist Walser da seinem Antipoden Thomas Mann, welcher sein Lebenswerk mit einem Hochstapler-Roman abgeschlossen hat, der eine Selbstparodie des Künstlers darstellt. Walser geht sogar so weit, den engagierten Schriftsteller als „Funktionär” herabzusetzen, ein Terminus, mit dem er jeden bezeichnet, „dem die Gesellschaft gestattet, etwas anderes zu tun, als er ist”. Ein Schriftsteller, „der so tut, als ginge es ihm um die menschliche Gesellschaft, um das Wohl der Menschen, um das Soziale, der solche Bücher schreibt mit menschenfreundlicher Tendenz und der selber doch weiß, dass es ihm nur auf sich selber ankommt (– und das schreibt er nicht –), das ist ein Funktionär. Er steht im Dienst der Verbreitung menschenfreundlicher Ideen, ein ganz sinnloser Dienst. Franz von Assisi war kein Funktionär, Kafka auch nicht. Sicher, Thomas Mann, Benn und andere Schriftsteller sind zwar unglückliche Funktionäre, aber trotzdem Funktionäre.” (Benn? Ob sich Walser hier nicht einfach verschrieben hat und Brecht meinte?)
Trotzdem hat auch Walser sich, wie er gesteht, eine „öffentliche Funktion erschleichen” wollen, wurde auch er in seinem Sinne ein Funktionär, als er sich mehr und mehr der politischen Sache verschrieb. Walser hat seit seinem Essay „Händedruck mit Gespenstern” (1979) immer wieder den Verdacht geäußert, dass er eine Zeitlang mit fremder Zunge geredet habe. Das hat er bereut, seit langem ist er wieder zu der Einsicht zurückgekehrt, dass er als Schriftsteller nur für sich selbst als „unrettbar Einzelnen” im Sinne seines Hausheiligen Kierkegaard reden kann.
Doch im Grunde sind seine Tagebücher auch dieser wilden politischen Jahre immer Selbstverständigung geblieben, so gut wie nie Verlautbarungen im Dienste der Gesellschaft. Nur mehrfach gebrochen dringen die Strahlen der Zeitgeschichte und des Zeitgeistes in die Dunkelkammer des Ichs. Gerade dadurch fesseln diese Tagebücher als Seelenspiegel eines der großen Schriftsteller unserer Zeit. Der Walser-Biograph Jörg Magenau hat zu ihnen einen sparsam-kundigen Sachkommentar beigesteuert, der manchmal allzu asketisch-knapp anmutet, doch es war gewiss keine leichte Aufgabe, bei einem solchen von Namen und halbverschollenen Fakten überquellenden Lebensdokument das rechte Maß zu finden. Ein Register fehlt, wohl mit Absicht. Gewiss wollte Walser verhindern, dass man mit seiner Hilfe nachspürt: Was hat er über den und den gesagt? Wer spektakuläre Enthüllungen und entlarvende Äußerungen über Zeitgenossen erwartet, kommt sowieso nicht auf seine Kosten.DIETER BORCHMEYER
MARTIN WALSER: Leben und Schreiben. Tagebücher 1963-1973. Rowohlt Verlag, Reinbek 2007. 719 Seiten, 24 Euro.
Walser schreibt eben für sich, nicht für uns. Allzu Privates, Intimes fehlt fast völlig. Das Private sei demTagebuch nicht angemessen.
„Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.” Das ist schön, aber das Zitat bleibt kulinarisch. Es gibt keine Sprache für Auschwitz.
„Ein Schriftsteller, der so tut, als ginge es ihm um die menschliche Gesellschaft, um das Wohl der Menschen, das ist ein Funktionär.”
26. Juni 1973 in Washington: Kurze Unterbrechung der Watergate-Hearings, während der sich die Beteiligten beraten. Foto: AP
Martin Walser bei einer Kundgebung in den siebziger Jahren SV-Bilderdienst
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
"Wunderbare Tagebücher - ein zartes Gespinst aus Buchstabenmusik." - DIE ZEIT.
Martin Walser gehört zu den maßgeblichen Chronisten dieser Republik, ist vielleicht der brillanteste unter ihnen. Bestimmt einer der redlichsten, mit seinen gelegentlichen Irrtümern einer der menschlichsten. Der erste Band der Tagbücher liegt nun vor: Er präformiert und begleitet die Genese der Schriftstellerexistenz. Scharfsinnig, eloquent, verspielt. Frankfurter Rundschau