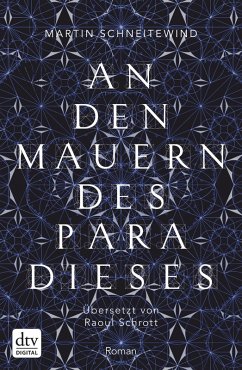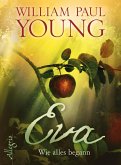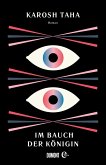Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Lüge
Ergibt das postmoderne Spiel mit fiktiven Autoren
noch Sinn? Am Beispiel von „Martin Schneitewind“
VON KRISTINA MAIDT-ZINKE
Ein Kollege, der leider nicht mehr unter uns ist, erzählte manchmal von seinen Streichen als Jungredakteur bei einer norddeutschen Tageszeitung. Zeitweilig betreute er dort die Geburtstagskolumne, in der jeden Tag eine historisch bedeutende Persönlichkeit vorgestellt werden sollte. Als plötzlich eine Lücke drohte, erfand er kurzerhand einen deutschen Barockdichter, von dem niemand je gehört hatte, und versah ihn liebevoll mit biografischen Details samt Werkliste. Die Sache flog nie auf, denn das Internet gab es noch nicht, und der Name des Phantom-Jubilars war rasch wieder vergessen. Dem Kollegen aber blieb das Vergnügen, das ihm der Bluff bereitet hatte, lange im Gedächtnis.
Das war in den postmodernen Achtzigern, als Wolfgang Hildesheimer mit der Biografie des erfundenen Kunstkritikers Andrew Marbot sogar Gelehrte vorübergehend narrte und Loriots Steinlaus in den „Pschyrembel“ aufgenommen wurde. Es war die Zeit, als in der Literatur metafiktionale Spielereien en vogue waren und in der Wissenschaft der akademische Scherz: So ist überliefert, dass ein Kreis von Koryphäen der Germanistik um Karl-Otto Conrady und Norbert Oellers sich damals zur schieren Kurzweil einen Dichter namens Wilhelm Kurzwig ausdachte, der an den Düppeler Schanzen umkam und ein einsames, überdies verschollenes Fragment mit dem Titel „Der Waldgänger“ hinterließ – oder so ähnlich.
Unsere Epoche gilt als „postironisch“, und der Umgang mit Fake-News und groß dimensionierten Betrugsaffären hat uns abgestumpft gegen die kleinen Freuden des intellektuellen Amüsements. Auch hat es, wenn alle jederzeit ihren Blödsinn worldwide verbreiten können, nur noch wenig Reiz, sich innerhalb bestimmter Zirkel gegenseitig zu nasführen. Das „Erfinden“ von Schriftstellern, das als selbstreferenzielle Volte der Literatur eine lange Tradition hat, wird höchstens noch zweckgebunden praktiziert – zur Tarnung eines realen Autors, der seine Identität verbergen will, oder als Marketing-Instrument, um eine Aufmerksamkeit zu schüren, die sich mit dem literarischen Produkt allein nicht herstellen ließe. Der Unterschied zur herkömmlichen Pseudonym-Praxis ist dann aber nur graduell. Im Idealfall hat sich, wie etwa bei „Elena Ferrante“ oder „Jean-Luc Bannalec“, der Erfolg verselbständigt, bevor die Urheberschaft aufgedeckt wird. Die bloße Lust an der Täuschung oder gar die satirische Absicht, die Leichtgläubigkeit des Literaturbetriebs vorzuführen, spielen dabei keine Rolle.
Wenn nun ein völlig unbekannter, seit Jahren verblichener Romancier aus der Versenkung geholt wird und das einzige Werk, das er hinterließ, von Großmeistern der Fabulierkunst „herausgegeben“ wird, dann weckt das noch einmal Hoffnungen auf ein echtes Schelmenstück. Der kürzlich erschienene Roman „An den Mauern des Paradieses“ soll von einem deutsch-französischen Autor namens Martin Schneitewind stammen, 1945 in Straßburg geboren und 2009 dortselbst verstorben, nachdem er sein letztes Lebensdrittel als Beamter der Stadtverwaltung verbracht hatte. Es ist dort freilich keine Spur von ihm zu ermitteln, und ebenso wenig erinnert sich im benachbarten Kehl jemand an seine Witwe, die angebliche Hüterin des Manuskripts, die dort als Lehrerin gearbeitet haben soll. Dafür stehen zwei prominente Paten hinter dem behaupteten Sensationsfund. Österreicher sind sie beide und zur Zeit quasi Nachbarn im Bregenzerwald: Als „Entdecker“ firmiert Michael Köhlmeier, Mythen- und Märchenspezialist und Hansdampf in allen Gattungen; als „Herausgeber und Übersetzer“ zeichnet Raoul Schrott, Poeta doctus, Polyhistor und Epen-Nachdichter, außerdem Spätdadaist mit Hang zu kleinen autobiografischen und anderen Schwindeleien.
Dass dieses Duo eine neue Herausforderung suchte und den Betrieb ein wenig aufmischen wollte, erscheint schlüssig. Doch bislang sind die Reaktionen eher lau. Kein Wunder, denn bei allem Aufwand der Inszenierung schien es den beiden auf Glaubwürdigkeit oder wirksame Irreführung, gar nicht anzukommen. Der von Michael Köhlmeier im Nachwort geschilderte Lebenslauf des Martin Schneitewind, den er einst in einer Marburger Studenten-WG kennengelernt haben will, ist zwar spektakulär, aber allzu leicht als Konstrukt zu durchschauen. Der windige Typ, der Anfang der Siebzigerjahre in besagte Wohngemeinschaft schneite, wird beschrieben als Glückskind und Genie, als Menschenverführer, der sich chamäleonartig jedem anverwandelte und ihn dann skrupellos ausnutzte: Er sei, verrät Köhlmeier, das Vorbild seines Romanhelden „Joel Spazierer“ gewesen. Ins Komisch-Surreale driftet die Erzählung spätestens, wenn der Unruhestifter, nachdem die Gemeinschaft seinetwegen zerbrochen ist, in einer Blitzaktion die ganze Wohnung besenrein ausraubt und spurlos verschwindet.
Noch abenteuerlicher ist die Episode, die sich laut Köhlmeier in den Sechzigerjahren beim Corriere della Sera in Mailand zutrug, wo der hochbegabte Volontär Schneitewind in der Sportredaktion, genauer: auf der Herrentoilette, dem berühmten Journalisten und Schriftsteller Dino Buzzati begegnete, woraus eine wunderbare Freundschaft sowie ein gemeinsames literarisches Projekt entstand. Das Buzzati dann für sich reklamierte, obwohl der fertige Roman zur Gänze von Schneitewind stammte. Der, schon damals ein Meisterdieb, stahl das Manuskript und ließ es vierzig Jahre liegen, in denen er unter anderem Theologie in Tübingen studierte und Südamerika bereiste. Kurz vor seinem Tod schrieb er den italienischen Text auf Französisch um und übergab ihn seiner Lebensgefährtin, von der ihn dann Michael Köhlmeier erhielt.
Eine hübsche Geschichte – und deutlich kurzweiliger als das Werk, dem sie vorausgegangen sein soll. Der Roman „An den Mauern des Paradieses“ ist eine Kolportagestory, halb Geschichtsfiktion und halb Dystopie, die brandaktuelle Themen samt existenziellen Fragen verhandeln und dabei noch ein Krimi sein will, außerdem ein Konglomerat verschiedener Stilregister, und die unter dieser Last in allen Fugen ächzt: Kurz nach dem Ersten Weltkrieg kommt ein Orientalist aus Toronto im Auftrag des New York Herald an den Persischen Golf, wo bei einem gigantischen Dammbau einige Tontafeln gefunden wurden, die ein neues Licht auf den biblischen Schöpfungsmythos werfen könnten. Der Reisende betritt damit das spezielle Interessengebiet von Raoul Schrott, dem Kenner und Erforscher sumerischer und assyrischer Schriften, was sich niederschlägt in Übersetzungsproben, Textauslegungen und „Editorischen Notizen“ voll gelehrter Verweise, ein paar Finten inklusive.
Als Gegenleistung für den Zugang zur Fundstätte soll der Reporter die verschwundene Tochter des Bauleiters suchen, und er gerät dabei er in die Fänge eines finsteren diktatorischen Systems, das mit Mauern und Militäreinsätzen gegen Migrantenströme kämpft. In einer Parallelhandlung berichtet ein libanesischer Offizier von der Brutalität jener Maßnahmen und vom Versuch einer Revolte. Am Ende teilt er den Kerker mit dem Kanadier, der beide Erzählstränge in seinem Schreibheft zusammenführt – die fiktionale Spiegelung einer doppelten Verfasserschaft.
Die beiden „Herausgeber“ des Romans haben den Text so ausgiebig wie selbstbezüglich angereichert mit Reflexionen über das Verhältnis von Sein und Schein, Wahrheit und Täuschung, Realität und Fiktion. Und Raoul Schrott lässt seine editorischen Überlegungen gipfeln im fundamentalen Zweifel an der Funktion und Instanz eines „Autors“. So weit, so gut.
Übertrieben haben Schrott und Köhlmeier allerdings mit ihren begleitend veröffentlichten Hymnen auf das Schneitewind-Opus, diesen „ungeheuren und einsamen Wurf“, über dessen „prophetische“, „charismatische“ und sonstige Qualitäten sie sich gar nicht mehr einkriegen. Sicher hatten die beiden ihren Spaß, aber sie hätten den Leser daran teilhaben lassen sollen. In all dem postironischen Pathos verpufft leider auch die Pointe, dass Schneitewind, wie eine Anmerkung behauptet, mit seinem „amerikanischen Jugendfreund“ Donald Trump durch Südamerika reiste, bis die beiden sich im peruanischen Urwald zerstritten. Zwei Hochstapler im Dschungel, ein echter und ein Phantom – zu schade, wenn dann kein Schwein guckt.
Martin Schneitewind: An den Mauern des Paradieses. Roman. Aus dem Französischen von Raoul Schrott. Mit einem Nachwort von Michael Köhlmeier. dtv, München 2019. 400 Seiten, 24 Euro
.
Von Michael Köhlmeier erschien zuletzt
der Roman „Bruder und Schwester Lenobel“ (Hanser).
Foto: dpa/Jan Woitas
Raoul Schrott schreibt Essays, Lyrik und große Epen wie „Erste Erde“ (Hanser, 2016).
Foto: dpa/ Arno Burgi
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Bruchstücke der Erkenntnis: Raoul Schrott und Michael Köhlmeier erwecken Donald Trumps Jugendfreund zu neuem Leben
Den eigentlichen Roman dieses Romans schreibt Michael Köhlmeier in seinem dreißigseitigen Nachwort. Im Herbst 2015 habe er eine Mail bekommen, von einer Frau, mit der er vor über vierzig Jahren ein paar Wochen zusammen in einer Studenten-WG in Marburg zusammengewohnt habe. Zur selben Zeit habe sie auch Martin Schneitewind kennengelernt, an den er sich gewiss noch erinnere, was Köhlmeier bestätigt. Mit ihm habe sie bis zu seinem Tod 2009 zusammengelebt, und er habe ein Manuskript hinterlassen, das sie Köhlmeier gern zeigen wolle. Es folgt die Geschichte der persönlichen Begegnung und der Übergabe des Manuskripts, es folgt die abenteuerliche Lebensgeschichte Martin Schneitewinds, geboren 1945 in Straßburg als Sohn deutsch-französischer Eltern, seine kurzfristige Mitarbeit beim "Corriere della Sera" in Mailand und die damit verbundene Bekanntschaft mit Dino Buzzati, seine Reisen durch Südamerika, seine Arbeit für die Stadtverwaltung in Straßburg bis zur Pensionierung. Das Manuskript, das seine Lebensgefährtin Köhlmeier übergibt, ist in französischer Sprache geschrieben, und da Köhlmeier kein Französisch kann, muss Raoul Schrott es übersetzen.
Mystifikationen sind im Literaturbetrieb gang und gäbe, von B. Traven über Andreas Thalmayr bis zu Elena Ferrante. Wenn Michael Köhlmeier und Raoul Schrott also zusammen einen Roman schreiben, das aber nicht als Autorengespann unter eigenem Namen tun wollten, sondern zu diesem Zweck Martin Schneitewind erfänden, wäre das völlig legitim, solange ein gelungenes Buch dabei herauskommt.
Leider ist das hier nicht der Fall, und die Gründe dafür sind nicht schwer auszumachen. Die Dystopie, die der mysteriöse Autor Schneitewind hier zu entfalten versucht, scheitert vor allem daran, dass sie zu ambitiös ist. Sein Erzähler, der Altertumswissenschaftler David Ostrich von der Universität Toronto, fährt an den Persischen Golf, wo neue Tontafeln entdeckt worden sind, die auf ihre Entzifferung warten und angeblich ein neues Licht auf die Schöpfungsgeschichte und den Garten Eden werfen: daher der Titel des Romans. Um die Fundstätte besuchen zu dürfen, muss Ostrich allerdings Evita (!) finden, die verschwundene Tochter von Thaut, dem Leiter eines großen Dammbauprojekts. Dieser Auftrag wird ihm nicht von Thaut persönlich erteilt, sondern von einem persönlichen Referenten. Später wird man - von Thauts Frau, mit der Ostrich eine kurzzeitige Affäre hat - erfahren, dass Thaut selbst seit langem tot ist und nur noch in mumifizierter Gestalt dann und wann medial der Öffentlichkeit präsentiert wird, als sei er der leibhaftige Lenin. Während der Dammbau offenbar die Antwort auf einen bereits weit fortgeschrittenen Klimawandel darstellt, werden an der Ostgrenze des Staates Migrantenströme mit brutalsten Methoden abgewehrt. Darüber berichtet in einem gesonderten Strang ein zweiter Erzähler, der Leutnant Atam. Hier wird die Referenz auf des Autors angebliche Bekanntschaft mit Dino Buzzati deutlich. Dieser Erzählstrang ist zum einen wesentlich konziser und besser geschrieben, und die Parallelen zu Buzzatis Festung Bastiani aus dem Roman "Die Tatarenwüste" sind unübersehbar.
Um es kurz zu machen: Ostrich landet am Ende nach allerlei Verwicklungen als Gefangener in einem kleinen, abglegenen Fort, wo er von lustlosen Soldaten eher sich selbst überlassen als bewacht wird. Das alles darf hier wiedergegeben werden, ohne dem potentiellen Leser die Spannung zu nehmen, denn die gibt es nicht in diesem Buch.
"Schneitewinds" Dystopie verlegt also einerseits wie alle Dystopien zeitgeschichtliche Bezüge in eine nicht näher bestimmte Zukunft, wobei anzumerken ist, dass dies hier auf eine Art geschieht, wie es ein bereits 2009 verstorbener Autor kaum gekonnt hätte, weil etwa das Ausmaß der Migrationsbewegungen der dann folgenden Jahre und der Errichtung neuer Grenzen noch gar nicht absehbar war, ganz abgesehen vom "Bau der Mexikanischen Mauer", der auf Seite 143 erwähnt wird. (Schneitewind war angeblich, wie aus Raoul Schrotts übersetzerischen Anmerkungen hervorgeht, in seiner Jugend mit Donald Trump befreundet, bevor er sich im peruanischen Urwald mit ihm zerstritten hat.)
Jenseits der zeitgeschichtlichen Bezüge nimmt nun das eigentliche Fachgebiet von Ostrich, die Altertumswissenschaft und besonders die Beschäftigung mit den verschiedenen Schöpfungsmythen, einen breiten Raum ein, was innerhalb der Arbeitsteilung zwischen den beiden Autoren vermutlich auf das Konto von Raoul Schrott geht. An dieser überambitionierten Ausweitung der Kampfzone in alle Richtungen bricht der Roman dann auseinander.
Hinzu kommt, dass der Erzähler David Ostrich eine merkwürdige Mischung aus tumbem Tor, eitlem Besserwisser und Amateurphilosoph mit starkem Hang zu Plattitüden ist: "Mir wurde dabei bewusst, dass gleich wie viele Bruchstücke von Wissen man sammelt, sie erst durch den Zusammenhang einen Sinn erhalten, ohne den sie bloß nebeneinander bestehen, isoliert und absurd." Diese Erkenntnis sollte einem Wissenschaftler doch schon wesentlich früher gedämmert haben. Als ganz neue Einsicht wird dreißig Seiten später auch das problematische Wesen der Zeit verkauft, seit Augustinus eigentlich ein philosophischer Dauerbrenner. "Ist es möglich, über Zeit zu reden? Es heißt, sie wäre absolut, unumkehrbar und unaufhaltbar. Doch ist sie das wirklich?" Tja, man weiß es nicht. Richtig peinlich wird es dann an dieser Stelle: "Können, wollen, müssen, sollen; das ganze Leben scheint bloß aus diesen Modalverben zu bestehen, ohne dass ein Mögen und Dürfen dabei wirklich vorgesehen wäre." Dagegen sind manche Vergleiche schon eher lustig: "Der Ibis in seiner Voliere stocherte mit dem Schnabel in seinem Gefieder wie ein Buchhalter in einem Zahlenregister."
Kurz vor Schluss wird die Moral von der Geschicht' geliefert: ". . . dass da nur Ohmacht ist. Uns und der Welt gegenüber. Was eine Moral vorgäbe, an die wir uns trotz aller Bitterkeit halten könnten. Auch wenn sie die Wahrheit eines zum Tode Verurteilten ist. Denn das sind wir, von Geburt an."
Gerade deshalb sollten wir uns genau überlegen, welche Bücher wir in der jeweils verbleibenden Zeit lesen und welche nicht.
JOCHEN SCHIMMANG
Martin Schneitewind: "An den Mauern des Paradieses". Roman.
Aus dem Französischen von Raoul Schrott. Nachwort von Michael Köhlmeier.
Dtv, München 2019. 395 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main