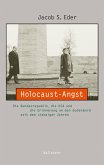Seit Jahrzehnten empfinden sich die Deutschen als gefühlte Opfer und vertrauen seit der Rede Richard von Weizsäckers 1985 dem Versprechen, Erinnerung führe zu »Erlösung«. Diese Erinnerungsmoral untersuchen Ulrike Jureit und Christian Schneider historisch, geistesgeschichtlich und psychoanalytisch. Ihr Fazit: Eine vollkommene »Vergangenheitsbewältigung» bleibt eine Illusion.

Opfer wurden
Ulrike Jureit und Christian Schneider zeigen
Schattenseiten der „Vergangenheitsbewältigung“
Dieses Buch stochert ebenso ungeniert wie schmerzhaft in der deutschen Amfortaswunde. Ulrike Jureit und Christian Schneider, Historikerin die eine, Soziologe und Psychoanalytiker der andere, beschreiben die „Illusionen der Vergangenheitsbewältigung“, die ihrer Ansicht nach ein neues Phänomen hervorgebracht haben: die Figur des „gefühlten Opfers“.
„Eine Olympiade der Betroffenheit“ finde heutzutage statt, schreiben die Autoren; die ermordeten Juden seien zu den „Hausgöttern der Täterkinder“ geworden. Mit der heutigen Art des Gedenkens würden die Toten oftmals auf falsche Weise vereinnahmt. Ulrike Jureit, die federführend an der zweiten Auflage der Wehrmachts-Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung beteiligt war, ergründet, wie die Bundesrepublik in der „erinnerungspolitischen Sackgasse“ gelandet ist und sich dort eingerichtet hat. Sie schreibt: Eine „Erinnerungsgemeinschaft, die auf das geliehene Selbstbild des gefühlten Opfers“ zurückgreift, gebe derzeit den Ton an.
Als prominentestes Beispiel für diese Travestie nennt Jureit das Berliner Holocaust-Mahnmal, das – unter Ausblendung der Täter – der getöteten Juden eben „nicht als Opfer des von Deutschen verübten Massenmords“ gedenkt, sondern die Ermordeten „als eigene Tote rituell vereinnahmt“. Da hat Jureit recht. Überzeugend ist auch, wie sie Jan Assmann, einem Theoretiker des „kollektiven Gedächtnisses“, die Leviten liest: Assmann habe dieses Konzept biologistisch, nämlich im Sinn der „kulturellen Arterhaltung“ interpretiert. Fragen nach dem Holocaust kann man damit tatsächlich kaum klären.
Die Toten dürfen nicht sterben
Jureit hält es für falsch, von den Tätern ganz abzusehen und den Holocaust zu dämonisieren. Sie plädiert gegen zu viel Moralisieren und für mehr praktische Irritation bei der Erinnerung an Krieg und Shoah. Nur: Wie macht man das? Wie lassen sich, um in der Sprache des Buches zu bleiben, den„gefühlten Opfern“ wahrhaft „gefühlte Täter“ gegenüberstellen? Das Geständnis eines Günter Grass, in seiner Jugend in der Waffen-SS gewesen zu sein, hat ja, wie Jureit selbst feststellt, vor allem Unmut hervorgerufen: Grass wurde nicht dafür gelobt, dass er sich eröffnet hatte, sondern getadelt, weil er es zu spät getan hatte.
Während Jureit eine umsichtige Erkundung unserer Empörungsroutinen gelingt, konzentriert sich ihr Koautor Christian Schneider auf die „Unfähigkeit zu trauern“, die Margarete und Alexander Mitscherlich den Deutschen 1967 attestiert haben. Neben Adornos „Negativer Dialektik“ und Habermas’ „Erkenntnis und Interesse“ intonierte die Studie der beiden Frankfurter Analytiker jenen Cantus firmus, in dem, so Schneider, die Achtundsechziger sich als „Entronnene“ stilisiert und „um sich selbst als Opfer“ getrauert hätten.
Schneider macht Tabula rasa: Adorno kriegt sein Fett weg, weil er „die unantastbare Aura“, die „Sprecherposition des Entronnenen“ erfand, in die viele seiner Leser sich dann auch begaben; Habermas, weil er allzu naiv angenommen habe, man könne mit Hilfe von Marx und Freud die eigene Geschichte ganz verstehen; und die Mitscherlichs, weil ihre Lesart des Trauerbegriffs moralisierend war, mithin: ein analytischer Fauxpas.
Nun ist an der „Unfähigkeit zu trauern“ viel gemäkelt worden, und nicht wenige Einwände – etwa gegen den wirren Umgang der Mitscherlichs mit Trauer und Melancholie – sind berechtigt. Wer aber einen Blick ins Original wirft, versteht, grob gesagt, zumindest so viel: Weil die Deutschen nicht wahrhaben wollten, dass sie libidinös an Hitler gefesselt waren, konnten sie sich nicht von ihm befreien; stattdessen flüchteten sie, so heißt es in dem Buch, in eine „Verleugnung der Vergangenheit“, die auch „mangelnde Einfühlung in das Schicksal der Opfer“ zur Folge hatte. Schneider indes hält den Mitscherlichs vor, das Entscheidende am Prozess der Trauer ignoriert zu haben: die Ablösung von den Toten und die Fähigkeit, ihr Verschwinden schließlich anzuerkennen, fachsprachlich „Lysis“ genannt.
Heutzutage, so Schneider, bestimme eine Holocaust-Fixierung das öffentliche Bild; die Täterkinder hätten sich genauso libidinös an die Opfer gebunden wie einst ihre Eltern an den Führer: Die Toten dürfen nicht sterben.
Daran ist ebenso viel richtig wie verkehrt. Richtig ist, dass viele Nachgeborene ihr Augenmerk umso entschiedener (und ja: auch verzweifelter) auf die Opfer richteten, je mehr ihr Umfeld, die eigene Familie vor allem, den Blick abwandte.
Weniger einleuchtend ist hingegen Schneiders Gedanke, dass die Toten heute durch „nachträgliche Eingemeindung“ und „Heiligsprechung“ umstandslos vereinnahmt würden. Entscheidend ist doch, dass sie einstmals ausgegrenzt und vernichtet wurden, dass die Deutschen sich nach dem Krieg zu dem Verbrechen nur ungern bekannten und von dem Verlust nichts wissen wollten. Und eben darum geht es, wie verklausuliert auch immer, bei den Mitscherlichs: um die Selbstamputation des deutschen Volkes, das viele seiner Bürger ausstieß und ermordete, weil es einer narzisstischen Verblendung erlag, die von Adolf Hitler personifiziert wurde.
Wie es dazu kam, wird in der Sphäre symbolisch-offiziellen Erinnerns bis heute ausgeklammert. Hier sieht Schneider zu Recht eine Lücke. Einer Idee des Analytikers Hermann Beland folgend, schlägt er vor, diese Lücke durch „Trauerarbeit über den Verlust des eigenen Guten“ zu füllen. So gelte es, die Anziehungskraft des Nationalsozialismus – Stichworte dazu sind: „Sicherheitsgefühl“ und „Volksgemeinschaft“ – zur Kenntnis zu nehmen, anstatt sie rundweg zu verdammen. Ob sich damit die Zahl „gefühlter Opfer“ verringern ließe, bleibt allerdings ebenso offen wie die entscheidende Frage nach der Ursache des Skandalons: Warum schaue ich weg, wenn mein Nachbar verfolgt wird? Die Antwort darauf steht weiterhin aus. DORION WEICKMANN
ULRIKE JUREIT, CHRISTIAN SCHNEIDER: Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung. Klett-Cotta, Stuttgart 2010. 253 Seiten, 21,95 Euro.
Dorion Weickmann ist freie Journalistin.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Mut und analytische Kraft bescheinigt Richard Klein den Autoren dieses Buchs, das sich des "heißen Eisens" deutscher Erinnerungskultur annehme. Die provokante Grundthese des Buchs sei, dass die Erinnerungskultur hierzulande aus einer geliehenen Opferperspektive heraus entworfen werde. Dass diese Erinnerungskultur daher auch exkulpative Momente habe: Wir, die wir uns erinnern, können nicht schuldig sein. Den hohen Erkenntniswert des Buchs sieht der Kritiker der Kombination des Autorenduos geschuldet: Ulrike Jureit sei Historikerin, Christian Schneider ein psychoanalytisch forschender Soziologe. Besonders inspirierend fand Klein Schneiders Skizze einer psychoanalytischen Theorie der Trauer, die mit einer hochspannenden Mitscherlich-Kritik einsetze und Lust auf mehr mache. Auch dankt er Schneider die Entdeckung von Norbert Elias als Diskursbeiträger zur Erinnerungsdebatte, in der er bislang zum Erstaunen des Kritikers keine Rolle spielte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH