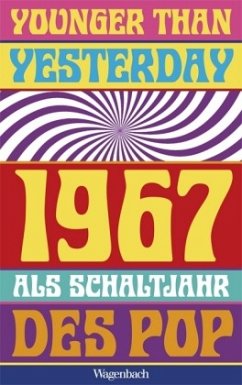»It was twenty years ago today« ? so setzt »Sgt. Pepper?s Lonely Hearts Club Band« ein, und in der Welt der Popmusik ist nichts mehr wie zuvor. Vom legendären Cover bis zu den Songtexten, die erstmals auf der Plattenhu?lle abgedruckt werden, als seien es Gedichte ? alles gehört zum Gesamtkunstwerk, an dem die Beatles monatelang tüfteln.1967 werden in den USA erstmals mehr Alben als Singles verkauft. Das Album wird zur medialen Bu?hne eines neuen Anspruchs: Pop will nicht mehr als bloße Unterhaltungsware gelten, Pop will fortan Kunst sein. Im »Summer of Love« herrscht ein Klima gegenseitiger Überbietungsversuche: Nicht nur Pink Floyd reiten auf der psychedelischen Welle. Bob Dylan beendet seine E-Gitarren-Experimente, Brian Wilson will das größte Album der Popgeschichte aufnehmen, und The Velvet Underground lassen Andy Warhol das Plattencover gestalten ? ihr Album kauft trotzdem niemand. Kenntnis- und anekdotenreich laden die Beiträge dieses Buchs dazu ein, jene Alben neu zu entdecken, die den Pop bis heute prägen ? und fu?hren wie nebenbei vor, was in diesem faszinierenden Jahr sonst noch geschah.

Worauf sich Fans und Verächter einigen können: Ein Sammelband deutet Platten des Jahres 1967 als Meilensteine der Popgeschichte.
Von Peter Kemper
Im Jahr 1967 bombardierte die amerikanische Air Force Nordvietnam, Mao Tse-tungs Rote Brigaden wüteten in China, in den Vereinigten Staaten kam es zu schweren Massenunruhen, in Griechenland putschten sich die Obristen an die Macht - und westliche Jugendliche begingen ihren "Summer of Love". Der oft als fünfter Beatle bezeichnete Produzent George Martin erinnert sich: "Sie diskutierten über Revolution und ihr seelisches Gleichgewicht. ,Flowers' gaben ihnen ,Power'. Sie hatten Pot und Acid, Optimismus und Enthusiasmus. Sie hatten ,Happenings', ,Be-ins' und ,Love-ins'. Sie hatten Idealismus, Energie, Geld und Jugend. Und sie hatten noch etwas anderes: Sie hatten Musik."
1967 war auch das Jahr, in dem die Popmusik erwachsen wurde. Sie galt nicht länger bloß als klingende Tapete eines Lebensstils, sondern verwandelte sich von einer Unterhaltungsware mitunter sogar in Kunst, die ihre eigenen Bedingungen und Möglichkeiten mit reflektierte. Ein neuer Sammelband versucht anhand der wichtigsten Plattenproduktionen dieses Jahres, Stimmungslagen, Sehnsüchte und kulturelle Codes zu rekonstruieren. Nicht nur die drei Herausgeber, sondern fast alle Beiträger haben akademisch literaturwissenschaftlichen Hintergrund. Seit Jahren ist zu beobachten, dass Beiträge aus Disziplinen wie Philologie, Philosophie und Kulturtheorie den Pop-Diskurs erweitern.
Wenn Frank Kelleter das Debütalbum von "The Velvet Underground & Nico" in den Blick nimmt, wird noch einmal erlebbar, wie fernab vom "Swinging London" der Beatles in New York um Andy Warhol ein Kunstprojekt entstand, das mit seiner fast abweisenden Nüchternheit und konfrontativen Krach-Landschaft alle Flower-Power-Blütenträume unterminierte: "Die neue Bondage-Ästhetik der Factory harmonierte hervorragend mit den schwarzen Lederjacken und Sonnenbrillen der Velvet Underground. Leder und Samt signalisierten Begehren und Coolness zugleich."
Wenn Kelleter behauptet, Maureen Tucker sei die "erste weibliche Drummerin der Rockgeschichte" gewesen, hätte zwar ein genauerer Blick in ebenjene Rockgeschichte nicht geschadet, um zu sehen, dass bereits 1962 in England mit den Liverbirds eine rein weibliche Beatband am Start war (und wichtiger noch war sicherlich 1964 Ann Lantree als Schlagzeugerin der Honeycombs). Doch Kelleters Beitrag gibt ein eindringliches Bild der "Cliquenhölle" um Warhol und Lou Reed, das selbst die rätselhafte Nico etwas greifbarer werden lässt.
Eher keine so gute Idee war es, den Schriftsteller Frank Witzel mit dem zentralen Essay über das Beatles-Album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" zu betrauen. Mit Rückgriff auf Susan Sontag und Leslie Fiedler zeigt er zunächst, dass "Sgt. Pepper" das gelungene Resultat eines Übergangsritus ist. "Der offensichtliche Widerspruch bestand in den Sechzigern nun darin, diese sogenannte Jugendkultur nicht durch ein Erwachsenwerden zu verraten oder zu denunzieren und gleichzeitig nicht in die narzisstische Falle des ewigen Jugendlichen zu geraten." Gleichzeitig kommt Witzel aber zu einer bizarren Interpretation des Albums, wenn er behauptet, ausgerechnet Ringo halte "Sgt. Pepper" durch sein Spiel zusammen: "Das Schlagzeug ist das signifikante Instrument der Platte, das mit ungewöhnlichen Breaks und gitarrenähnlichen Riffs nicht länger allein den Rhythmus unterstreicht, sondern eine eigene Melodieführung übernimmt." Dabei ist es doch gerade die erstmals durch Studiotechnik realisierte kaleidoskopische Vielfalt der Instrumente, der Klangfarben und ihrer Verfremdungen, die das Album so innovativ machte.
Natürlich darf in diesem popkulturellen Kontext auch das Debütalbum von Pink Floyd nicht fehlen. Gerhard Kaiser demonstriert in seiner Betrachtung, warum "The Piper at the Gates of Dawn" das "einzige Pink-Floyd-Album (ist), auf das sich bis heute alle einigen können. Alle - das schließt neben den Abermillionen von Fans selbst die Verächter der Band mit ein, und das sind auch nicht gerade wenige . . .".
Von detektivischem Tiefgang ist Heinrich Deterings Analyse des Bob-Dylan-Albums "John Wesley Harding". In seiner Spurensuche deckt er auf, welche Verfremdungseffekte Dylan in diesem zunächst spröde und sperrig wirkenden Werk einsetzte, das bei seinem Erscheinen Ende 1967 bewusst quer stand zum psychedelischen Pop-Underground. Dessen Ursprünge an der amerikanischen Westküste zeichnen die Beiträge über die Debütalben von Grateful Dead und Jefferson Airplane detailliert nach. Dass die Byrds mit ihrer Platte "Younger Than Yesterday" wirklich zu den wichtigsten Exponenten des Pop-Schaltjahres 1967 zählen, kann man bezweifeln, wenn dafür gleichzeitig so zentrale Produktionen wie "Disraeli Gears" von Cream, "Absolutely Free" von den Mothers of Invention oder die Rolling-Stones-Platte "Their Satanic Majesties Request" auf der Strecke bleiben.
Das erste Album der Jimi Hendrix Experience, "Are You Experienced?", gehört natürlich zwingend zum Kanon von 1967 - danach war die E-Gitarre ein völlig anderes Instrument -, und auch das Debüt der Doors mit seinem Fokus auf "Rausch, Sex und Tod" mag ihm zuzuschlagen sein. Selbst das Beach-Boys-Album "Smiley Smile" lässt sich mit viel Wohlwollen zu den wichtigsten Veröffentlichungen von 1967 rechnen. Bei Aretha Franklins LP-Produktion "I Never Loved a Man the Way I Love You" stellt sich die Relevanz-Frage erst gar nicht: Vea Kaiser zeigt, dass die "Queen of Soul" hier mit seltenem Selbstbewusstsein die "Lust einer Lady" thematisiert und damit "einer breiteren Zuhörerschaft die Verbindung von Irdischem und Himmlischem in der Musik näherbringt".
Das heute fast vergessene Debütalbum von David Bowie, das schon damals floppte, möchte man aber eher nicht zu den Meisterwerken des Jahres zählen. Irritierend ist auch der abschließende Essay von Moritz Baßler über "Die neuen Pop-Paradigmen und ihre Rezeption in Deutschland". Er attestiert der bundesdeutschen Musikszene pauschal: "Deutschland hat Pop in den 1960er Jahren nicht verstanden." Dieses absurde Verdikt gründet er allein auf die Analyse von deutschen Coverversionen angloamerikanischer Hits und ihrer Resonanz in damaligen Szene-Blättern wie "Bravo" oder "Twen". Das Radio - namentlich die damaligen Piratensender - als vielleicht wichtigstes Medium popkultureller Sozialisation und Verständigung taucht bei ihm gar nicht auf. Und muss man hier nicht auch der ungeheuer breiten und reichen Band-Bewegung - mehr als dreitausend deutsche Rockgruppen gab es im Deutschland der sechziger Jahre - Rechnung tragen?
Trotzdem, es gelingt dem Buch insgesamt ausgezeichnet, die Atmosphäre des popkulturellen Aufbruchs dieses Jahres wieder aufleben zu lassen.
"Younger Than Yesterday". 1967 als Schaltjahr des Pop.
Hrsg. von Gerhard Kaiser, Christoph Jürgensen und Antonius Weixler. Wagenbach Verlag, Berlin 2017. 256 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ein Buch über das eigentlich doch sehr aufregende Pop-Jahr 1967
offenbart Lücken und blinde Flecken. Auch so geht Domestizierung durch Aneignung
VON JAN KEDVES
Akademisch über Pop zu schreiben galt lange als Widerspruch. Es kann auch heute noch einer sein. Nimmt man den Sammelband „Younger Than Yesterday – 1967 als Schaltjahr des Pop“ zur Hand, sollte man die darin thematisierte Musik sehr, sehr laut aufdrehen, um die sedierende Wirkung der Lektüre auszugleichen.
Gewiss, wissenschaftliche Pop-Exegese muss aus der benutzten Sprache nicht unbedingt selbst Pop machen, so wie es im deutschen Sprachraum Diedrich Diederichsen oder Rainald Goetz getan haben. An sich ist es eine schöne Idee, jedem einzelnen Pop-Jahr sein eigenes Buch zu widmen und damit Jon Savages jüngstem Werk „1966: The Year The Decade Exploded“ – es behandelt die Teenage-Kultur, LSD, die Beach Boys, Andy Warhol, die Effekte von Motown in Großbritannien, die Schwulenbewegung, im Grunde eben das große Ganze – ein paar deutsche Aufsätze über das Folgejahr zur Seite zu stellen. Aber wenn schon der erste Satz lautet: „Am 1. Juni 1967 erscheint das achte Album der Beatles“, und der zweite Satz „Sgt. Pepper’s“ zitiert: „It was twenty years ago today“, dann weiß man: Die Autoren haben es sehr mit Zahlen, aber nicht so mit spannendem Formulieren.
Das ist ein Problem für dieses Buch, schlicht deswegen, weil 1967 sicher kein dröges Jahr war. In England nahm David Jones seine ersten Songs als David Bowie auf, in den USA sprachen sich Berichte über die Acid-Tests in Haight-Ashbury so weit herum, dass schon die ersten Bustouren für Touristen durch das Viertel angeboten wurden, was die begafften Hippies und LSD-Jünger nervte; Brian Wilson ließ sich für seine Arbeit am legendär unvollendeten Beach-Boys-Magnum-Opus „Smile“ Sand ins Wohnzimmer kippen, für das echte Strandfeeling beim Komponieren am Flügel. All dies wird im Buch auch erwähnt, und dann werden ihrer chronologischen Reihenfolge nach Songs, Texte und Covermotive analysiert, und damit soll dann herausgearbeitet werden, wie im Jahr 1967 das Format-Album – zuvor eher eine schlichte Ansammlung von Hit-Singles – zur höchsten Kunstform des Pop überhaupt wurde: zum Konzeptalbum!
Aber die Sprache! Jargon ist gar kein Ausdruck. In dem Aufsatz über das Debütalbum der Grateful Dead entwickeln die Songs „einen musikalisch-performativen Sog, der die Zuhörer unweigerlich erfasst“, natürlich werden sehr viele Erwartungen „unterlaufen“, und die Musiker sind „musikalisch-gegenkulturelle Befreier“, die „angesichts dunkler Zeiten mit psychedelischen Mitteln etwas Sonne zu bringen versprechen“. Uff! Im Beitrag zu Bob Dylans „John Wesley Harding“ heißt es: „Der raunende Beschwörer des Imperfekts erkennt im scheinbar Vergangenen in schockierender Plötzlichkeit die Wahrheit über seine eigene Existenz.“
Man möchte sofort zu den wenigen (drei von zwölf) Beiträgen vorblättern, die es besser hinbekommen. Zwei von ihnen stammen von Beitragenden, die sich normalerweise außerhalb des akademischen Betriebs betätigen. Frank Witzel verbindet in seinem schönen Text über das „Sgt. Pepper“-Album der Beatles autobiografische Erinnerungen an die Bedrohlichkeit, die einst von dieser Musik ausging, mit der Beschreibung eines Konzertbesuchs im Rahmen des 47. Deutschen Jazzfestivals im vergangenen Jahr: Die HR-Bigband interpretiert in der Alten Oper zu Frankfurt „Sgt. Peppers“ als „blutleeren Jazz-Vampir“, mithilfe eines, so Witzel, „bis zur eigenen Parodie erstarrten Jazz-Begriffs“. Domestizierung durch Aneignung.
Die Journalistin Anja Rützel beginnt ihren Text über das Byrds-Album „Younger Than Yesterday“ auf gekrümmter Bahn: „Wenn ich einmal jemanden erschlage, werde ich es mit meinem Byrds-Buch tun“ – eine „insinuatio“, wie Rützel einige Seiten weiter aufklärt, also ein „psychologischer Trick“, mit dem das eher „leidlich interessierte“ Publikum doch noch gewonnen wird. Die Byrds wandten diesen Trick selbst auf ihrem Album an, indem sie den Hörer im ersten Stück gleich von der Seite ankumpelten: „So you want to be a Rock ’n’ Roll Star …“
Fast möchte man dieses Buch doch noch versöhnt zur Seite legen. Dann aber fällt einem auf, dass auf den gelesenen
250 Seiten, zwischen den Beatles und Byrds und Beach Boys, zwischen den Doors und Dylan und all den anderen, gerade mal zwei nicht-weiße Musiker behandelt werden: Jimi Hendrix (mit dem Debütalbum seiner Experience) und Aretha Franklin (mit ihrem Album „I Never Loved A Man The Way I Loved You“).
Dabei war 1967 im schwarzen Amerika auch sonst ein hochinteressantes Pop-Jahr: Die Jackson 5 gewannen die legendäre Amateurnacht im Apollo Theatre in Harlem, woraufhin Gladys Knight sie bei Motown empfahl, Michael Jackson war da gerade mal neun Jahre alt; James Brown nahm seine Single „Cold Sweat“ auf, die heute als Blaupause des Funk gilt, weil Brown in ihr erstmals das zwölftaktige Standard-Blues-Schema hinter sich ließ, sämtliche Instrumente perkussiv einsetzte und den Schlagzeuger ein Solo trommeln ließ – die sogenannten Breaks wurden später elementar für Hip-Hop, in gesampelter Form.
Um all dies geht es in „Younger Than Yesterday – 1967 als Schaltjahr des Pop“ also nicht, und vielleicht stößt dies auch deswegen so auf, weil im Beitrag zu Jimi Hendrix an keiner einzigen Stelle erwähnt wird, dass Hendrix Afroamerikaner war.
Eine demonstrative Farbenblindheit, die sich möglicherweise antirassistisch dünkt, aber doch grob fahrlässig ist. Schließlich waren, wie der amerikanische Autor Jack Hamilton im vergangenen Jahr in seinem viel beachteten Buch „Just Around Midnight – Rock and Roll and The Racial Imagination“ in den Blick genommen hat, die Sechzigerjahre das Jahrzehnt, in dem sich aus dem zuvor stark schwarz geprägten Rock ’n’ Roll via einer seltsamen Re-Segregation eine sehr weiße Sache entwickelte: Rock. Mit dem Ergebnis, dass Hendrix quasi als Exot dastand. Fragen der kulturellen Aneignung oder Enteignung, oder auch Fragen nach dem Stand der Frau in der Popmusik der Zeit – all diese Diskurse werden in dem Buch nicht mal gestreift.
Die Herausgeber Gerhard Kaiser, Christoph Jürgensen und Antonius Weixler waren umsichtig genug, in ihrem Vorwort einen Spoiler Alert einzubauen: Freilich sei mit ihrer „Auswahl die Popgeschichte des Jahres 1967 nicht erschöpfend erzählt“, schreiben sie, und über die Auswahl könne „man gewiss stundenlang diskutieren“. Ja, man müsste es sogar.
Antonius Weixler, Gerhard Kaiser, Christoph Jürgensen (Hrsg.): Younger Than Yesterday. 1967 als Schaltjahr des Pop. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2017. 256 Seiten, 24 Euro.
Zur höchsten Kunstform des Pop
entwickelte sich das
Format Album im Konzept-Album
Aus dem zuvor stark schwarz
geprägten Rock ’n’ Roll entwickelte
sich eine sehr weiße Sache: Rock
Juni 1967, Jimi Hendrix beim Monterey Pop Festival. Im Beitrag des Sammelbandes über Jimi Hendrix herrscht demonstrative Farbenblindheit: Dass Hendrix Afroamerikaner war, wird nicht erwähnt.
Foto: Bruce Fleming / AP Images
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de