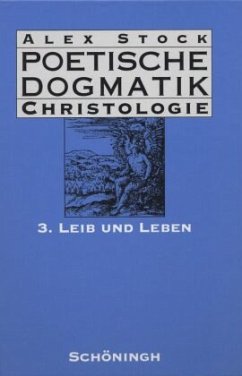Produktdetails
- Poetische Dogmatik: Christologie 3
- Verlag: Brill Schöningh / Verlag Ferdinand Schöningh
- 1998
- Seitenzahl: 462
- Deutsch
- Abmessung: 233mm x 157mm x 41mm
- Gewicht: 917g
- ISBN-13: 9783506788337
- ISBN-10: 3506788337
- Artikelnr.: 07709396

Altes katholisches Liedgut, einmalig: Die überlieferten Formen der kirchlichen Feier ziehen wieder mehr Gläubige und sogar Theologen an
In vielen Städten Süddeutschlands werden für Fronleichnamsprozessionen neuerdings wieder Durchgangsstraßen gesperrt. Tausende von Gläubigen und Neugierigen ziehen singend, betend und staunend zu den Straßenaltären, bewundern die liebevollen Blumenarrangements und erfreuen sich am virtuosen Umgang der Messdiener mit dem qualmenden Weihrauchfass, der in einem beherzten Kopfüberschwung kulminiert. So manchem kritischen Theologen stockt da der Atem. Sind alle Versuche, das Kirchenvolk zu einer besonnenen Frömmigkeit zu erziehen, gescheitert? Gehen in solchen religiösen Praktiken gar die ökumenischen Bemühungen mitsamt ihren theologischen Konsensformeln in (Weih-)Rauch auf? Oder ist es einfach nach Jahrzehnten pädagogischer Ernüchterung wieder an der Zeit, das Exotische im Eigenen, den Zauber des Rituals und das befremdende Wunder religiöser Formen zu entdecken?
In Mitteleuropa spricht nicht das Geringste für das Wiederaufleben eines aggressiven Konfessionalismus. Es scheint vielmehr, als habe das spätmoderne Interesse an Riten und Rhythmen, Feier und Kult, an einer "Ästhetik der Existenz" (Foucault) nun auch die Kirche erfasst, die gerade dabei war, sich in den Ruinen der Tradition einzurichten, versehen mit einer Notration des Glaubens, die aus einer Hand voll Imperativen, ein paar verschonten Zeremonien und der Erinnerung an ein historisches Vorbild namens Jesus aus Nazareth bestand.
Auch wenn sich Zeitgeist und Heiliger Geist oft nur schwer auseinander halten lassen, wäre es vielleicht zu einfach, das Interesse an Liturgie als eine Laune der Spaßgesellschaft verächtlich zu machen, die nicht nur schöner wohnen und essen, sondern auch schöner glauben und kulten will. Nach Jahrzehnten, in denen es für viele Theologen galt, die Welt zu verändern, und jede Beschäftigung mit dem "Religiösen" als reaktionär galt, scheint sich allmählich die Einsicht durchzusetzen, dass (kirchen-)politisches Engagement und Arbeit an spirituell-ästhetischen Ausdrucksformen keine unversöhnlichen Gegensätze darstellen müssen, dass sie vielmehr aus derselben Quelle des Glaubens gespeist werden. Dieser Quelle, "aus der all ihre Kraft strömt", wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, versichert sich die Kirche jedoch nicht in erster Linie in intersubjektivem Austausch, in Meetings und Diskussionen, sondern in kultischer "Realisation". Insofern bleibt Liturgie, besonders die Eucharistie, jeder politischen und sozialen Caritas zwar nicht über-, aber "wesensmäßig" vorgeordnet.
An theologischen Fakultäten erfreut sich die lange marginalisierte Liturgiewissenschaft, ganz wie es das Konzil empfahl, vereinzelt wieder der Hochschätzung eines theologischen Hauptfachs. Auch die Systematische Theologie hat begonnen, die Liturgie nicht länger als Anwendungsdisziplin zu betrachten, sondern "als Quelle theologischer Erkenntnis". Exemplarisch sind die "poetisch-dogmatischen" Werke des Kölner Theologen Alex Stock, die, inspiriert von jüdischer Religionsphilosophie, versuchen, "der liturgischen Gestaltung der religiösen Wirklichkeiten ihr Geheimnis abzuhören" (Scholem). Dieser lebensweltliche Ansatz zählt die Liturgie in ihren offiziellen und halb offiziellen Spielarten zu den im weiteren Sinne "poetischen" Quellen des Christentums. In Liedern, Bildern, Messformularen und Gebeten äußert sich für Stock eine außerordentliche "kulturelle Kreativität", die weniger auf zupackende Bekenntnisse aus ist als darauf, in ebenso vorläufigen wie gültigen Formen religiöse Erfahrung zu artikulieren.
Auch wenn Stocks Arbeiten kaum beanspruchen, pastoralliturgische Impulse für die heutige Gottesdienstpraxis zu geben, so sind sie doch insofern paradigmatisch und richtungweisend, als sie von einem so großen wie distanzierten Wohlwollen gegenüber der Tradition und tiefer Einsicht in die Ästhetik der Liturgie geprägt sind. Aus welcher Zeit und aus welchem Kulturkreis Texte, Lieder oder Bilder auch stammen, ihnen wird, ohne dass sie auf einen aktuellen Sinn hin "erpresst" werden, zugetraut, Auskunft zu geben "zu Dingen, die uns beschäftigen". Mit der an Liturgie (und Kunst) geschulten Methode, Disparates nebeneinander zu dulden, wo es sich zu einer einleuchtenden Konstellation zusammenfügt, gelingt es Stock, "die Überlieferung zur Mitsprache zu bewegen". Der Verbindlichkeitsgrad dieses Vorgehens bemisst sich nicht so sehr nach objektivierbaren Glaubensformeln als nach den schwerer fassbaren Kriterien künstlerischer Evidenz. Solches Erkenntnisinteresse verlegt sich aufs Streunen, Sammeln und Finden von "Überflüssigem" und begnügt sich nicht mit dem vermeintlich "Wesentlichen". Theologische Einsicht erwächst nach Stocks Überzeugung nicht allein aus dem rechten Gebrauch der kanonisierten Texte und Symbole, sondern ebenso aus dem schöpferischen Wildwuchs halb- und inoffizieller Überlieferungen. Nicht alles, was so zutage gefördert wird, muss betroffen machen, aber vieles neugierig. "Ergriffenheit" stellt sich beim Leser unvermittelt von selbst ein, etwa wenn Stock die Erscheinung des auferstandenen Christus vor Maria Magdalena (Joh. 20) mit Hilfe mittelalterlicher Bilder und Referenztexte als eine erotisch konnotierte "Geschichte erregter Körperbewegungen" nachzeichnet; oder in der Ausdeutung einer fragmentarisch überlieferten "Herz Jesu"-Predigt des englischen Dichters Gerald M. Hopkins, die dieser 1881 in der Industriestadt Liverpool gehalten hat.
Dezidiert kulturhistorisch ausgerichtet ist das Buch des Paderborner Alttestamentlers und Religionswissenschaftlers Bernhard Lang. In Lobpreis, Bittgebet, Predigt, Opfer, Sakrament und geistlicher Ekstase erblickt Lang die sechs "rituellen Grundgestalten" des christlichen Gottesdienstes, die mit Ausnahme der Predigt "alle im kultischen Leben der vor- und außerchristlichen Antike wurzeln". Zur Schönheit und Tiefe eines kultischen Geschehens gehört für Lang stets eine gewisse Rätselhaftigkeit. Denn er begreift Liturgie als ein Geschehen, das niemals in seiner Funktion als gesellschaftliches Ereignis aufgehen kann, ohne in die Gefahr zu geraten, sich überflüssig zu machen, Gottesdienst als "heiliges Spiel" vor dem Herrn beziehe sich primär "auf das Göttliche".
Man muss es nicht als Manko ansehen, dass sich der Theologe Lang ganz auf die Kulturhistorie und auf das Aufzeigen anthropologischer Grundmuster verlegt und den Wahrheitsanspruch, der sich in der Liturgie ausspricht, lediglich referiert. Die hermeneutische Bedeutsamkeit gottesdienstlicher Formen für die menschliche Existenz kommt in Langs umfangreicher Bestandsaufnahme ungeschmälert zum Ausdruck. Lang hütet sich davor, auf Schritt und Tritt zu affirmieren oder zu verwerfen. Die Freiheit des Historikers von den angeblichen Erfordernissen "heutiger Gemeinde" begünstigt eine Sichtweise, die die Liturgie auch in ihren zunächst verschroben und befremdend wirkenden Ausdrucksformen erst einmal würdigt als ein ernstes und niemals beliebiges Spiel mit den Formen der Deutung menschlichen Lebens. Dabei wird deutlich, dass ästhetische Gestalt und religiöser Gehalt nicht voneinander zu trennen sind. Eine Umwälzung liturgischer Formen hat stets Konsequenzen für die Inhalte, für Gottes- und Menschenbilder und für die Erfahrung. Diese Erkenntnis der Kunst- und Kulturgeschichte kann, so schlicht sie sein mag, in manchen kirchlichen Kreisen, die dazu neigen, Liturgie ausschließlich als Werkstatt für Selbermacher zu begreifen, nicht genug betont werden.
Theologisch betrachtet gerät die kulturgeschichtliche Betrachtungsweise an Grenzen. Langs Rede vom Abendmahl als "magischem Ritual" mag aus religionswissenschaftlicher Außenperspektive zutreffend sein, aus der Sicht eines Theologen, der seine Disziplin als "Glaubenswissenschaft" versteht, ist der Begriff unzureichend. "Magisch" kann die Eucharistie nur für den distanzierten Beobachter sein, der geneigt ist, die Einsetzungsworte des Priesters für Zauberformeln zu halten. Für den Mitfeiernden realisiert sich dagegen ein göttliches Versprechen: die Vergegenwärtigung des Lebens, Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi in den Gestalten von Brot und Wein, kurz: "die wahrhafte Präsenz Gottes unter den Menschen" (Josef Pieper). Die Initiative dazu liegt nicht zuerst in "theurgischen" Begabungen des Menschen oder in klerikaler Eigenmacht, sondern in göttlicher Zusage. Eine angemessene theologische Reflexion der verschiedenen christlichen Gottesdienstformen wird also von diesem (eucharistischen) Zentrum ausgehen müssen, um den entscheidenden Perspektivwechsel vorzubereiten: Autor des von Menschenhand geschaffenen Kunstwerkes Liturgie ist Gott selbst.
Kulturhistorische Verfahren können, wie Lang zeigt, zu dieser Mitte christlicher Liturgie hinführen, sie umspielen und umkreisen. Damit leisten sie dem liturgischen Verständnis oftmals größere Dienste als einzelne liturgiewissenschaftliche Arbeiten, die sich so sehr dem "Geist" des Zweiten Vatikanischen Konzils überlassen, dass es ihnen auf dessen Wortlaut kaum noch ankommt. Mit Hilfe von Handlungs- und Spieltheorien, Sozialpragmatik und Diskursethik wird versucht, Liturgie zu einer "Sache des Volkes" zu machen, wie es Jesus und dem Konzil angeblich vorschwebte.
Für Werner Hahne, der Liturgiewissenschaft vor allem als Erfahrungswissenschaft begreift, sollen Christen im "komplexen Kommunikationsgeschehen" des Gottesdienstes vor allem ihre Identität finden. Um die Reformen des Konzils, die ausschließlich vom Klerus ausgegangen und daher in Halbheiten stecken geblieben seien, voranzutreiben, müsse der Gottesdienst einem "zeitgemäßen Subjekt- und Praxisverständnis" angepasst werden, das an die Gemeindemodelle der Urkirche anknüpft. Alle sind zugleich Laien und Priester und gestalten die gemeinsame Versammlung in "freiem und schöpferischem Tun". Gottesdienst dürfe nicht länger dem Klerus überlassen bleiben, sondern müsse den Menschen in ihrer "dreifaltigen Ich-Du-Wir-Beziehung" gerecht werden und eine "ideale Kommunikationsgemeinschaft" antizipieren. Zwar spricht auch Hahne gelegentlich vom Gottesdienst als einer "heiligen Handlung, deren "primäres Subjekt" Gott sei, doch wird das weder weitergedacht noch ausgeführt, als handele es sich lediglich um eine Marginalie.
Hahnes Reflexionen atmen den Geist der siebziger Jahre, der sich, gesellschaftlich gesehen, schon etwas verflüchtigt haben mag. Hier darf er noch als neu und fortschrittlich gelten. Nicht nur die Reaktion, auch der "Fortschritt" schreitet eben im kirchlichen Milieu etwas verhaltener als andernorts. Hahne betreibt zum einen eine radikale Versachlichung religiöser Sprache, indem er sakrale Begriffe wie Kult, Opfer, Mysterium restlos in diskursethisches Vokabular zu überführen sucht. Zum anderen ermuntert er nachdrücklich zum Äußern persönlicher Anliegen und Gefühle im Gottesdienst. Das "Erhebet die Herzen" des eucharistischen Hochgebets wird zum "Schüttet eure Herzen aus!" Liturgie oszilliert zwischen Spielwiese, Talkshow, Gruppentherapie und Parlament. Hier können sich alle "einbringen", tanzend, singend, diskutierend. Hahne findet es ganz in Ordnung, wenn im Gottesdienst Einzelne vor der Gemeinde ihre Konflikte austragen. Schön wär's, wenn sie sich auch gleich versöhnen könnten. Muss aber nicht sein. Schließlich soll Kirche sich "auf das Leben einlassen, wie es nun einmal ist".
"Die Liturgie ist Selbstausdruck des Menschen, aber des Menschen, wie er sein soll. Philisterei wäre es, nur das anzuerkennen, wozu eigenes Maß und die begrenzte Kraft reichen", schrieb 1923 Romano Guardini, der wusste, wohin man gerät, wenn die theologische Reflexion mit der liturgischen Bewegtheit nicht Schritt halten kann. Hahne verhehlt nicht, dass er mit Guardinis Auffassung von der "Objektivität der Liturgie", die nicht einfach die Summe der hergestellten Subjektivität ist, wenig anfangen kann. Für den Praxistheoretiker ist kein objektives, allenfalls noch "intersubjektiv und gesellschaftlich" Teilbares vorstellbar.
Das Buch des Freiburger Akademieleiters Harald Schützeichel hat in dieser Hinsicht kaum mehr zu bieten. Seine Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft ("totalitäre Diktatur des Marktes") ist ebenso dürftig wie seine Theologie. Schützeichel geißelt die Medienwelt, in der alles von Quantitäten und Quoten abhängt, findet aber andererseits die sinkende "Quote" der Gottesdienstbesucher bezeichnend für die Unfähigkeit der Kirche, sich zeitgemäß zu präsentieren. Auch er sieht in der Urgemeinde eine ideale Kommunikationsgemeinschaft, die von einer hierarchisch verfassten männerdominierten Kirche abgelöst wurde. Irgendwann am Ende des ersten Jahrhunderts beginnt für Schützeichel das Mittelalter, das natürlich meist finster ist, und endet erst mit dem Zweiten Vatikanum.
Man stellt bei Schützeichel ein reflexartiges Schäumen fest, wenn die Rede auf die Amtskirche, auf Hierarchie und Priestertum kommt. Begriffe wie Priester und Messe werden, wie die DDR einst in der Springer-Presse, generell zwischen An- und Abführungen gesetzt. Ohne weitere Diskussion, als müsse ein Denkverbot verhängt werden, wird die Rede vom "Messopfer" als theologische Fehldeutung abserviert. Nur noch das Wort "Feier" erscheint dem Autor theologisch korrekt, wobei er sich ausdrücklich auf das Zweite Vatikanum beruft, das den Gottesdienst "durchgehend als Feier" bezeichne. Beim Nachlesen stellt man allerdings fest, dass die entsprechenden Artikel der Liturgiekonstitution ausdrücklich und nicht nur nebenbei von der Liturgie als einer "hierarchischen und gemeinschaftlichen Handlung" sprechen sowie vom "Opfer der Messe", vom "heiligen Opfer der Eucharistie" und der "Feier der heiligen Mysterien".
Schützeichels Buch ist von frappanter Detailkenntnis und enthält bedenkenswerte Anstöße für die liturgische Praxis, etwa für das Tageszeitengebet in den Gemeinden. Doch wie Hahnes Ausführungen lebt es sehr stark vom Fortschrittsgeist von gestern: in seiner Ignoranz gegenüber den Zusammenhängen von "Sakralität" und Ästhetik, in seinem überheblichen und daher unproduktiven Umgang mit der Tradition und in seiner Neigung, überkommenen liturgischen Formen pauschal ihre spirituelle Bedeutung abzusprechen.
Eine Communio-Theologie nach Schützeichels Vorstellungen ist überdies nicht gefeit gegen ideologische und repressive Momente. Nicht nur, dass in der Rundkirchengemeinde sich jeder wie in einem therapeutischen Setting der permanenten Beobachtung der "Gemeinde" ausgesetzt sieht. In Schützeichels Modell der "Feier der Versöhnung", das Sündenvergebung als therapeutischen Prozess interpretiert, tritt an die Stelle der amtlich verwalteten Ohrenbeichte eine "Rekonziliation" mit der Gemeinschaft, die nach einem öffentlichen Schuldbekenntnis des Einzelnen im Gemeindegottesdienst vollzogen wird. Auch Hahne spricht von der "Pflicht des Volkes", im Gottesdienst seine Subjektwerdung zu zelebrieren. Alle sind nicht nur eingeladen, sondern aufgefordert, und niemand darf "abblocken" (Hahne). Rückzug, Unaufmerksamkeit, Absencen, womöglich ein Nickerchen während des Predigtgespräches müssten als schwere Sünde wider den Geist der Gemeinschaft geahndet werden.
In diesen Ansätzen steckt der Teufel nicht erst im Detail, sondern schon im Fundament: Wer Liturgie wie Hahne und Schützeichel vor allem als "Versammlung" versteht, betreibt nicht nur rhetorische Ausnüchterung. Indem er "die Gemeinschaft zum direkten Zweck erhebt", löst er "ihre Fundamente" auf (Ratzinger). Ohne Sinn für Gewachsenes und Verwachsenes, für Kurioses und Geheimnisvolles, ohne Behutsamkeit im Prüfen und Verändern wird man der Liturgie und damit auch den feiernden Menschen nicht gerecht werden. Denn, wie Stock formuliert, "im hermeneutischen Haushalt der christlichen Religion endet das aktuell schwer Verwendbare nicht einfach auf der Müllhalde des Weltgeistes. Arbeit des Gedankens, die mehr sein will als rhetorische Stärkung der zeitgenössischen Opinio communis, lässt das vom herrschenden Bewusstsein einer Zeit Zurückgestellte nicht einfach als das Überholte hinter sich, sondern begreift es als Terra incognita neuer Entdeckungen. Nicht, dass man zu ihm schlicht zurückkehren könnte oder sollte, sondern dass man an seiner Fremdheit bedenkt, was dem Geist der eigenen Zeit entgeht."
Man kann die Gläubigen im Sinne des Konzils durchaus als "Subjekte der Liturgie" begreifen, ohne in (Inter-)Subjektivismus zu verfallen. Das zeigt der "mystagogische" Ansatz des Bonner Dogmatikers Josef Wohlmuth, der betont, dass sich Liturgie nicht in erster Linie handlungstheoretisch oder diskursethisch, sondern vor allem theologisch rechtfertigen muss. Zwar ist auch für Wohlmuth die soziale Praxis der "Testfall der Ernsthaftigkeit einer liturgischen Ästhetik". Doch darf dies nicht im Sinne einer "engagierten Kunst" verstanden werden. Ihre das Ethische erst konstituierenden Charakter erhält Liturgie gerade durch das Heraustreten aus dem Reich der Zwecke. Wohlmuth ist überzeugt, dass Liturgie zu den tiefsten Quellen des Glaubens führen, ja dass von ihr so etwas wie "Erleuchtung" ausgehen kann, wenn sie ein Ort der Beunruhigung bleibt und sich nicht einseitig auf das Befriedigen religiöser Bedürfnisse verlegt. Liturgie wird vielmehr erst dann "unsere ureigenste Sache, wenn sie die Sache jenes Anderen bleibt". Nur in den herben Wahrheiten und Verheißungen der Christologie findet Liturgie ihr angemessenes Korrektiv und ihr Kriterium, um sich weder in ein Forum politischer Agitation noch in fromme Operette aufzulösen. Ihre soziale und kritische Funktion erfüllt sie weniger durch Appelle und explizite Handlungsimpulse als durch die zweckfreie "Inszenierung der Wahrheit". Im Anschluss an Franz Rosenzweig bezeichnet Wohlmuth den Kult als eine Feier der Unterbrechung des historischen Zeitkontinuums. In der ästhetischen Inszenierung sakral "qualifizierter Zeit" entsteht so etwas wie eine Schnittstelle von Zeit und Ewigkeit. Kraft ihrer der Subjektivität teilweise entzogenen Gestalt und in ihrer unbedingten Verwiesenheit auf einen Anderen, auf Tod und Auferstehung Jesu, führt Liturgie in die Mysterien des Glaubens ein.
Veränderungen an der "Partitur" der Liturgie sollten, so Wohlmuth, mit größter Behutsamkeit und Präzision vorgenommen werden. Er beklagt, dass viele liturgische Nachdichtungen weder den Vergleich mit der liturgischen Sprachtradition noch mit zeitgenössischer Literatur aufnehmen können. Mit folkloristischer Dekoration und der Unterhaltungsindustrie entlehnten Stimmungselementen werde Zeitgenossenschaft eher simuliert als realisiert. Wohlmuth beklagt zu Recht auch die Reserve liturgischer Praxis gegenüber den "neuen Seh- und Hörmöglichkeiten" der modernen Kunst und der neuen Musik.
Wer Liturgie als mystagogisches Geschehen begreife, als Einführung in die geheimnisvolle Wahrheit des Glaubens, komme nicht umhin, auch "die ,passive' Rolle in der Liturgie zu lernen". Denn vor allen Fragen der Gottesdienstgestaltung und der subjektiven Partizipation müsse präzisiert werden, auf welcher Art von Subjekthaftigkeit Liturgie basiere. Der Mensch, der sich im Raum "heiliger Zeichen" bewegt, ist, ob Priester oder Laie, primär ein "Subjekt des empfangenden Glaubens".
CHRISTIAN SCHULER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main