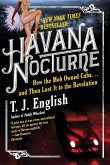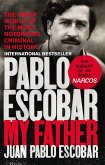Die Debatte um Drogenkonsum und dessen Bekämpfung hat Konjunktur. Timo Bonengel zeichnet die Geschichte der Drogenpolitik in den USA nach, die sich in den 1980er Jahren von wohlfahrtsstaatlichen Strategien in eine konservative, auf Abschreckung und Bestrafung setzende Sozialpolitik verwandelte. Das Buch zeigt, dass der »War on Drugs« auch mithilfe von wissenschaftlichen Expert_innen geführt wurde und dennoch ethnische Minderheiten und arme Menschen diskriminierte. Damit problematisiert die Studie Forderungen nach einer wissenschaftsbasierten und deshalb angeblich gerechten Drogenpolitik.

Eine historische Analyse der amerikanischen Drogenpolitik über mehrere Jahrzehnte
Die Vereinigten Staaten mussten in ihrer Geschichte viele Kriege führen, der gegen den internationalen Terrorismus nach dem 11. September gilt gemeinhin als der längste. Der wirklich längste ist allerdings ein "Krieg" genannter Kampf im Inneren. So sind in dem Land allein 2017 mehr als 70 000 Menschen durch Drogenmissbrauch ums Leben gekommen. Der Drogenkrieg wütet immer härter. Derzeit gelten zwischen einer halben und einer Million Amerikaner als heroinabhängig, mehr als 11 Millionen sollen abhängig von Schmerzmitteln sein. Der Historiker Timo Bonengel hat vor diesem Hintergrund im Rahmen seiner Erfurter Dissertationsschrift eine Analyse des "War on Drugs" von den 1960er bis in die frühen 1990er Jahre vorgelegt. Er unterstreicht, dass die amerikanische Drogenpolitik im Untersuchungszeitraum immer in sehr enger Verbindung zu gesellschaftlichen Diskursen um Armut, Verbrechen und ethnische Minderheiten stand.
Bonengels Anspruch ist gewaltig. Er zielt auf nichts weniger als auf eine "systematische historische Analyse des modernen ,War on Drugs' als Sozial- und Gesundheitspolitik". Dass er diesen Anspruch nur teilweise einlösen kann, ist für eine Dissertation nicht ungewöhnlich. Zum Ritual solcher Schriften gehört es heutzutage offensichtlich, auch theoretische Rahmen zu setzen, die dann empirisch oft nicht ausgefüllt werden können. In diesem Fall ist es der Rekurs auf Michel Foucault und dessen Machtbegriff, ohne den die Arbeit - nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen und gewinnbringenden Archivrecherchen in den Vereinigten Staaten - auch gut ausgekommen wäre. Bonengels Buch enthält gleichwohl viel Interessantes und Lesenswertes. Dazu gehört die Zusammenarbeit von Strafverfolgungs- und Gesundheitsbehörden sowie Gesundheitsexperten zu Beginn des "War on Drugs", eines Krieges, den Präsident Richard Nixon 1971 ausgerufen hatte. Für Nixon war der Drogenmissbrauch Amerikas "Staatsfeind Nummer eins", und das zu einer Zeit, in der der Vietnam-Krieg unvermindert tobte und die amerikanische Gesellschaft zutiefst spaltete.
Rückte der 37. Präsident vor allem die konsequente Strafverfolgung in der Drogenpolitik in den Vordergrund seiner Strategie, so bemühten sich seine Amtsnachfolger Gerald Ford und dann der Demokrat Jimmy Carter im Weißen Haus um Entkriminalisierung und Liberalisierung. Das bezog sich vor allem auf den Konsum von Marihuana. Dabei spielten drogenpolitische Berater im Weißen Haus wie der Psychiater Peter Bourne eine maßgebliche Rolle. Eine Veränderung im Diskurs stellte sich ein. So wurde der Konsum von Marihuana "entkriminalisiert". Auf der Ebene der Einzelstaaten hatte Oregon 1973 den Anfang gemacht und den Besitz geringer Mengen Marihuanas quasi legalisiert. Es folgten bis 1978 elf weitere Bundesstaaten von Colorado über Ohio, Alaska, Kalifornien, Maine, Minnesota, South Dakota, Mississippi, New York, North Carolina und Nebraska.
Auch Kokain galt vorübergehend als quasi "beherrschbar", weil wissenschaftliche Experten die vornehmlich weißen Konsumenten aus der Mittel- und Oberschicht in ihrem Drogenkonsum vielerorts als "fähig zur Selbstführung" einschätzten. Eine gewisse "Permissivität" machte sich nach Bonengel breit. Von ,kontrolliertem' Drogenkonsum war nun mancherorts die Rede. Der "rehabilitative Wohlfahrtsstaat" wurde beschworen, Indiz für die "soziokulturelle Dimension" von "Bedeutungszuschreibungen" in der Drogenpolitik, wie der Autor festhält. Gleichwohl ließ die Strafverfolgung des Drogenmissbrauchs nicht nach.
Davon waren nach Bonengel aber vor allem die in "prekären Verhältnissen lebenden ethnischen Minderheiten in den Großstädten" betroffen. Mit der Präsidentschaft des Republikaners Ronald Reagan, der Carter 1981 nachfolgte, ging ein Paradigmenwechsel in der Politik der Drogenbekämpfung einher. Befördert durch Reagans drogenpolitischen Berater Carlton Turner, rückten fortan präventive Strategien in den Vordergrund. Bonengel spricht von "disziplinierenden Regierungstechniken". Diese betonten die Bedeutung von Abschreckung und "null Toleranz", und sie rückten das Individuum verstärkt in den Vordergrund der bundespolitischen Aufmerksamkeit. "Statt sozialer Umstände und struktureller Faktoren", formuliert der Autor, "machten diese Konzepte (...) das Individuum selbst verantwortlich für seine Lebensführung, für Krankheit oder Gesundheit, für Armut und Verbrechen." Der "rehabilitative Sozialstaat" wurde in Frage gestellt. Ob dies nun ein "konservativer Backlash" war, sei dahingestellt. Auf jeden Fall rückten nun die Orte der Drogenprävention in den Vordergrund. Dazu zählen die Familie, die Schule und der Arbeitsplatz.
Nach Bonengel wurde die Drogenpolitik zum Ende der 1980er Jahre zunehmend strafender. Das Paradigma des "tough on drug criminals" wurde 1989 allerdings nicht nur von Reagans Nachfolger George H. W. Bush propagiert, sondern auch von der demokratischen Opposition und insbesondere vom damaligen Senator Joseph Biden. Der Demokrat, der sich heute anschickt, Präsidentschaftskandidat seiner Partei 2020 zu werden, erklärte damals: "We don't oppose the President's plan. All we want to do is strenghten it. (...) Quite frankly, the President's plan is not tough enough, bold enough, or imaginative enough to meet the crisis at hand." Heute überschwemmen unter anderem Crack und Opioide wie Fentanyl den amerikanischen Drogenmarkt. Es wäre sicher spannend, wenn sich Bonengel in einer weiteren historischen Studie der Drogenpolitik und den damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen für die Vereinigten Staaten bis in die Jetztzeit zuwenden würde.
JÜRGEN WILZEWSKI
Timo Bonengel: Riskante Substanzen. Der "War on Drugs" in den USA (1963-1992).
Campus Verlag, Frankfurt/New York 2020. 433 S., 45,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Bonengels Buch enthält [...] viel Interessantes und Lesenswertes.« Jürgen Wilzewski, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.06.2020»Timo Bonengel hat mit 'Riskante Substanzen' eine äußerst lesenswerte Studie zum 'War on Drugs' vorgelegt, die das Wissen über Drogenpolitiken in den USA für den Zeitraum von den frühen 1960er- bis in die frühen 1990er-Jahre bereichert. Zudem trägt das Buch zum historischen Verständnis gegenwärtiger (rassistischer) Drogendiskurse in den USA bei.« Kristoff Kerl, H-Soz-Kult, 12.10.2020»Diese empirisch und analytisch reiche Studie leistet einen wichtigen Beitrag zur hochaktuellen Debatte um die amerikanische Drogenpolitik und lädt nicht zuletzt ein, die gegenwärtige Opioid Crisis an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft zu analysieren und zu historisieren. Der Blick auf sozial- und gesundheitspolitische Aspekte zeigt, wie zentral medizinische und soziale Debatten waren, und legt die Zusammenhänge gesundheitspolitischer Diskurse mit sozialen Ordnungsvorstellungen und rassistischen Denkmustern frei.« Andrea Wiegeshoff, Sehepunkte, 15.01.2022