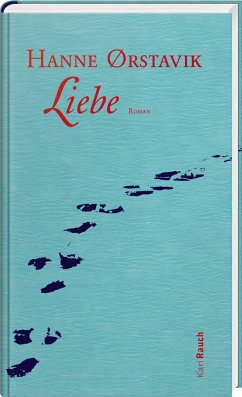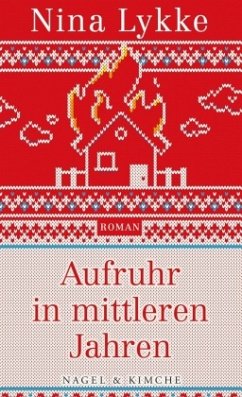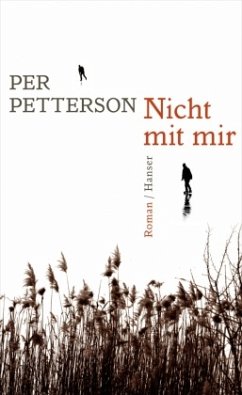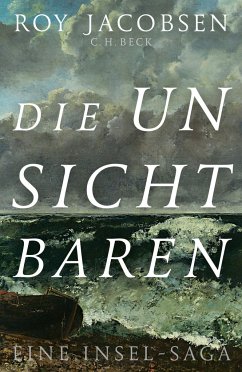norwegischen Schriftstellers Erik Fosnes Hansen, seinen Roman "Das Löwenmädchen" um die Biographie eines schlussendlich bei einer solchen Wandertruppe Zuflucht suchenden Menschen herum zu konstruieren, in einer guten Tradition.
Indem Fosnes Hansen den Leser gleich auf den ersten Textbögen hinter den Vorhang einer Jahrmarktsbühne plaziert und mit dem Reklamegepolter eines Ansagers alleinlässt, erscheint dieser Einfall allerdings auch als Wagnis: allzu nah dran am Klischee, allzu überfrachtet mit falscher Nostalgie. Mit einem ähnlichen Kunstgriff indes hat es Erik Fosnes Hansen vor anderthalb Jahrzehnten zu Ruhm gebracht, mit der Geschichte von den Musikern an Bord der "Titanic". Schon der Titel dieses anspruchsvoll konstruierten und elegant erzählten Schmökers zeugte von der mondlichternen, religiös angehauchten Romantik, dank deren sich das Buch eine Million Mal verkaufte: der "Choral am Ende der Reise".
Man mag es Fosnes Hansen also nachsehen, dass er abermals den Balanceakt versucht über den Abgründen des Kitsches. Man mag es sogar begrüßen. Denn was wären Literatur und Film ohne die großen Traumpanoramen, ohne die Poesie, ohne jene Klassiker, die den Leser mitnehmen in ferne, abseits der Fiktion längst verblasste Zeiten. Aber es ist und bleibt eben nicht ohne Risiko, derart bewusst der Poesie nachzustreben. Und das weiß auch Erik Fosnes Hansen. Er weiß es spätestens, seit sein geplanter Mehrteiler "Momente der Geborgenheit" in einer Schreibblockade endete und Fragment blieb.
Im "Löwenmädchen" ist von einem Journalisten die Rede, einem Mann, der Hansen heißt, so wie sein Autor. Er habe von der "Titanic" berichtet, heißt es, als "befinde man sich selbst an Bord". Er verfügt "über eine sehr ordentliche Begabung als Zeichner, vielleicht überstieg sie seine journalistischen Fähigkeiten", und er hat ein deutliches Gespür für die Poesie: "Die Sterne. Die Nacht. Der Eisberg." Er sucht nach etwas Vergleichbarem, einem ähnlich packenden, ähnlich mitreißenden Sujet. Diese Geschichte könnte es sein. Sie beginnt noch im Jahr der Titanic-Katastrophe, mit einer schwierigen Geburt, mit dampfenden Eisenbahnen, mit leisen Choralgesängen und blauwabernden Nordlichtern am Himmel.
Ist Eva Mensch, ist Eva Tier? Das Kind jedenfalls, das die Frau des Stationswärters Arctander in jener Dezembernacht zur Welt bringt, auf dem Rückweg vom Kirchenchor und mit letzter Kraft, als habe der Lärm der Moderne sie im Innersten zerrissen, ist über und über mit blonden Haaren bedeckt, und das selbst im Gesicht. Nicht anders als im 16. Jahrhundert Pedro Konsalez, der keineswegs "wilde Mann von Teneriffa", dessen Schicksal der Kunsthistoriker Roberto Zapperi beschrieben hat, leidet das Kind an Hypotrichose: "Das Haar bedeckte seinen gesamtem Körper, langes, goldweißes, seidenweiches Haar, fast wie bei einer Langhaarkatze, nur noch weicher und feiner."
Auch der kleinen Eva wird ein Dasein als ewige Außenseiterin nicht erspart bleiben. Der Vater, als Stationswärter gewissermaßen von Amts wegen her die Ordnung der Dinge gewohnt, ein penibler, am seelischen Innenleben seiner Tochter zunächst eher desinteressierter Homo Faber, weiß sich in seinem Schock nicht anders zu helfen, als das "Löwenmädchen" vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Und Eva wiederum, klug, freundlich, wissbegierig, entflieht in die einzige Richtung, die ihr zur Entfaltung und Verarbeitung geblieben ist: in ihr Innerstes. Als schließlich das beengte Leben in der norwegischen Provinz unerträglich wird, sie selbst Opfer einer Misshandlung, flieht Eva in die Ferne, zur Jahrmarkttruppe. Nicht viel anders scheint es einst Stephan Bibrowsky ergangen zu sein, der Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts unter dem Namen "Lionel, der Löwenmensch" durch Europa und Amerika tourte und sich dabei, Fosnes Hansen schlägt die Brücke in der ersten Szene des Romans, eine Biographie zulegte, die ganz den Erwartungen der verschiedenen Voyeure entsprach, den Gaffern ebenso wie den Wissenschaftlern.
Die Wissenschaftler: Womöglich sind sie es und ihr Versuch, Menschen wie Tiere zu klassifizieren, die Evas Ausgrenzung vorbereitet haben, die ihre Diskriminierung mit jedem Kongress vorantreiben - und doch keine Antworten haben auf die Frage nach dem Warum. So gesehen, erzählt Erik Fosnes Hansen abermals vom blinden Fortschrittsglauben, von der technisch-wissenschaftlichen Unterwerfung der Welt und der fortwährenden Macht der Natur. Auch von den Trieben und den Momenten, da das Tier im Menschen obsiegen will und manchmal darf: "Omne animal post coitum triste."
Vor allem aber erzählt er, in wechselnder Perspektive, erneut ein Märchen - mit traurigem Unterton und in einer Sprache, deren Dichte und dunkle Färbung bereits Kennzeichen des "Chorals am Ende der Reise" war; Hinrich Schmidt-Henkel, der derzeit wohl beste Übersetzer aus dem Norwegischen, hat sie umsichtig ins Deutsche übertragen. Das muss man mögen, das unausgesprochen Gleichnishafte ebenso wie die klischeehafte Ausstattung mit Stationsmeister und Redakteuren, Pfarrern und Apothekern, Wissenschaftlern und Telegraphisten, womit der Autor Evas Heranwachsen im norwegischen Abseits illustriert. Aber wenn man es mag: Dann ist "Das Löwenmädchen" ein guter, allenfalls etwas überhastet abgeschlossener Roman. Denn der Balanceakt gelingt, und Erik Fosnes Hansen erzielt gerade dadurch, dass er mit nostalgischen Klischees spielt, jene innere Spannung, ohne die ein Text keine Sogkraft erzielen kann. "Nur wer die Sehnsucht kennt", heißt es bei Goethe, "weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt von aller Freude, sehe ich ins Firmament nach jener Seite" - dem Kantor, der für Evas Mutter schwärmte, sind diese Zeilen und das Schicksal Mignons stets geläufig.
MATTHIAS HANNEMANN
Erik Fosnes Hansen: "Das Löwenmädchen". Roman. Aus dem Norwegischen übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel. Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2008. 400 Seiten, geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
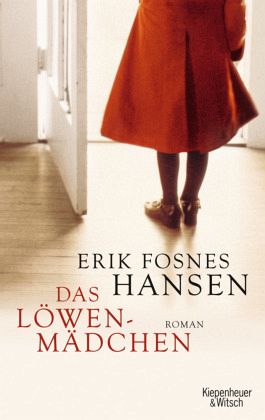



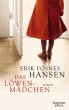

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.07.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.07.2008