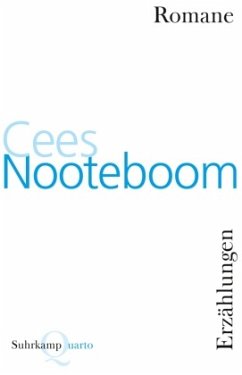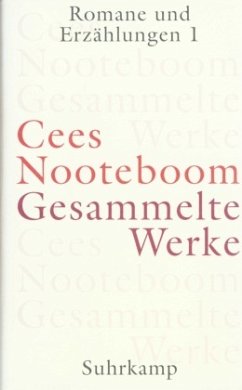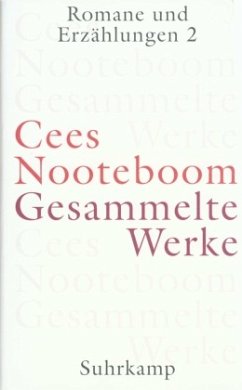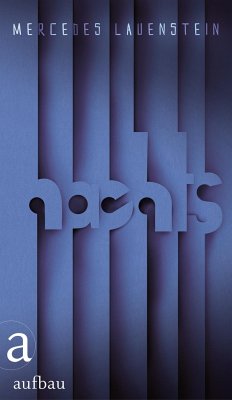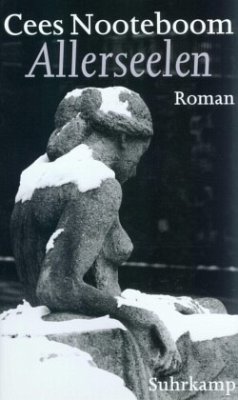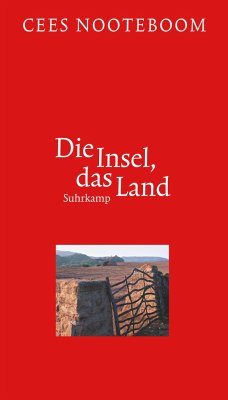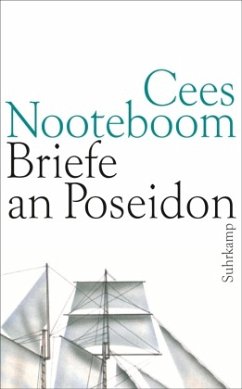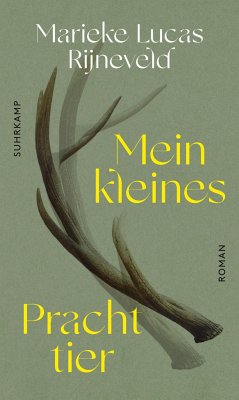Personal, für das sich Nooteboom interessiert: "Menschen, die verletzlich sind, verwundete Idioten, Frauen, die ihr Schicksal herausfordern, Ritter von der traurigen Gestalt, Männer, die vom Nimbus des Unglücks umgeben sind." Buchstäblich angefüllt sind sie von Schwarzgalligkeit; die "Spukgestalt der schwarzen Galle", so heißt es einmal, treibt sie unwiderruflich ihrem Ende entgegen.
Gleiches wird durch Gleiches erkannt. Der Erzähler, der gelegentlich erklärt, dass er außerordentlich wenig Lust habe, von sich zu sprechen, gehört natürlich dazu. Bald ist er, der das "Purgatorio", Plato und Chateaubriand liest, Herausgeber einer "teuren Zeitschrift", bald Holzfigurenschnitzer, bald freiberuflicher Kunstjournalist aus Amsterdam oder einfach gleich Schriftsteller mit freilich absonderlichen, mystischen Neigungen. Jedenfalls scheint er dazu verurteilt, die angekündigte Tragödie anderer zu beschreiben, wie eine Aasfliege womöglich, oder auch um jene Tragödie für sich selbst zu vermeiden - ein Zuschauer von Schiffbrüchen, der selbst nicht ganz in Sicherheit ist. Deshalb kommen ihm nachts die Füchse.
Gering ist auch seine poetische Macht. Keine Psychologie hilft ihm, in das Leben anderer einzudringen; verschlossen wie responsionslose Tieraugen umgeben ihn die Menschen, sosehr er von ihnen angezogen wird. "Ich weiß schon lange nicht mehr, was Menschen sind, aber die letzten tausend Jahre waren auf jeden Fall ein gewaltiger Striptease für die Gattung." Auch weiß er nicht recht, wie man daraus Geschichten formen soll, es sind Geschichten ohne Geschichte, die herauskommen, den schönen aristotelischen Regeln wollen sie nicht gehorchen - keine Einheiten von Ort, Zeit und Handlung, keine Struktur mit Anfang, Mitte und Ende, keine Verdickung oder Verdichtung. Das Leben ist anders, nicht kunstmäßig geordnet, ohne "Kulmination" und ohne "Auflösung" oder Katharsis.
"Ich spüre es bis ins Skelett", sagt gelegentlich einer dieser Erzähler und muss gleich die erschrockene Erinnerung an Vanitas mundi und Barockgerippe abwehren. Aber die Formulierung sitzt und trifft die Obsessionen, die Nootebooms Schreiben regieren. Hierher gehört auch der sonderbare Titeleinfall Chateaubriands, der es ihm besonders angetan hat. "Mémoires d'Outre-Tombe", "Chateaubriand aus dem Grabe" - man gewinnt den Eindruck, als spinne Nooteboom die kühne Metapher für seine Erzählungen aus. Er gewinnt so eine zwingende Logik, die alle leerlaufende Beliebigkeit abwehrt.
Und noch ein drittes Stichwort gesellt sich dazu. Es heißt "Allerseelen", bildet den Titel eines Romans Nootebooms aus dem Jahr 1999 und besagt für dessen Erzähler ungefähr Folgendes: "Allerseelen. Er wusste nicht genau, was er sich darunter vorzustellen hatte, aber er hatte den Eindruck, das Wort habe mehr mit Lebenden als mit Toten zu tun. Es mussten Tote sein, die sich noch irgendwo aufhielten, es war unmöglich, sie ganz wegzubekommen, man musste ihnen noch Blumen bringen." Treffender kann man nicht sagen, was in Nootebooms Erzählungen geschieht. "Abwesende und Tote, das ist meine Gesellschaft", heißt es einmal.
Nicht von ungefähr sind hier Fotos allgegenwärtig. Sie vertreten gewissermaßen die Rolle der Friedhöfe, bilden die Brücke zum Allerseelen-Reich. "Ich glaube nicht an Geister, aber dafür an Fotos." Frauen sorgen für Fotos, die an sie erinnern, nicht anders die Toten, "wenn sie nur genug vernachlässigt werden". Kein Erzählen ohne Fotos. Manchmal stellt der Erzähler ausdrücklich ein Foto vor sich auf, manchmal zieht ihn ein Foto, zufällig betrachtet, in eine Geschichte hinein. "Ich sehe mir ein Foto mit mehreren Leuten an, zwischen denen ich selbst stehe." "Eine zerzauste Gruppe, in Kleidern für draußen. Fünf Männer, zwei Frauen, ein halber Hund." Folgt die Selbstermahnung des "Schreiberlings": "Ja, dich meine ich. Einer dieser sieben bist du selbst, zwei der Männer kennst du nicht, bleiben vier, und von einem der vier wolltest du etwas erzählen. Warum diese ganze Geheimnistuerei?" Nur dieser eine ist tot, im Foto greift er d'outre tombe nach seinem Erzähler.
Nicht, als ob dieser neue Peeperkorn ("Heinz"), der niederländische Vizehonorarkonsul und bacchantische Trunkenbold mit dem "Schweinekopf", der sich da mit einer Geschichte von ebenso auftrumpfender wie löchriger Vitalität meldet, sonderlich sympathisch wäre oder auf Freundschaft Anspruch machen könnte. Es geht nicht um eine Gunst, die ihm der Erzähler erweist, sondern um eine moralische Verbindlichkeit. Er müsse etwas zu Ende bringen, lautet dessen Devise. Und gemeint ist nicht Werkethos, sondern moralische Arbeit an vergangenem Leben, die zugleich ein Akt der Selbstbehauptung ist, ein Kampf gegen die Vergänglichkeit, der nicht gewonnen werden kann, Widerstand im sich auflösenden Leben. So läuft die geheime Logik dieses Erzählens schließlich auf ein Erinnern zu, das hier ganz neu konstruiert wird: Nootebooms Erzählen ist Erinnern an Tote, ein ganz privates Gespräch mit ihnen, ein einziges, unablässiges Allerseelen.
Einmal, natürlich handelt es sich um eine Liebesgeschichte, gelingt das Erinnern gleich so gut, dass eine Antwort aus dem Totenreich kommt. Auf die Erzählung "Paula", die von einer jungen Clique von Spielern und vom kurzen Leben des Groupies und Models Paula erzählt, dessen Foto auf dem Titelblatt von "Vogue" erschienen ist, antwortet die tote Heldin in "Paula II": "Du hast mich gerufen, ich antworte. Ob du es hörst, weiß ich nicht. Hier wirkt eine Chemie, die ich nicht beherrsche. Vielleicht geht es über die Haut, über das Foto, das du ans Fenster gestellt hast." Die Tote spielt auf dem Instrumentarium, das sich die Poetik der Erinnerung geschaffen hat. Dass man ihr glaubt, ist ein Erfolg von Nootebooms leiser und inständiger Erzählkunst.
HANS-JÜRGEN SCHINGS
Cees Nooteboom: "Nachts kommen die Füchse". Erzählungen. Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009. 155 S., geb., 19,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
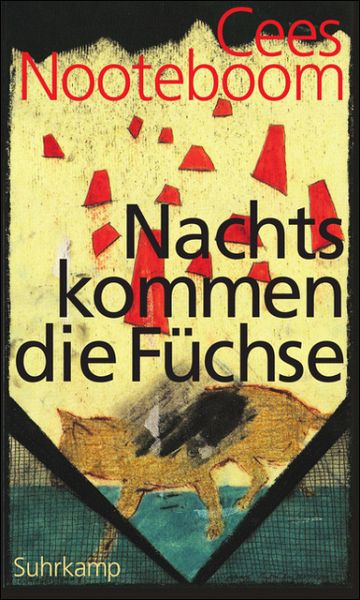





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.04.2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.04.2009