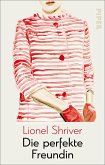Kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag richtet Kevin in der Schule ein Blutbad an. Innerhalb weniger Stunden ist das Leben seiner Familie nicht mehr, wie es war. - Lionel Shriver erzählt aus der Sicht einer Mutter, die sich auf schmerzhafte und ehrliche Weise mit Schuld und Verantwortung, mit Liebe und Verlust auseinandersetzt. Hätte sie ihr Kind mehr lieben sollen? Hätte sie das Unglück verhindern können? Ein höchst aktueller Roman von erschütternder Klarheit und stilistischer Brillanz.

Der Roman über eine Familie, in der ein Amokläufer heranwächst: Lionel Shrivers „Wir müssen über Kevin reden”
Nach dem Amoklauf des 18 Jahre alten Bastian B. an einer Realschule im Münsterland werden nun wieder diese Fragen laut. Was geht in so einem Menschen vor? Wie konnte es dazu kommen? Trifft die Eltern Schuld? Es sind immer dieselben quälenden Fragen, man hat sie sich schon nach dem Massaker an der Columbine High School gestellt und nach dem Blutbad am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt, es gibt eigentlich keine Antworten darauf. Die amerikanische Schriftstellerin und Journalistin Lionel Shriver hat diese Fragen zur Grundlage eines Romans gemacht. „Wir müssen über Kevin reden” rollt die Geschichte einer Durchschnittsfamilie auf, in der ein jugendlicher Amokläufer heranwächst. Die dritte Frage kann zumindest Lionel Shriver eindeutig beantworten: Ja, Mutter und Vater haben durchaus ihren Anteil an dem, was passiert.
Der Roman beginnt, als alles schon zu Ende ist. Kevin Khatchadourian hat an einem Donnerstag kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag an seiner High School sieben Mitschüler, eine Lehrerin und einen Angestellten mit einer Armbrust getötet. Nun sitzt er im Jugendgefängnis, wo ihn seine Mutter Eva regelmäßig besucht. Die sieht ihrerseits einem Prozess entgegen. Die Angehörigen der Opfer haben sie auf Schmerzensgeld verklagt – solche Verfahren hat es in Amerika nach ähnlichen Bluttaten wirklich gegeben. In 28 Briefen an ihren Mann Franklin versucht Eva, sich jenen Donnerstag zu erklären, und lässt nebenbei ihr Leben Revue passieren.
Das verlief die längste Zeit in den aufregenden Bahnen einer New Yorker Großstadt-Existenz. Eva ist eine selbstbestimmte Frau, die für einen alternativen Reiseführer durch die Weltgeschichte fährt, ihr Lebensgefährte hat sich als Fotograf einen Namen gemacht. Es ist ein Leben zwischen Ausgeben und Ausgehen, das die beiden führen, unabhängig in jeder Hinsicht, Kinder sind in diesem Umfeld „ähnlich rar wie der Fleckenkauz oder andere gefährdete Arten”. Doch eines Tages setzt sich der Ehemann mit seiner immer stärker werdenden Sehnsucht nach Familie durch. Eva ist alles andere als überzeugt von der Idee der Mutterschaft. „Welcher Teufel ritt uns? Wir waren so glücklich! Warum setzten wir alles, was uns lieb war, auf diese eine, wahnsinnige Karte und spielten um ein Kind?” Sie wird trotzdem schwanger – und das Unglück nimmt seinen Lauf.
Lionel Shriver inszeniert ihren Roman als eine Mischung aus Psycho-Thriller und Horrorfilm. Das Kind, das Eva auf die Welt bringt, ist kein süßes Baby, sondern ein Fremdkörper wie aus der „Alien”-Reihe. Was Kevin auch tut – es scheint darauf ausgerichtet zu sein, seine Mutter zu vernichten. Am Anfang wirkt alles noch recht harmlos, welches Kind schreit schließlich nicht Nächte durch und zieht seine Mutter an den Haaren? Doch nach und nach wächst sich der Kleine zu einem regelrechten Monster aus. Er zerstört mutwillig das, was seiner Mutter am heiligsten ist, er quält andere Kinder und bezichtigt eine Lehrerin der sexuellen Belästigung, sodass sie den Schuldienst quittieren muss. Wie in einem klassischen Horrorfilm merkt die Welt von diesen Vorgängen lange nichts, da kann sich die Mutter noch so oft über ihren Satansbraten beklagen. Der etwas einfältige Ehemann Franklin tut alles, um seine Vorstellungen vom Familienidyll aufrechtzuerhalten, Kevins Taten hakt er als Lausbubenstreiche ab. Selbst als Kevin eines Tages seine kleine Schwester mit Rohrreiniger verätzt, sucht Franklin die Schuld lieber bei seiner Frau als bei seinem Erstgeborenen.
Raffiniert argumentiert Lionel Shriver aus der Sicht einer Mutter, die keine sein will und nie eine werden wollte. Diese Eva ist ja auch wirklich eine sympathische Frau, intelligent, erfolgreich, witzig, man versteht, dass sie ihre Karriere nicht opfern möchte und schon gar nicht für so einen Jungen. Und warum sollte man sich eines Kindes wegen zu irgendwelchen Zugeständnissen hinreißen lassen? Man nickt zustimmend, als Eva zum Thema Kind als Erstes die Schlagworte „tödliche Langeweile” und „gesellschaftlicher Abstieg” einfallen. Und als Eva ihren bockigen und bösartigen Sohn gegen einen Tisch wirft und schwer verletzt, möchte man das als verdienten Sieg in einem gleichwertigen Kampf auslegen.
Diese Perspektive mütterlicher Ablehnung ist als Erzählhaltung so eingängig wie auch schockierend. Vermutlich deshalb haben 30 Verlage Shrivers Manuskript abgelehnt. Über Mundpropaganda wurde „Wir müssen über Kevin reden” in Großbritannien und den USA berühmt, im vergangenen Jahr wurde Lionel Shriver schließlich mit dem Orange Preis ausgezeichnet. Denn auf den zweiten Blick ist es dieser kalte Blick der Mutter, der diesen Roman so besonders macht, als Psycho-Thriller genauso wie als Dokumentation einer unaufhaltsamen Katastrophe. Irgendwann wirken Evas Versuche, den Mangel jeglichen Gefühls für ihr Kind aus dessen verkümmerter Persönlichkeit zu erklären, nur mehr selbstgerecht. Bald weiß man nicht, was schlimmer ist: die Gewalttat des Sohnes oder der verächtliche Egoismus der Mutter.
Kevin ist für seine Mutter nur „ein Hütchenspieler, bei dem alle drei Hütchen leer sind”, und selbst den Säugling kann sie nur als Feind im Gitterbett empfinden: „Kevin zog sich hoch, ohne sein Jaulen zu unterbrechen. Er klammerte sich an den Stäben fest und schrie mich aus einer Entfernung von wenigen Zentimetern an, so dass meine Ohren schmerzten. Verzerrt, wie es war, sah sein Gesicht wie das eines alten Mannes aus, und er schraubte es zu dem Dich-kriege-ich-noch-Ausdruck eines Sträflings hoch, der schon mit der Nagelfeile einen Tunnel gräbt.”
Kevins Kaltblütigkeit, die eines Tages im neunfachen Mord gipfelt, erscheint da nur konsequent. Dieser Amoklauf lässt sich nicht mit dem Einfluss des Fernsehens oder eines Computerspieles erklären, er ist vor allem auf zwei Leute zurückzuführen, die erst aus Bequemlichkeit keine Kinder wollten und dann aus derselben Bequemlichkeit doch welche in die Welt setzten. Die ein Kind als Eindringling behandeln und sich dann darüber wundern, was dieses Kind alles ersinnt, um wahrgenommen zu werden. Die Einsicht der Mutter kommt spät: „Jetzt fehlen noch drei Tage, dann sind die achtzehn Jahre voll, und ich kann endlich verkünden, dass ich zu erschöpft bin und zu verwirrt und zu einsam, um weiterzukämpfen. Und sei es nur aus Verzweiflung oder sogar nur aus Faulheit: Ich liebe meinen Sohn.”
Lionel Shriver liefert in ihrem Roman eine so gewagte wie schlüssige These zur Entstehung von Jugendgewalt. Kevin richtet kein Blutbad an, weil er von Natur aus böse ist, wie seine Mutter das ihrem Franklin gerne glauben machen möchte. Er straft auch jene Lügen, die, wie es anlässlich des aktuellen Falles in Deutschland wieder geschieht, jugendliche Amokläufer darauf reduzieren wollen, dass sie durch Internet-Spiele jeden Bezug zur Realität verloren haben. Kevin etwa mordet, weil ihm ein eiskalt geplantes Verbrechen als der einzige Weg erscheint, sich über die grausame Selbstgerechtigkeit seines überforderten Elternhauses zu erheben. „Wir müssen über Kevin reden” endet wie eine antike Tragödie. Kevin tötet seinen Vater – ein moderner Ödipus, der seinem Schicksal nicht entrinnen kann, weil es ihm von Geburt an vorgegeben war. Wir werden noch über viele Kevins reden müssen. VERENA MAYER
LIONEL SHRIVER: Wir müssen über Kevin reden. Aus dem Englischen von Christine Frick-Gerke und Gesine Strempel. List Verlag, Berlin 2006. 560 Seiten, 19,95 Euro.
Was ist eigentlich schlimmer: Die Gewalttat des Sohnes oder der Egoismus der Mutter?
Zwei Kreuze erinnern an die Studenten Nicholas Kunselman und Stephanie Hart, die in Littleton, Colorado, ermordet wurden.
Foto: Gary Caskey/REUTERS
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Lionel Shrivers Roman hinterfragt die unbedingte Mutterliebe
Mütter sind nicht gerade Mode als literarischer Topos. Eigentlich sind sie sogar erstaunlich unterrepräsentiert - jedenfalls jene Mütter, deren Kinder noch nicht alt genug sind, sich schreibend mit ihnen auseinanderzusetzen. Fürchten Autoren ihre lebenslange Macht? Ist ihr Geheimnis zu tief - oder erscheint es zu banal? Oder verströmt die Mutterrolle und -figur einen kittelschürzeligen Mief? Lionel Shriver selbst ist nicht Mutter. Aber sie hat einen Roman geschrieben, der nicht nur Müttern nahegeht. In Amerika hat er ebenso großes Aufsehen erregt und Debatten angestoßen wie in Großbritannien, wo der Autorin im vergangenen Jahr der Orange Prize zugesprochen wurde.
Der Roman enthält achtundzwanzig Briefe einer Verlegerin namens Eva an ihren entfremdeten Ehemann Franklin, freier Mitarbeiter von Werbeagenturen. Es sind achtundzwanzig Versuche, eine Erklärung zu finden für "Donnerstag", jenen Tag, an dem der fünfzehnjährige Sohn Kevin sieben Mitschüler, seine Englischlehrerin sowie einen Mitarbeiter der Cafeteria in der Turnhalle seiner Schule hinrichtet. Wann auch immer jugendliche Amokläufer die Nachrichten beherrschen, wird ausnahmslos gefragt: Warum haben die Eltern nicht rechtzeitig bemerkt, was sich anbahnte? Gab es keine Alarmsignale? Die naheliegende Vermutung lautet stets: Das Zuhause, die Mutter muß versagt haben.
Das Thema Mutterliebe wird so verknüpft mit einem Drama, für das Ortsnamen wie Columbine oder Erfurt stehen. Das machte die kinderlose Autorin, Fiktion hin, Jugendkriminalität her, kurzum zu einer Art Auskunftsperson. Darum dürfte es ihr allerdings kaum zu tun sein.
Das Postulat unbedingter Mutterliebe wird hier in Frage gestellt - mit radikaler, manchmal geradezu pathetischer Emphase. Als Vehikel dient Shriver die Lebensgeschichte von Kevin, von dem Moment an, als Eva das erste Mal über eine Schwangerschaft nachdenkt, bis hin zu den gespenstischen Besuchen bei ihrem Sohn in der Jugendstrafanstalt. Und selbst sanftmütigste Muttertiere werden sich bei der Lektüre fragen, ob sie an der Seite dieses Kindes nicht auch durchgedreht wären. Kevin ist ein Monster, sein Porträt nicht mehr und nicht weniger als eine Studie des Bösen.
"Alles hängt davon ab, wie sehr Menschen es mögen, hier zu sein, einfach am Leben zu sein. Ich glaube, Kevin haßte es." So steht es in einem der Briefe. Die Verweigerung erscheint als Movens von Kevins gesamter Entwicklung. Als Säugling wendet er sich angeekelt von der mütterlichen Brust ab. Im Krabbelalter bewegt er sich nicht. Als Vierjähriger macht er noch in die Windeln, als Siebenjähriger verfolgt er Mitschüler mit kleinen Gehässigkeiten. Als Zehnjähriger hat er sich bereits völlig in sich selbst zurückgezogen und zieht mit einem ihm weit unterlegenen Jungen, einer Art Zombie, umher, mit dem man Steine von der Brücke werfen kann. Mit fünfzehn schließlich ist der perfekte Zyniker vollendet; er heckt einen teuflischen Plan aus, der ihn zur Berühmtheit macht. In seiner Antwort auf die unvermeidliche Reporterfrage nach dem Motiv seines Mordanfalls gelingt es ihm, sein Handeln als eine Art Dienstleistung darzustellen: "Die Welt ist eingeteilt in Gaffer und Angegaffte, und es gibt immer mehr Publikum und immer weniger zu sehen, so sehe ich das. Die Menschen, die wirklich was unternehmen, gehören zu einer verdammt bedrohten Art."
Es geht Eva nicht darum, ihren Anteil an dieser grauenvollen Geschichte zu übertünchen. Für ihre Selbstsüchtigkeit, ihre Launen, ihre mangelnde Zuwendung übernimmt sie Verantwortung. Aber nicht für den Rest, "nicht für den ganzen Kevin". Die Briefe geraten daher auch kaum zur Verteidigungsschrift. Vielmehr sind sie Zeugnis einer quälenden Selbstbefragung: Was habe ich versäumt? Hätten wir unsere Ehe retten können? Hätten wir professionelle Unterstützung suchen müssen, als wir unsere Hilflosigkeit erkannten? Wie konnte uns dieses Kind in seiner befremdlichen, unkindlichen Leidenschaftslosigkeit so entgleiten? Warum war er ebensowenig zu begeistern wie zu bestrafen und dabei doch erkennbar intelligent?
"Ich hatte es mir leichter vorgestellt, Mutter zu sein", gibt sie schließlich zu. Und wahrscheinlich wäre sie besser nie eine geworden. Der Entwurf von Mutterschaft als harmonischer Erweiterung einer großen Liebe zwischen Mann und Frau erweist sich als verhängnisvolle Illusion. Als Kevin gerade geboren ist und sie ihn ansieht, wird sie nicht etwa von Zärtlichkeit überwältigt, sondern spürt - nichts. Diese Verweigerung wird sowohl von der Außenwelt als auch von ihr selbst als peinliches Versagen gewertet.
Und so gerät der Briefroman zur Dekonstruktion des Mythos von glücklichen Beziehungen zwischen Mutter und Kind, getragen von Wärme, Liebe und Geduld. Vater Franklin geht jedem Konflikt aus dem Weg, nicht ganz untypisch für enorm beschäftigte Väter, entschuldigt sämtliche Fehler des Knaben, ignoriert seine Verhaltensauffälligkeit und gibt sich als allverständiger Daddy-Buddy, der seinen "Kev" gegen mütterliche An- und Ausfälle in Schutz nimmt. Kevin ignoriert ihn, während er die Mutter immerhin noch als Haßobjekt wahrnimmt: "Soweit ich es beurteilen kann, ist das einzige, was dich von anderen strohdummen Amerikanern unterscheidet, daß du nicht dick bist", läßt er sie wissen. "Ich weiß nicht, wie er so geworden ist, aber er ist der Horror", resümiert sie. Mag sein, daß sie Kevins Eigenschaften, seinen Charakter ab und an überzeichnet. Seine Einfälle immerhin bergen durchweg eine gewisse Realitätsnähe.
Eine Frage, die Lionel Shriver nicht explizit stellt, sich dem Leser jedoch aufdrängt: Könnte es sein, daß die Bedingungen und Umstände, unter denen Kindheit heute in vielen Fällen stattfindet, ein, zwei, viele Kevins heranwachsen lassen? Könnte es sein, daß es an der Zeit ist, darüber nachzudenken, warum sich Mütter häufig überfordert fühlen? Warum so viele Frauen ihren Lebensentwurf mit der Mutterrolle nicht mehr in Einklang bringen? Wenn wir anfingen, darüber nachzudenken, hätte Lionel Shriver sehr viel mehr erreicht, als einfach einen guten Roman geschrieben zu haben.
ANNA VON MÜNCHHAUSEN
Lionel Shriver: "Wir müssen über Kevin reden". Aus dem Englischen übersetzt von Gesine Strempel und Christine Frick-Gerke. List Verlag, Berlin 2006. 560 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Anna von Münchhausen zeigt sich beeindruckt von diesem nicht gerade bequemen Buch, mit dem Lionel Shriver in den USA und Großbritannien einige Debatten angestoßen hat. Im Zentrum steht die geistige Auseinandersetzung einer Mutter mit ihrem Sohn, der wegen eines Amoklaufs im Gefängnis sitzt. Der Autorin gelinge es, notiert die Rezensentin angetan, mehr als nur deren individuelles Schicksal zu reflektieren. Vielmehr stellt Shriver den Mythos in Frage, der Mutter-Kind-Beziehungen umrankt und damit auch das "Postulat unbedingter Mutterliebe - und das "mit radikaler, manchmal geradezu pathetischer Emphase". Auch wenn die Mutter die Eigenschaften ihres entfremdeten Sohns manchmal überspitzt darstelle, zeichnen sich die dargestellten Situationen und Gefühle durchweg durch eine "gewisse Realitätsnähe" aus, wie Münchhausen lobt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH