Prosa war dem politischen Geist des Poststalinismus offenbar einfach zu fremd. Dabei gebührt der "Kurzen Geschichte" ein Platz unter den aufregendsten Liebesromanen des zwanzigsten Jahrhunderts auf Augenhöhe mit Henri Alain-Fourniers "Großem Meaulnes" und Scott Fitzgeralds "Großem Gatsby".
Auch bei Rubins Ich-Erzähler Attila dreht sich alles um den Rausch der ersten Liebe und gesellschaftliche Umstände, die ihren Verrat fast unvermeidlich machen. Zugleich handelt der Roman von der vergeudeten Jugend einer Generation, die vor und noch im Zweiten Weltkrieg voller Illusionen aufwuchs und sich nach seinem Ende radikal umorientieren musste. Wer nicht aus dem Land floh oder im Gefängnis landete, arrangierte sich mit den neuen Machtverhältnissen: "Scharf wie ein Schatten zur Mittagszeit stand mir Hédis Schicksal vor Augen - und das aller anderen Jungen und Mädchen aus dem Kleinbürgertum, die nach dem leeren Nimbus einer untergegangenen Klasse gierten." Wie Attilas Geliebte Orsolya geht Hédi eine Vernunftehe ein, die ihr einen Mann beschert, dessen brutale Biederkeit ihr fast den Verstand raubt. Attila versucht der Freundin zu imponieren, indem er im Kulturleben Karriere macht, dabei aber sein Talent durch linientreue Gedichte ruiniert. Bei der ihm an bitteren Erfahrungen überlegenen Deutsch-Ungarin Orsolya erntet er Verachtung. "Abgemagert und kellerbleich" kehrte das Flüchtlingskind "aus dem erloschenen Dresden nach Ungarn" zurück, wo das Apothekenhaus ihrer Familie von den neuen Herren längst konfisziert worden ist. Die Ernüchterung der Protagonisten ändert nichts am Zauber eines Romans, dessen Reize sich auch den ländlichen Szenerien verdanken. Rubins Welt ist direkt und plastisch, voller Gerüche und Atmosphären. Die Erfrierungen an Orsolyas Füßen, "Andenken an unzählige Fußmärsche während des Krieges - kribbeln in der Wärme" eines Zugabteils, es duftet nach Quitten, und der an den Schuhen hereingetragene Schnee verdampft auf dem Boden.
Alles ist durchdrungen von gelebter Zeit.
Selbst der am Nachthemd des Mädchens funkelnde Perlmuttknopf ist Relikt einer Epoche, in der sich die Romanästhetik noch nicht von den gleichmäßig erleuchteten Oberflächen digitaler Bilder inspirieren ließ. Alles bei Rubin ist taktil und von gelebter Zeit durchdrungen, ein Koffer ist ein Pappkoffer, ein Zwicker aus Draht, Orsolyas Badeanzug ausgebleicht und ein Anzug schon glänzend, weil aus der Soutane des Vaters geändert. Wenn Attilas Anzug ausnahmsweise neu ist, dann wurde er gegen "zwei fette Gänse" geschneidert. Es herrscht Naturalienwirtschaft, die Trommel in der Ecke einer Pension hat "ein Kostgänger zur Tilgung seiner Mietschuld hinterlassen". Von ihrem Erlös wird die Vermieterin ihrem verstorbenen Mann einen Grabstein setzen. Um den Grabstein der Mutter vergolden zu lassen, war Attilas Vater "seinerzeit sogar zu hungern bereit". Der Sohn ist weniger romantisch, er bevorzugt den Augenblicksgenuss um jeden Preis: "Angespannt wie ein Patient vor der Darmspiegelung lag sie auf dem Rücken und sah mir starren Blicks beim Ausziehen zu." Orsolya gibt sich ihm nur noch mit dem Zynismus einer Hure hin, und doch hofft Attila bei jedem Treffen auf den Neubeginn der Liebe. Stattdessen heiratet sie ihn aus Berechnung, und schon die Hochzeitsnacht endet so bitter, dass die Trennung zur Erlösung wird. Ein großes Buch ist die "Kurze Geschichte", weil ihr Erzähler sich zur Weisheit des Vaters durchringt und seiner traurig endenden Liebe mit goldener Schrift einen Grabstein setzt. Dem literarischen Gedächtnis vertraut der Roman nicht nur die reiche äußere Textur einer versunkenen Welt an, auch über das Seelenleben der Figuren werden wir detailliert informiert. Rubin besitzt ein feines Sensorium für das Aufflackern der Scham, für die Lähmungs- und Ekelgefühle der Melancholie, aber auch für das elastische Vermögen des Lebens, triumphierend jeder Schwermut zu entkommen: "Dieses Lachen brauchte nicht erst einen Witz, es brach aus uns heraus, so elementar und unaufhaltsam wie eine sprudelnde Quelle."
Eine Läuterungserzählung, rein wie ein Reagenzglas.
Weil er diese Quelle wiederentdeckt, übersteht Attila seine Liebesbesessenheit: "Mein Leben hing davon ab, ob es mir gelingen würde, wenigstens einen Punkt in meiner Vergangenheit zu finden, an dem ich mich festhalten konnte, an dem sich, wenn auch noch so winzig, Leben verbarg, das mit Orsolya nichts zu tun hatte." Wie bei Proust, dem die Form viel verdankt, liegt dieser Umschlagpunkt in den ersten Lebensjahren des Helden, in einer Zeit, die von sexueller Tunnelsicht frei und deshalb unschuldig ist. "Ich liebte diese Momente, wenn über unseren ausgebluteten Herzen nur noch der Himmel unserer Kindheit sich wölbte." Von ihr her eröffnet sich dem Roman das weite Panorama eines interesselosen Wohlgefallens an der sinnlichen Fülle der Dinge. Die urromantische Figur des Taugenichts schwirrt Attila im Kopf herum, als er, mit dem Schicksal versöhnt, eine Donaudampferfahrt unternimmt: "Es war Mittag, an den Zedernsäulen im leeren Speisesaal tanzte das Licht, die Tische waren frisch und sauber gedeckt wie Altäre am Osterfest." An diesem verwunschenen Ort auf den Wellen der Zeit beginnt die Geisterbeschwörung des Ich-Erzählers, seine chemische Verwandlung in gestochen scharfe Literatur. "Vom Baden fühlte sich meine Haut kühl und frisch an", heißt es auf der ersten Seite, "mein ganzer Körper war rein wie ein Reagenzglas." Rubins Roman ist eine Läuterungserzählung. Indem Attila auf Orsolyas Besitz verzichten lernt, besteht er die Feuerprobe der Liebe und erhält die Gabe, eine Welt auferstehen zu lassen, die im Krieg in Flammen aufging.
Szilárd Rubin: "Kurze Geschichte von der ewigen Liebe". Roman. Aus dem Ungarischen von Andrea Ikker. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2009. 192 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
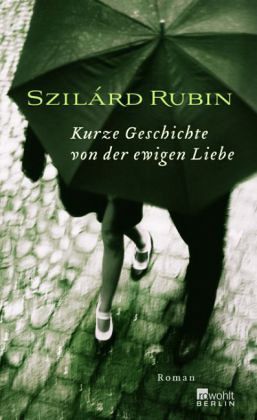



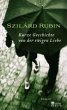

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2009