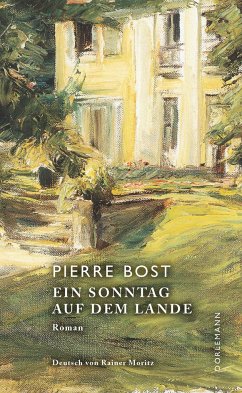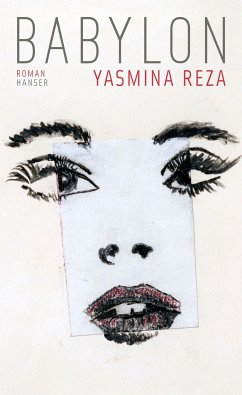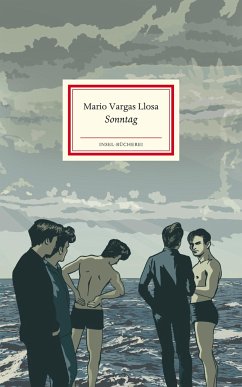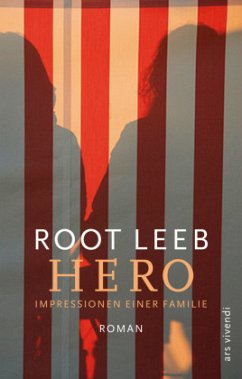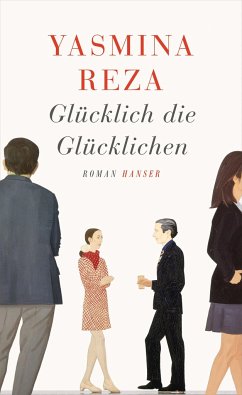ihn keine Alternative, im Übrigen fühlte er sich von seinen Lehrmeistern so stark beeinflusst, dass er auch gar nichts anderes gewollt hätte als die freundlichen impressionistischen Landschaften, die er mit einiger Fertigkeit schuf. Und dann, so gesteht es sich der alte Maler in seinem fortdauernden Selbstgespräch ein, war ihm die Kunst eben irgendwann zum Handwerk geworden. Er beherrschte die Sache ja.
Es ist nie zu spät? Mit Verlaub: neue Ufer, mit sechsundsiebzig?
Der kleine Roman "Monsieur Ladmiral va bientôt mourir" aus dem Jahr 1945, der nun unter dem Titel "Ein Sonntag auf dem Lande" auf Deutsch erscheint, spielt an einem einzigen Sonntag. Der Tag ist wie alle anderen Sonntage auch, wenigstens die meiste Zeit über, angefangen mit der Ankunft des Zuges aus Paris, in dem der erwachsene Sohn des Malers mit seiner Familie sitzt. Es folgen der Aufstieg vom Bahnhof zum Atelier, der kurze Kirchenbesuch der Schwiegertochter, dann die üblichen Rituale, die allerdings durch den überraschenden Besuch der Tochter Irène gestört werden, bis sie ebenso überraschend wieder verschwindet. Der Tag schleppt sich hin, auch der Sohn verabschiedet sich mit seiner Familie zur üblichen Zeit, der Maler hat Ruhe. Und sein ängstlich um den Vater besorgter Sohn zieht im Stillen Bilanz - zwei, vier Wochen lang wird das sicher noch so weitergehen, wahrscheinlich sogar noch länger.
Natürlich geht es im Roman des Proust-Verehrers Pierre Bost (1901 bis 1975) unübersehbar um das Nebeneinander von verstreichender und aufgehobener Zeit, um Dinge und Zustände, die sich dem allgegenwärtigen Niedergang widersetzen, bis das Bröckeln augenfällig wird. Bost entwirft dafür gleich zu Beginn zwei schöne Bilder: Zum einen weist er auffällig auf den Hang hin, auf dem das Haus des Malers gebaut ist, zum anderen lässt er Ladmiral störrisch darauf beharren, sein Heim liege "acht Minuten vom Bahnhof entfernt", was bei aller geographischen Fixierung natürlich dem Wandel unterworfen ist, den auch der Körper des Malers durchläuft: Dass es nun eben zehn oder gar zwölf Minuten von Tür zu Gleis sind, ist für ihn so empörend, dass er es gar nicht zur Kenntnis nimmt (und stattdessen lieber behauptet, die Uhren gingen falsch).
Denn so wie Proust etwa in seiner berühmten Überlegung zur Rezeption von Musik davon ausgeht, dass man dasselbe Musikstück nicht mehrmals identisch hören kann, weil die Erfahrung früheren Hörens dies verhindert, so ist eben auch in der betonten und gewollten Gleichförmigkeit der Sonntagsbesuche das, was sich ändert, umso präsenter, und seien es auch Winzigkeiten. Bost, ein ausgezeichneter und diskreter Stilist, nutzt hin und wieder einen Tempuswechsel, um einzelne Szenen wie in Zeitlupe zu beleuchten, etwa jenen Moment, in dem sich der alte Mann wäscht und dabei seinen Körper ausgiebig betrachtet, wie um auch auf dieser Ebene dem Wandel in der scheinbaren Dauer nachzuspüren.
In seinem Nachwort zu dieser Ausgabe weist der Übersetzer Rainer Moritz darauf hin, dass der damals selbst knapp über vierzigjährige Erfolgsautor Bost mit dem Bild des in seiner Manier erstarrten Malers den eigenen Abschied von der Literatur einleitete - später arbeitete er vor allem für den Film. Und es ist einigermaßen erstaunlich, dass die Adaption des Romans für das Kino bis 1984 auf sich warten ließ, als Bertrand Taverniers Film herauskam.
Am Abend, als er wieder allein ist, schaut Ladmiral zum Himmel: "Wie schön die aufkommende Nacht doch war. Die Farben waren bezaubernd, perlweiß und leicht granatrot, mit einem Band in Mandelgrün, das so gerade gespannt war, als wäre es mit der Reißfeder gezogen. Man würde es nicht wagen, das zu malen."
Natürlich nicht. Es sind Sätze wie dieser, die uns ebenso unvermutet wie zuverlässig treffen in diesem kleinen Roman voller Abschied.
TILMAN SPRECKELSEN
Pierre Bost:
"Ein Sonntag auf dem Lande". Roman.
Aus dem Französischen von Rainer Moritz. Dörlemann Verlag, Zürich 2012. 160 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
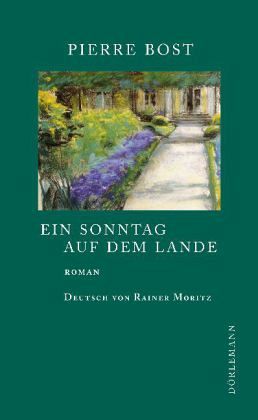





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.02.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.02.2013