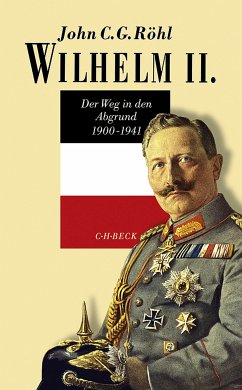Materialschlacht im Zettelkasten: John C. G. Röhl hat den zweiten Band seiner monumentalen Biographie Wilhelms II. hinter sich gebracht
Von seinem Verleger Cotta gefragt, ob er nicht eine Biographie Friedrichs des Großen schreiben wolle, lehnte Friedrich Schiller dieses Ansinnen ab: Er könne diesen Charakter nicht lieb gewinnen. Eine solche Antwort ist plausibel, betrachtet man die Biographie als ein vorrangig literarisches Werk, das in Zeiten des Idealismus zumal nur als ein Kind der Liebe zu ihrem Gegenstand vorstellbar war. Die Biographie im Sinne einer historiographischen Untersuchung hingegen, die das Wechselspiel von Persönlichkeit und Geschichte aufzeigen will, darf eine solche Bedingung ihrer Möglichkeit nicht gelten lassen. Für sie gilt vielmehr, ganz im Sinne Jacob Burckhardts, dass „die großen Individuen ... die Koinzidenz des Allgemeinen und des Besonderen, des Verharrenden und der Bewegung in einer Persönlichkeit” seien: Sie resümierten Staaten, Religionen, Kulturen und Krisen.
Diese Definition des Basler Geschichtsphilosophen erhellt en passant, dass dem Epitheton „groß” keineswegs eine moralische Bedeutung eigentümlich sein muss, damit ein Individuum gleichsam biographiefähig ist. Wie sonst ließe sich auch rechtfertigen, dass ausgemachte Scheusäler wie Stalin oder Hitler so oft schon Gegenstand biographischer Anstrengungen waren und, so muss man vermuten, auch künftig noch sein werden. Was beide für Biographen so attraktiv macht, hat weniger mit der Faszination zu tun, die von der Banalität des Bösen schlechthin ausgeht, als damit, dass sich Stalinismus und Hitlerismus ohne eingehende Schilderung der je wesenseigentümlichen Pathologie ihrer Namensgeber kaum plausibel erklären lassen.
Auch wenn der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. aus dem Geschlecht der Hohenzollern hinsichtlich seiner „Größe” sich in mancher Hinsicht nicht mit jenen beiden Weltverbrechern über einen Leisten schlagen lässt, erregte er dennoch das Interesse von Biographen. Die Frage, die sich bei ihnen dabei stellt, lautet, inwieweit er die Epoche, die seinen Namen trägt, nicht nur bis zum Grad jener Vollkommenheit verkörperte, dass er fraglos zum Vorbild vieler Zeitgenossen wurde, sondern seine Zeit vor allem auch durch sein Wollen und Tun geprägt hat.
Sie wurden irre an ihrem Tun
Diese Frage in dieser Schärfe zu stellen, wirft indes eine Reihe von dornigen Problemen auf, die aus nahe liegenden Gründen lange gern gemieden wurden. Nach der Niederlage des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg und dem Ende der deutschen Kaiserherrlichkeit ließ es sich eine vom Geist der Monarchie geformte und überwiegend deutsch-national angestrichene Geschichtsschreibung angelegen sein, die Verantwortung Deutschlands im Allgemeinen und die Rolle Wilhelms II. im Besonderen an diesem Desaster nach Kräften zu minimieren. Diese Haltung war zunächst durch die Absicht bedingt, die „Alleinschuldthese” am Weltkrieg, die von den siegreichen Alliierten mittels des Versailler Vertrags dem unterlegenen Deutschen Reich als moralisches Verdikt umgehängt wurde, wirksam zu entkräften, wenn nicht gar zu widerlegen. Die Apologeten dieses Treibens wurden aber selbst dann nicht an ihrem Tun irre, als Hitler, der kaum fünfzehn Jahre nach dem schmählichen Ende der wilhelminischen Herrschaft legal an die Macht kam, seine Diktatur erfolgreich damit legitimierte, die Schmach und Schande von Versailles gründlich zu revidieren.
Der Versuch endete, wie bekannt, in einer zweiten Niederlage des Deutschen Reichs. Aber selbst dieses finis Germaniae von 1945 war zunächst kein Anstoß, jenes beschönigende Geschichtsbild des Zweiten Reichs, das Bismarckzeit und Wilhelminismus im Goldrähmchen präsentierte, einer kritischen Revision zu unterziehen. Ein erster Versuch, das allzu lang Versäumte aufzuholen, wagte Fritz Fischer mit seinem 1961 publizierten Buch „Griff nach der Weltmacht”, in dem der Hamburger Historiker die deutsche Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg untersuchte und damit mittelbar der hierzulande stets heftig befehdeten alliierten These von der „Alleinschuld” des Deutschen Reichs am Ausbruch des Ersten Weltkriegs neue Nahrung und Plausibilität gab.
Die „Fischer-Kontroverse”, die damit angezettelt wurde, war keineswegs nur eine Zänkerei unter Fachhistorikern; vielmehr rührte sie an jene alte Lebenslüge, die nach 1918ff. von der Zunft kreiert und von einer breiten Öffentlichkeit akzeptiert worden war und die nach 1945 lediglich zu neuer Geltung gelangte. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Last der Verantwortung für die Menschheitsverbrechen, die im deutschen Namen zwischen 1933 und 1945 verübt worden waren, ließ sich vermeintlich leichter schultern, wenn man das Naziregime als „Unfall” der Deutschen Geschichte isolieren respektive singularisieren konnte. Das bedeutete nichts anderes, als dem Nazismus eine Vorgeschichte abzusprechen, die über die Zeit vor dem Versailler „Diktat” und dessen fatalen Folgen, für die sich die Siegermächte des Ersten Weltkriegs zu Mitverantwortlichen machen ließen, hinausreichte. Mit anderen Worten: Sollten die Deutschen ihre „verspätete” Nationalgeschichte nicht von allem Anfang an als fluchbeladen ansehen, dann galt es, das 1871 geschaffene Zweite Reich nicht nur in einem helleren, einem besseren Licht erstrahlen zu lassen, sondern es vor allem auch von jeder Kontinuität mit dem „Dritten Reich” Adolf Hitlers abzuschneiden.
Wagemutiges Beginnen
Vor diesem Horizont muss das Unternehmen der Monumentalbiographie Wilhelms II. gesehen werden, zu dem der deutsch-britische Historiker John C. G. Röhl aufgebrochen ist. Schon Die Wahl des biographischen Genres verrät, dass Röhl auf das historische Interesse eines größeren Publikums abzielt, das von den seit der „Fischer-Kontroverse” zahlreich vorgelegten sozialgeschichtlichen Monographien nur gestreift wurde. Andererseits ließen die bislang über Wilhelm veröffentlichten Biographien allzu häufig Ernst und Anstrengung, kurz: historiographische Seriosität vermissen. Einen entsprechenden Verdacht zerstreut Röhl mühelos durch den schieren Umfang seines Beginnens. Der erste, 1993 erschienene Band, der die Jugend- und Kronprinzenjahre zum Gegenstand hatte, umfasste 980 Druckseiten. Der jetzt erschienene zweite Band, der von der Thronbesteigung Wilhelms 1888 bis 1900 reicht, wartet mit stolzen 1338 Seiten auf. Das legt die Vermutung nahe, dass Röhls Biographie Wilhelms II. erst mit einem fünften Band abgeschlossen vorliegen dürfte, womit in fünfzehn bis zwanzig Jahren realistischerweise zu rechnen ist.
Eine derartige Aussicht muss dem Rezensenten nicht nur den Atem verschlagen, sondern ihn auch zu Demut verpflichten, hat er doch das jetzt mit dem zweiten Band vorliegende gewaltige Bruchstück vor dem Hintergrund der darin aufscheinenden ganzen Konfession zu betrachten. Welcher Art diese ist, das kündet Röhl bereits im Vorwort zum zweiten Band an. Auf Grund seiner umfangreichen archivalischen Forschungen unter anderem im Zusammenhang mit der von ihm herausgegebenen dreibändigen Edition der Korrespondenz des Kaiser- Intimus Philipp von Eulenburg sei es ihm „entgegen der Überzeugung der Fachhistoriker unabweisbar klar” geworden, „dass Wilhelm II. eine Schlüsselfigur der neueren deutschen Geschichte auf ihrem fatalen Weg von Bismarck zu Hitler darstellte”.
Eine derart dezidierte Feststellung kann in der Tat als ein Novum gelten, denn unbeschadet der Tatsache, dass in der Folge der „Fischer- Kontroverse” die wilhelminische Epoche schärfer ausgeleuchtet wurde und dabei mancherlei unliebsame Zusammenhänge und unabweisbare Kontinuitäten zum Vorschein kamen, die jene Vorvergangenheit mit der Vergangenheit des „Dritten Reichs” mental wie kausal verknüpften, spielte Wilhelm II. dabei doch nur immer die lächerliche Nebenrolle eines uniformverliebten, eitlen, im tiefsten Grunde aber harmlosen Phantasten, dessen Lieblingsspielzeug die Marine war. In dieser Sicht stimmten „linke” wie „rechte” Historiker überein und verteidigten damit wissentlich oder unwissentlich – es gilt gleichviel – den Kern jener alten Lebenslüge, die das Zweite Reich aus falsch verstandenen nationalpädagogischen Rücksichten gegen das „Dritte Reich” abzuschotten versuchten.
Von Lächerlichkeit umwittert
Mit jener Lächerlichkeit, der man Wilhelm II. umso bereitwilliger überantworten konnte, weil jeder Versuch, ihn davor zu bewahren, seinerseits von Lächerlichkeit umwittert war, gelang es bis heute erfolgreich, den eigentlichen „Helden”, den überragenden Baumeister des Zweiten Reichs, den der unreife Thronfolger gleich zu Beginn seiner als „Regime der unverantwortlichen Rede” verharmlosten spätabsolutistischen Alleinherrschaft meuchlings aus seiner Bahn stieß, in einer angeblich unanfechtbaren Größe zu konservieren, wenn nicht gar noch zu erhöhen. Mit anderen Worten: Die Witzfigur Wilhelm II. bewahrte Bismarck vor der längst überfälligen kritischen Infragestellung seines Handelns. Jeder Versuch, an dessen Denkmal zu rütteln – der Rezensent weiß, wovon er spricht –, wird regelmäßig mit wütender Empörung zurückgewiesen. Dabei war es kein anderer als Bismarck, der die überständigen gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen eines als Ideal vergötzten Preußentums mit verfassungsrechtlichen, politischen und mentalen Kautelen zu konservieren suchte. Das und nichts sonst waren die Voraussetzungen, die von Wilhelm II. usurpiert und bis in die letzte Konsequenz zum bleibenden, will sagen, weit über seine Ära hinausreichenden Schaden für Deutschland pervertiert wurden.
Auch wenn diese umfassende Verantwortlichkeit Bismarck bei Röhl notwendigerweise nur im Subtext mitgedacht wird, so kann man dennoch heute schon die Prognose wagen, dass es vor allem seiner Biographie Wilhelms II. zu danken sein wird, dass die längst fällige, umfassende Revision des preußisch- deutschen Geschichtsbildes der Epoche vor 1815 bis 1933 im Allgemeinen und der Ära Bismarcks und Wilhelms II. im Besonderen, die endlich als ein Zusammenhang gesehen werden muss, tatsächlich in Angriff genommen wird.
Sollte Röhls Biographie Wilhelms II. diese Erwartung tatsächlich rechtfertigen, dann verblassen dagegen die zahlreichen Einwände, die im Einzelnen gegen seine geradezu megalomanisch anmutende Unternehmung zu erheben sind, die sich zunächst einmal als ein in dieser Form einzig dastehendes Monument elektronischer Textbewältigung und Textverarbeitung bezeichnen lässt. Ironischerweise fallen damit Stärke und Schwäche von Röhls Arbeit in eins. Ihre Stärke ist die wörtliche Mitteilung in extenso zumeist nur archivalisch zugänglicher Quellen wie diplomatischer Korrespondenz oder der Briefe der Kaiserin Friedrich, die lange im Verborgenen schlummerten und heute im Archiv der Hessischen Hausstiftung bei Fulda untergebracht sind. Aber auch dank des Studiums der archivalischen Originale von bereits edierten Quellen gelingt es Röhl, mit zahlreichen Überraschungen aufzuwarten, da diese von ihren Herausgebern häufig „geschönt” oder sonstwie verfälscht wurden. Im Besonderen gilt dies für die wichtigen Tagebücher des hoch konservativen Generalstabschefs Waldersee, der einer der wichtigsten Mentoren des Kronprinzen und Kaisers Wilhelm II. war.
Von Lobhudelei beleckt
Diese Stärke bedingt, wie gesagt, aber auch die Schwäche von Röhls Arbeit, denn der Leser sieht sich entweder dazu genötigt, sich seitenlang durch den eklen Schleim wilhelminischer Panegyrik zu quälen oder er wird von den bisweilen zum verzweifelnden Lamento sich steigernden Klagen und Seufzern der Mutter Kaiser Wilhelms II., der Kaiserin Friedrich, gelangweilt. Völlig unerträglich aber sind die Zeugnisse der Ohrenbläser, der Kriecher und Schmeichler, der Höflinge und Lakaienseelen, die sich gar nicht genug tun können, dem kaiserlichen Aberwitz und dessen sich ständig steigerndem Irrsinn Lob zu hudeln, von dem ebenfalls die reichlich mitgeteilten Randglossen zu diplomatischen Berichten, von Briefen und Redeausschnitten kontinuierlich Zeugnis geben.
Hätte Röhl sich mit einer strengeren Auswahl begnügt, hätte er sich, sagen wir, mit der Hälfte beschieden, es wäre noch immer mehr als genug gewesen, um seine These von der persönlichen Herrschaft und der alles überragenden Entscheidungsgewalt Wilhelms II. gegen alle denkbaren Einreden zu immunisieren. So aber bietet er viel zu viel, wächst die Gefahr mit jeder Seite, dass der Leser in dieser Kakophonie von Stimmen d’outre-tombe ertaubt, in dem Sinn und das Verständnis für das Wesentliche abhanden kommt. Diese Gefahr wird umso größer, als Röhl auf wertende Zusammenfassungen, auf kritische Synthesen des mittels der umfangreichen Quellenzitate Mitgeteilten weitgehend verzichtet. Seine Rolle beschränkt er auf die eines Moderators, der allenfalls den Hintergrund oder das familiäre wie berufliche Herkommen einer Person erklärt, sich ansonsten aber mit erstaunlich inhaltsarmen Textbrücken bescheidet, die nur die dramaturgische Funktion haben, von einem Quellenfund zum nächsten überzuleiten. Zwar erfüllen die einzelnen Kapitel und Unterkapitel eine sowohl chronologische wie thematisch ordnende Aufgabe für diese Textmassen, aber das wird nur für den Spezialisten eine Hilfe sein.
Was sich bislang noch umständehalber als gewaltiges Bruchstück bestaunen lässt, wird, wenn es dereinst einmal vollendet ist, so steht zu befürchten, sich doch nur als die Aporie eines ungeheuren Torsos darbieten. Aber wie schon zahlreiche Generationen sich mit Baumaterial für Hütten und Paläste aus den Baumassen des Forum Romanum bedienten, so werden künftige Historiker unschätzbare Vorteile und Erleichterungen aus dieser wahrhaft titanischen Arbeit gewinnen. In diesen Bänden wird alles sorgfältig ausgewählt, zugerichtet und ausgebreitet sein, was es braucht, um nicht nur eine Biographie Wilhelms II. zu schreiben, sondern auch um mit der längst überfälligen Revision jener Ära zu beginnen verfassen, die allerspätestens seit dem 9.November 1989ff. in eine Vergangenheit entrückt ist, der man sich nicht mehr in nationalpädagogischer Absicht annähern muss. JOHANNES WILLMS
JOHN C. G. RÖHL: Wilhelm II. Der Aufbau der persönlichen Monarchie 1888 – 1900. C. H. Beck, München 2001. 1100 Seiten, 40 Abb., 88 Mark.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Wilhelm - Der Tragödie zweiter Teil: Vernichtende Urteile über den autistischen Absolutisten
John C.G. Röhl: Wilhelm II. Der Aufbau der Persönlichen Monarchie 1888-1900. Verlag C.H. Beck, München 2001. 1437 Seiten, 55 Abbildungen, 88,- Mark (Subskriptionspreis; ab 1. Januar 2002 dann 49,90 Euro).
Manchmal läßt der Biograph Gnade walten. Dann bemerkt er freundlich über den jungen Kaiser, daß Wilhelms "Gefühl der Überlegenheit" angesichts der europäischen Höfe "objektiv gesehen nicht ganz grundlos war. Mit der möglichen Ausnahme der englischen Königsfamilie war unter den Monarchen und Thronfolgern weit und breit kein redegewandter, energievoller, vielfach interessierter Fürst zu sehen, kein charismatischer Machtmensch, der sich mit Wilhelm hätte messen können." Solche Bemerkungen sind selten. Denn John C. G. Röhl schreibt über einen Herrscher, der sich in den zwölf Jahren von 1888 bis 1900 über alle und alles habe erheben wollen. Solche Ambition habe schon der Begriff "persönliche Monarchie" beinhaltet.
Unter Wilhelm II. wurde Deutschland Großmacht und scheiterte. Das allein ist, abgesehen von der spannenden und bizarren Persönlichkeit des letzten Kaisers, Grund genug, sich mit der deutschen Vorkriegspolitik zu befassen. Der britische Historiker Röhl hat daraus eine Lebensaufgabe gemacht. Im zweiten Band seiner Wilhelm-Biographie durchleuchtet er den Monarchen aus jedem denkbaren Blickwinkel: Wilhelms Selbstverständnis mit Blick auf Bismarck und auf England, auf "das monarchische Prinzip" und auf die Gesellschaft, sein Verständnis von Sozialpolitik und von politischer Beratung, das Charismatische am Kaisertum und der organisierte Übergang der Macht auf Wilhelm im "Dreikaiserjahr 1888". Röhl beschreibt minutiös das politische Erwachsenwerden dieses Herrschers - von politischer Reifung mag man nicht sprechen.
Kein Plan und kein Programm, keine Personalie, kein Skandal, keine Krise, die nicht dargestellt würden, meist aus zeitgenössischer Perspektive mit Zitaten und Paraphrasen, oft über mehrere Seiten. Röhl schreibt im Vorwort, er habe sich für die "quellennahe Darstellungsform" entschieden, damit die Leser die Texte kennenlernen könnten, "die mich zu meiner eigenen Auffassung von der wachsenden Macht und dem verderblichen Einfluß Wilhelms II. bewogen haben".
Zumal das "Verderbliche" ist nicht zu übersehen. Röhls Kronzeugen gegen Wilhelm II. garantieren das. Über viele hundert Seiten gehören Wilhelms Mutter Victoria und der General Alfred Graf von Waldersee zu den wichtigsten Auskunftgebern. Die "Kaiserin Friederich" erweist sich als nimmermüde Besserwisserin, deren Ressentiments gegen ihren Sohn etwas Erstaunliches haben. Kaum einmal scheint sich diese Frau gefragt zu haben, wer und was ihren Sohn zu dem autistischen Absolutisten gemacht hatten, der er war. Röhl hat diese Frage im ersten, überaus beeindruckenden Band seiner Wilhelm-Biographie beantwortet. In dem 1993 veröffentlichten Buch hat er - zugespitzt - davon erzählt, wie man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Kinder erzog und malträtierte, zumal dann, wenn die Kinder den elterlichen Erwartungen nicht entsprachen. Die Queen-Victoria-Tochter Victoria, Witwe des 99-Tage-Kaisers Friedrich III., wurde von ihrem Sohn, dem jungen Kaiser Wilhelm II., genauso lieblos behandelt, wie er es von ihr gewohnt war.
Röhls zweiter Kronzeuge für den mißratenen Charakter des jungen Herrschers ist Graf Waldersee. Er kommt bei Röhl so ausgiebig zu Wort, daß er Zeilengeld verlangen könnte, lebte er noch. Röhl begründet dies im Vorwort damit, daß er den Original-Waldersee wiederhergestellt habe, nachdem dessen Tagebücher 1922/23 "in einer geradezu skandalös beschönigten Fassung" veröffentlicht worden waren. Nun also der echte Waldersee "mit seinen vernichtenden Urteilen über Wilhelm II".
Vernichtende Urteile: Der Generalstabschef, erst Berater Wilhelms, dann - nach seiner Entlassung 1891 - einer von des Kaisers schärfsten Kritikern, ließ seine Beobachtungen in eine Art psychiatrisches Gutachten münden, das Röhl wiedergibt: Größenwahn und autokratische Neigungen, Selbstüberschätzung, Unfähigkeit, feste Ziele anzustreben, Arbeitsunlust, Oberflächlichkeit, Dilettantismus, Empfänglichkeit für Schmeicheleien und ein Hang zum Obszönen. Das miserable Verhältnis Wilhelms zu seiner Mutter mindert die persönliche Verantwortung dieses wahrscheinlich überforderten Mannes nicht. Er fühlte sich in seinen Entscheidungen nicht dadurch behindert, daß er - wie man heute sagen würde - ein ungeliebtes Kind gewesen ist. Er hat geredet, geurteilt und entschieden, wie er später, im Exil, Holz gesägt hat: ohne Maß und manisch, berserkerhaft und unbedacht, sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste. In seinen besten Jahren als junger Kaiser dürfte er einen Teil seiner großen Energie darauf verwandt haben, alle Zweifel und Selbstzweifel zurückzudrängen und niederzumachen.
Darüber hinaus aber ist der große Unterschied zwischen dem, was kluge Zeitgenossen über den Kaiser dachten, und dem, was sie ihm sagten, durchaus der Erwähnung wert. Das ist, neben des Kaisers Ambition, das zweite Thema dieses Buches: Wie kam es denn, daß in der konstitutionellen Monarchie des Bismarck-Reiches der Monarch immer stärker, der Reichstag aber immer schwächer wurde? Die Stärkung des "Persönlichen Regiments" ging von Wilhelm aus und hing mit seinen ausgreifenden Vorstellungen vom Regieren zusammen. Der Kaiser befaßte sich mit der Flotte und dem Berliner Dom, der Arbeiterfrage und den Kolonien. Er interessierte sich für alles und mischte sich überall ein, und dies in einem dauernden Hin und Her von Teilnahme und Desinteresse, von Verantwortung und Abwesenheit. Vieles, so scheint es heute, geriet ihm durcheinander. Er empfand Sympathie für die Arbeiter und stieß den Landadel vor den Kopf, und er glaubte, Politik funktioniere auf der Hochebene des europäischen Hochadels, losgelöst vom parlamentarischen Betrieb. Er zitierte Botschafter und desavouierte Minister so rüde, bis sie ihre Ämter leid waren.
Wer will, kann in dieser Biographie einen in seiner Begeisterungsfähigkeit und seiner Unvernunft sehr deutschen Monarchen kennenlernen. "Selbst so unscheinbare Details wie die Wetterfahne entgingen der kaiserlichen Aufmerksamkeit nicht", schreibt Röhl - in einem seltenen Anfall von Ironie - über des Kaisers Anteilnahme am Entwurf und am Bau des Berliner Doms. Doch nicht die Aufgeregtheit und die jungenhafte Inkonsequenz seiner Regierungsarbeit waren die Hauptprobleme der wilhelminischen Monarchie. Wilhelm konnte sich seinen Regierungsstil in einer Umgebung installieren, die ihm kaum Widerstand entgegensetzte. Es ist schade, daß Röhl in dem Kapitel über den "Durchbruch zur unumschränkten Entscheidungsgewalt" im Jahr 1896 die damalige verfassungspolitische Debatte nur erahnen läßt. Sie ging nämlich ins Grundsätzliche, und es gab durchaus kluge Köpfe, die die Gefahren des wilhelminischen Amtsverständnisses sahen. Sie äußerte sich auch - aber offenbar nur in privaten Briefwechseln. Dieser so umfassenden und tiefgrabenden Biographie hätte es gutgetan, wenn sie an einigen wichtigen Wendepunkten des persönlichen Regiments das Gesichtsfeld etwas erweitert hätte. Manchmal handelte es sich eben nicht nur um menschliches Versagen Wilhelms II., sondern es versagte offenbar auch die eine oder andere Institution.
Wilhelm mag ein Autokrat gewesen sein, taub war er nicht. Er reagierte empfindlich auf Kritik und betrieb eine überaus konsequente Personalpolitik: Wer nicht unter ihm für ihn war und bereit, sich führen zu lassen, der wurde kaltgestellt. Und doch ist es merkwürdig, daß kaum jemand, der es gut mit ihm und dem Land meinte, diesen Kaiser beeinflussen konnte. Philipp Eulenburg, des Kaisers bester Freund, versuchte es. Mit Erfolg widerprach ausgerechnet Paul Wallot, der Baumeister des Reichstages, dem Imperator Rex - er war offenbar der einzige, der Wilhelm mit den Worten "Majestät, das geht nicht" eine Grenze setzte. Mit diesen Worten verbat sich Wallot den schulterklopfenden Versuch, dem Baumeister in die Arbeit am Reichstag hineinzureden. Es wirkte. Röhl weist darauf hin, daß beim Reichstag die Rechtslage anders war als zum Beispiel beim Dom, bei dem des Kaisers Mitsprache vertraglich fixiert worden war.
Weil der Kaiser keinen Widerspruch erfuhr und scheinbar nur Bestätigung wollte, sieht man einer persönlichen Entwicklung zu, die Wilhelm II. in die geistige und psychische Isolation führte. So wurde er der Kaiser der schäumend-starken Worte, der "Hunnenreden" hielt und die deutsche Annexion der chinesischen Stadt Kiautschou kommentierte: "Tausende von deutschen Christen werden aufatmen, wenn sie des Deutschen Kaisers Schiffe in der Nähe wissen werden, Hunderte von deutschen Kaufleuten werden aufjauchzen in dem Bewußtsein, daß endlich das Deutsche Reich festen Fuß in Asien gewonnen hat, Hunderttausende von Chinesen werden erzittern, wenn sie die eiserne Faust des Deutschen Reichs schwer in ihrem Nacken fühlen werden, und das ganze Deutsche Reich wird sich freuen, daß seine Regierung eine mannhafte Tat getan."
Aus solchen Sätzen dröhnt der Wilhelm, den man kannte. Daß er ein schwieriger und verspannter Charakter und ein gefährlicher Politiker war, wußte man allerdings schon vor diesem monumentalen zweiten Band einer überaus persönlichen Biographie; man wußte dies vor allem aus Röhls zugespitzten, ebenso schlanken wie klugen Untersuchungen über "Kaiser, Hof und Staat". Auf weit über tausend Seiten präsentiert Röhl kaum einen anderen als den dröhnenden, anmaßenden, in die Komplikationen der eigenen Persönlichkeit und die eines viertel-demokratischen und dreiviertel-ständischen Regierungssystems verstrickten Wilhelm. Nach der Lektüre fragt sich der geneigte Leser dann doch, ob er es so genau wissen will.
WERNER VAN BEBBER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nun liegt der zweite Band des englischen Historikers Röhl über Wilhelm II. vor, der, wie der Rezensent Werner van Bebber meint, eine minutiöse Studie über dessen durchaus komplizierten Charakter vorlegt. Der Autor betrachte den Werdegang des Kaisers aus allen möglichen Perspektiven und trägt dabei kein besonders positives Bild vor. Dennoch befindet Bebber, dass der Biograf manchmal gut daran getan hätte, das Gesichtsfeld dieser Studie ein wenig zu erweitern, denn schließlich handle es sich nicht immer um ein rein menschliches Versagen des Monarachen, sondern auch manchmal um das einer Institution. Bei einer mehrbändigen Biografie, deren zweiter Teil allein schon über 1400 Seiten umfasst, kann man wohl Bebber recht geben, wenn er am Ende der Besprechung fragt, ob der geneigte Leser, es denn so genau wissen will.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH