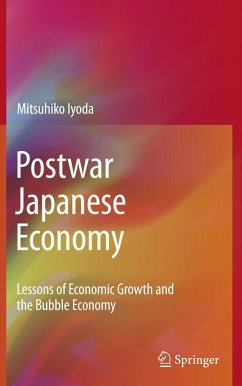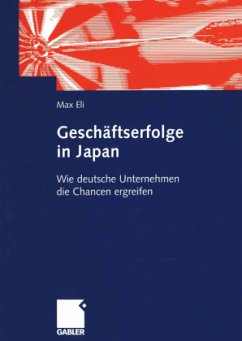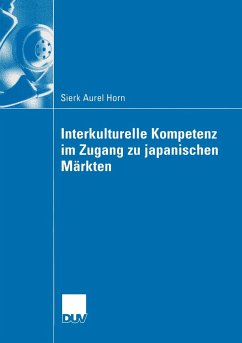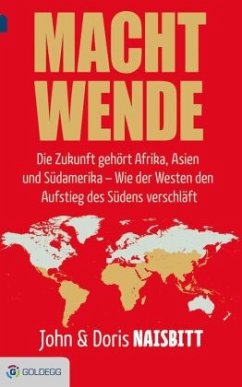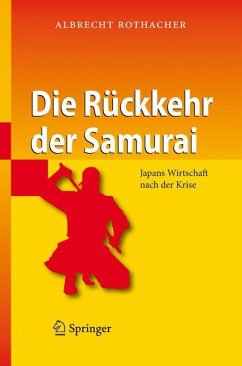symbolisiert der alle zwanzig Jahre abgerissene und wieder erneuerte Ise-Schrein Japans Kultur des ewigen Wiederaufbaus. Pillings Themen sind dabei die ersten Schritte vom Feudalismus in die Moderne, als das über zweihundert Jahre abgeschottete Land sich in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts dem Druck der Vereinigten Staaten beugen und sich dem Weltmarkt öffnen muss, die "Umarmung der Niederlage" (John W. Dower) 1945 und die Genese des Wirtschaftswunders. Schlaglichter fallen dann auch auf die 1990 geplatzte Spekulationsblase, das krisenhafte Jahr 1995 mit dem Kobe-Erdbeben und dem Giftgas-Anschlag in der U-Bahn von Tokio und natürlich auf Fukushima.
Japans Selbstgefallen an der insularen Isolierung, verknüpft mit dem Drang, sich einen Platz in der Weltordnung zu sichern, sieht der Autor als "das japanische Paradox". Unter dem Stichwort "Abschied von Asien" erläutert er Japans gleichwohl als "Befreiung Asiens" kaschierte koloniale und kapitalistische Moderne. Die Meiji-Restauration (1868 bis 1912) war "Revolution, Widerstand und Kapitulation in einem". Erst Erfolge im Japanisch-Chinesischen Krieg 1895 und über Russland 1905 ließen Japan in den Kreis "zivilisierter" Nationen aufsteigen. Japans Modernisierer entwarfen am Ende der "splendid isolation" im Namen des Kaisers und unter der Devise "aufgeklärte Herrschaft" (Meiji) ein Japan in europäischen Begriffen. Nach dem Kollaps der 1940 propagierten "Großostasiatischen Wohlstandssphäre" tauschte Japan, so Pillings Einschätzung, den Kaiserkult schließlich gegen die "Vergötterung des Bruttosozialprodukts" ein. Die ökonomischen Wunderjahre samt ihren staatlich garantierten Versprechen sicherer Erwerbsbiographien endeten erst Anfang der neunziger Jahre.
Pilling beleuchtet die postindustrielle Krise der japanischen Wirtschaft und demographischen Entwicklung. Den Niedergang der einst führenden Elektronikindustrie erklärt er mit dem sogenannten Galapagos-Syndrom: Danach waren Technologien wie das fast zehn Jahre vor dem iPhone entwickelte internetfähige Telefon zu eng auf den heimischen Markt zugeschnitten. Zur mangelnden Durchsetzungskraft auf dem Weltmarkt kommen das Problem der Überalterung bei gleichzeitig niedrigen Geburtenraten und die steigende Jugendarbeitslosigkeit. Verlierer der New Economy sind "Hikikomori" (Leute, die sich im Cyberspace einschließen) oder "parasite singles" (Dreißigjährige, die noch bei den Eltern wohnen). In einem Kapitel, das den Titel "Hinter dem Schirm hervor" trägt, erläutert Pilling den Trend zur späten Heirat und das Aufkommen neuer Geschlechterbilder. Vernachlässigt werden von ihm auch nicht diplomatische Streitthemen wie die regelmäßig zu Kontroversen führenden Besuche japanischer Minister und Regierungschefs am Yasukuni-Schrein, wo auch Kriegsverbrechern gedacht wird. Debatten über die Darstellung japanischer Geschichte in den Schulbüchern hängen damit unmittelbar zusammen.
Hervorzuheben ist Pillings Darstellung der gesellschaftlichen und politischen Folgen der Katastrophen von Kobe und Fukushima. Der eingangs genannte Untersuchungsausschuss legte im Fall Fukushima ein Netzwerk aus Unternehmen, Bürokraten und Aufsichtsinstanzen offen. Der atomare Imperativ, so resümiert Pilling die Aufarbeitung, brachte eine Kultur der Leugnung zum Vorschein. Das Scheitern der staatlichen Aufsicht im Land der grell leuchtenden Automaten und begeisterten Stromverschwendung stärkte aber auch den Sinn für die Zivilgesellschaft. Die beim Kobe-Erdbeben eingeleitete "Freiwilligenära" schlug sich in Fukushima in unbürokratischer humanitärer Hilfe des Non-Profit-Sektors nieder. Das "japanische Paradox" ist damit freilich noch nicht aufgelöst.
STEFFEN GNAM
David Pilling: "Japan". Eine Wirtschaftsmacht erfindet sich neu.
Aus dem Englischen von Ursula Held und Reinhard Tiffert. Carl Hanser Verlag, München 2013. 408 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
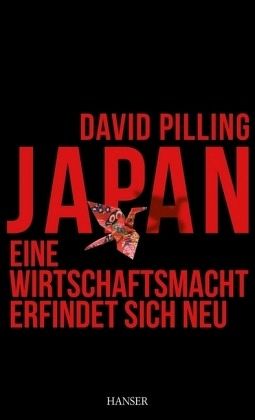





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.2014
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.2014