"Unten", das "Wir" und das "Die da" besteht in Indien in abgemildeter Form bis heute. Darum ist es psychologisch aufschlussreich zu beobachten, wie sich die Menschen verändern, wenn sie plötzlich mit ihrem Gegenpart am anderen Pol der gesellschaftlichen Werteskala auf engem Raum zusammenleben müssen. Die Reisenden auf der Ibis nannten sich trotzig "Schiffsbrüder" und "Schiffsschwestern".
Um 1830 stand die Konfrontation mit der Moderne gerade bevor. Die Macht des britischen Raj war mit Hilfe der East India Company, seinem wirtschaftlichen Arm, schon gefestigt. Die Sozial- und Religionsreformen, die man "bengalische Renaissance" nennen würde, begannen gerade. Denn im Jahr 1828 gründete Ram Mohan Roy in Kalkutta den Brahmo Samaj, jene Vereinigung, die den Missständen des traditionellen Hinduismus den Kampf ansagte. Ein Jahr später verbot die britische Regierung die Witwenverbrennung. Die erste Welle des Aufruhrs gegen die Kolonialherren hatte sich aber noch nicht erhoben. Zwar lernte die Elite schon Englisch und besuchte britische Schulen, doch beherrschte der Hinduismus mit seinen gesellschaftlichen Zwängen, seinem Ritualismus und seinen Reinheitsvorschriften weiterhin die Gedanken und Gefühle der Menschen.
Amitav Ghosh hat eine erstaunliche geschichtliche Entdeckung gemacht, die zum Angelpunkt seines Romans wird: Die Finanzkraft des britischen Kolonialreichs hing wesentlich vom Opiumhandel mit China ab. Zu dieser Zeit wurden jährlich rund neunhundert Tonnen Opium nach China geschifft, schreibt Ghosh auf der Website zum Roman (www.seaofpoppies.com). Tausende von Bauern im heutigen Bihar wurden gezwungen, statt Reis Mohn anzubauen. Das machte sie von den Launen des Opiumhandels abhängig und ließ viele verarmen, doch die Regierung strich immense Gewinne ein. Als sich China gegen die Droge wehrte, die Millionen von Opiumkonsumenten in heillose Abhängigkeit brachte, begannen die Briten in den vierziger und fünfziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts die "Opiumkriege", bei denen sie über China triumphierten. Erst die Errichtung des Mao-Reiches Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, so Ghosh, zerschlug diesen Nexus.
Die Verarmung der Landbevölkerung hatte zur Folge, dass sich viele Männer und Frauen zu Vertragsarbeit in Übersee einschifften. Im letzten Jahr feierte die Welt das Verbot des Sklavenhandels in Großbritannien und den Vereinigten Staaten vor zweihundert Jahren. Doch dass wenig später ein beinahe ebenso grausamer Handel mit Vertragsarbeitern, den "Girmitiyas", einsetzte, ist kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Während sich der Sklavenhandel auf Afrika konzentriert hatte, kamen die Girmitiyas aus Asien, vor allem aus Indien, und wurden in die Karibik, nach Südafrika und auf die Insel Mauritius verschickt. Angeblich verließen sie ihre Heimat zwar freiwillig, doch Ghoshs Roman dokumentiert, wie viel diese Freiwilligkeit wert war. Von bitterer Armut getrieben, von ihren Dörfern aufgrund kleiner Vergehen ausgestoßen, von Agenten überredet oder einfach zusammengepfercht, kamen sie in Kalkutta an, um von dort unter unmenschlichen Bedingungen das "Schwarze Wasser" zu überqueren. Im Roman ist das Segelschiff "Ibis" nicht von ungefähr ein umgerüstetes Sklavenschiff.
Amitav Ghoshs Werk ist in drei Teile gegliedert: "Land", "Fluss" und "Meer". In den ersten beiden Teilen erzählt er mit überschwenglichem Interesse an realistischen Geschichtsdetails (er nennt es "Genauigkeit der Phantasie") die Lebensschicksale von rund einem Dutzend Personen. Einige kommen aus dem ländlichen Nordindien und fahren in Kähnen auf dem Ganges nach Kalkutta; andere stammen aus dem städtischen Milieu Kalkuttas. Sie betreten schließlich (im dritten Teil) gemeinsam die "Ibis", um auf ihr als Vertragsarbeiter, Matrosen, Gefangene oder Gäste zur Insel Mauritius zu segeln. Die erste Geschichte beginnt in Ghazipur, jenem Ort im heutigen Bihar, in dem die größte Opiumfabrik des britischen Reiches stand. Ausführlich beschreibt der Autor, wie Mohn angepflanzt, sein Saft extrahiert und behandelt wird und wie mittels eines komplizierten Verfahrens daraus unterschiedliche Arten von Opium gewonnen werden. Hier ist Ghosh, wie schon in seinem letzten Roman "Hunger der Gezeiten" (2004), in der Gefahr, den Wissenschaftler - er war bis vor kurzem Anthropologe an amerikanischen Universitäten - über den Erzähler zu stellen.
Diti ist die Frau eines Angestellten der Opiumfabrik, der selbst dem sanften Gift verfallen ist. Als er stirbt, will die Witwe "Sati" begehen, das heißt, sich mit der Leiche ihres Ehemannes verbrennen lassen. Der niedrigkastige Kutscher Kalua rettet sie jedoch und flieht mit ihr. Aus Angst vor den Verfolgern und aus Überlebensnot begeben sie sich in die Hände eines Agenten für Vertragsarbeiter. Im entgegengesetzten Milieu lebt Raja Nil Rattan, ein Großgrundbesitzer, der gelangweilt in dem feudalistischen Luxus seines Anwesens von Kalkutta wohnt. Er ist dem britischen Geschäftsmann Benjamin Burnham verschuldet, der durch einen juristischen Trick den gesamten Besitz des Rajas an sich reißen kann, der zu Strafarbeit auf der Insel Mauritius verurteilt wird. Zwischen dem Unten und dem Oben stehen zwei weitere Figuren. Da ist einmal Paulette Lambert, die Tochter eines verstorbenen französischen Botanikers, die mit Einheimischen in Kalkutta aufgewachsen ist, Bengali spricht und sich in einen Sari kleidet. Sie wird von den Burnhams gütig adoptiert, doch muss sie vor den sexuellen Angriffen des mächtigen Händlers fliehen. Sodann irrlichtert Babu Nob Kissin durch das Buch, ein frommer Hindu, der Handlanger des Briten und sein Mann fürs Grobe. Dessen bizarre religiöse Phantasien treiben ihn dazu, einerseits mit den Kolonialherren, andererseits mit Paulette und dem Steuermann der "Ibis", Zachary Reid, einem amerikanischen Mulatten, zu paktieren. Zuerst voneinander getrennt, verflechten sich diese Geschichten immer dichter miteinander und verknoten sich schließlich auf dramatische, ja blutrünstige Weise während der Schiffsreise.
Auf dem Schiff lernen wir noch seinen britischen Kapitän und Jack Crowle, den niederträchtigen ersten Steuermann, kennen. Der schottische Schriftsteller William Dalrymple machte Amitav Ghosh zum Vorwurf, dass alle britischen Charaktere böse oder schwach und hochmütig gezeichnet sind. Das ist gewiss richtig. Obwohl Ghoshs Schilderung nicht Partei ergreift und sich auf Fakten stützt, kann "Das mohnrote Meer" als antikolonialer Roman bezeichnet werden. Die Menschenverachtung, mit der die Kolonialherren ihre Untergebenen behandelten, mit der sie auch rücksichtslos Millionen von Menschen in China und Indien in die Opiumsucht trieben, wird hier so deutlich, dass einem das Blut in den Adern gefriert.
Amitav Ghosh liebt das Wasser, das Meer, wie er in einem Interview gestand. Die breiten Flüsse, die vielen Dorfteiche und die lange Meeresküste seiner bengalischen Heimat prädestinieren ihn dazu. Um diese Schiffsreise authentisch zu beschreiben, habe er sogar segeln gelernt. Bis hin zu der charakteristischen Matrosensprache und den technischen Begriffen der Seefahrt hat sich der Autor eingearbeitet und eingefühlt. Im englischen Original differenziert er brillant zwischen den unterschiedlichen Dialekten und Sprachebenen - dem elegant-gestelzten Englisch des Raja, dem indisch-englischen Kauderwelsch des Babu Nob Kissin, dem jovialen Argot der britischen Händler und sogar dem französisch durchmischten Englisch der Paulette. Denn Ghosh liebt nicht nur das Meer, er liebt auch die Wörterbücher verschiedener Sprachen und Dialekte. Diese Neigung macht das englische Original oft mühsam zu lesen. Die deutsche Übersetzung konnte die Dialekte und Spracheigenheiten nur ansatzweise nachahmen. Man dankt den Übersetzern, dass sie zahlreiche fremdländische Begriffe eingedeutscht oder ausgelassen haben. Darum ist die Übersetzung flüssiger zu lesen als das Original. Dennoch hätte man sich ein Glossar gewünscht. Ghosh bietet auf seiner Website aber immerhin eine Liste mit Erklärungen von Seemannsausdrücken und indischen Begriffen.
Schon sein Roman "Der Glaspalast" (2001), mit dem Amitav Ghosh international bekannt wurde, zeigte sein Interesse an breiten geschichtlichen Stoffen und die antikoloniale Triebfeder dahinter. Damals verband er Indien mit Burma und Asien mit Nordamerika. In diesen Rahmen stellte er seine bevorzugten Themen, nämlich das Schicksal indischer Migranten und Flüchtlinge und die daraus resultierenden Probleme der Identität. Einem solchen grenzüberschreitenden Rahmen sowie denselben Themen wendet sich der Schriftsteller auch hier zu, und zwar mit noch größerem Ehrgeiz. "Das mohnrote Meer" ist der erste Band einer geplanten Trilogie, der "Ibis-Trilogie", an der Ghosh, heute 52 Jahre alt, vielleicht den Rest seines Lebens schreiben wird. Denn noch segelt die "Ibis" vor hartem Wind in der Bengalischen Bucht. Gerade erst ist der erste Steuermann ermordet worden und der Mörder im Boot geflohen. Wird die "Ibis" Mauritius erreichen? Werden die Vertragsarbeiter dort in die Plantagen geschickt? Ghosh pendelt unterdessen zwischen Indien und Amerika und schreibt weiter.
"Das mohnrote Meer" gestaltet, realistisch und spannend erzählt, ein erstaunliches Panorama bewegender Schicksale. Der Roman deckt die Quellen jener sozialen Zustände auf, an denen Indien bis heute leidet: an Klassen- und Kastendiskriminierung, an feudalistischer Mentalität, an der postkolonialen Frustration. Wem dies bewusst wird, der kann dieses Werk nicht nur als geschichtlichen Roman lesen.
- Amitav Ghosh: "Das mohnrote Meer". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Barbara Heller und Rudolf Hermstein. Blessing Verlag, München 2008. 619 S., geb., 21,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
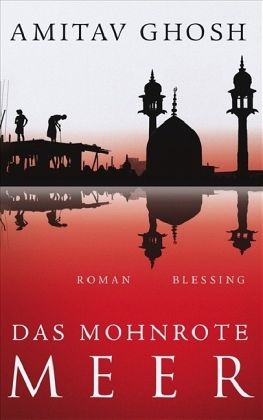



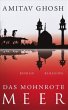

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.08.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.08.2008