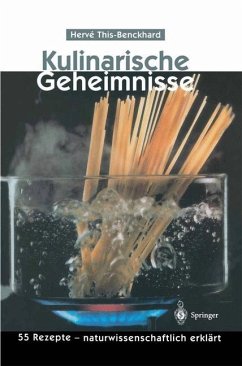auf einer Seite längere Beine hat, damit es in den schottischen Highlands besser stehen kann; um einen Haggis zu fangen, treibt man ihn ins flache Land, dann fällt er um).
Eine sechs Seiten lange Liste "Die Wurst in Literatur und Filmkunst" demonstrierte, wie das Alberne durch pure Quantität ins Komische umschlagen kann. ("Wenn das Wurstbrot zweimal klingelt", "Lohn der Wurst", "Angst essen Wurstbrot auf", "Für eine Handvoll Wurst", "Die bleierne Wurst", "James Bond: Stirb an einer andern Wurst", "Down by Wurst", "Sommerwurst, später", oder ganz aktuell: "Elementarwürstchen"). Ernsthaftere Essays befassten sich mit der Entschlüsselung des alphabetischen Zeichensalats, der die Zusatzstoffe preisgibt, oder dem Geisterseher und Wurstgiftentdecker Justinus Kerner, der sich durch gefährliche Selbstversuche zum Experten für die Wirkung des damals noch unbekannten Bazillus stählte, dessen Botulinumtoxin heute die Münder der Militärs wässert.
Warum, andererseits, darf man auch am Karfreitag Hühnchen essen? Eine Exkursion in fränkische Klosterküchen gab die Antwort: Fische und Hühner sind am selben Tag vom Herrgott geschaffen worden, und wenn man das Huhn nur recht tief in den Kochtopf taucht, steigt es empor wie ein Fisch - so jedenfalls der Abt des Klosters Fuldas, Hrabanus Maurus, im neunten Jahrhundert, ein Dialektiker des Appetits offenbar eher als der Strenggläubigkeit. Die Pointe des Heftes waren die Zeichnungen von Nikolaus Heidelbach - der Meister auf der Höhe seiner Kunst, lässig, nonchalant, obszön und komisch.
Ein ganzes fadengebundenes, edel ausgestattetes Werk "Wurst" folgte, und man möchte kaum glauben, dass eines der charmantesten Bücher der Saison daraus wurde. Das verdankt sich vor allem wieder Heidelbach, der sich noch einmal gesteigert hat und im Wurst-Furor dem Thema einige seiner schönsten Blätter abgewinnt - die in Zungenwurst gehüllte Jugendstilbeauté, die drei Würstchenträgerinnen in der Serengeti, die düstere Graustudie "Sozialfall Schaschlik", die Wiener Prostituierten oder "Jahwes Würstchenparadies" in paradiesischem Frühnebel-Ocker - allein dieser Bilder wegen ist "Wurst" ein ebensolches unzüchtiges Paradies.
Dazu gibt es hübsche Pastiches von Droste über die Wurstförderung in sächsischen Stollen (die den Kaligeschmack der sozialistischen Wurst erklärt) und Rezepte von Vincent Klink ("Jambon Persillé", "Fieser Wurstgulasch", "Wielandshöhe"), der auch als temperamentvoller Erzähler überrascht. Der Schlachttag einmal im Jahr in der schwäbischen Provinz, sein Besuch des Oktoberfests mit vier afrikanischen Kollegen, die der Maß und der Schweinswurst verfallen ("Allah schaut weg"), das Weißbierfrühstück im Münchner Franziskaner oder das stumm gefräßige Paar in der Zürcher Kronenhalle - das schildert der Meisterkoch hoch amüsant.
Aber genug geredet! In der Wurstküche der Klinks herrschte Stillschweigen, denn der Aberglaube berichtete von zerredeten Würsten, die fad und ausgekocht alle Bemühungen zunichte machen würden. Geben wir nur noch einige Nachträge zur Wurst in Literatur und Filmkunst: "Angst essen Wurstbrote auf", "Die Wurst von Monte Christo", "Der Mann den sie Wurst nannten", "Der mit der Wurst tanzt", "Die Wurst, das sind die anderen" (Sartre), "Mehr Wurst" (Goethe). Wurst ist schlimmer als Heimweh, und vor den Würsten sterben die Söhne. Denn die Wurst stirbt zuletzt.
MICHAEL MAAR
"Häuptling Eigener Herd". Heft 26. Edition Vincent Klink, Stuttgart 2006. 133 S., Abb., geb., 14,90 [Euro].
Wiglaf Droste, Nikolaus Heidelbach, Vincent Klink: "Wurst". DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln 2006. 159 S., Abb., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
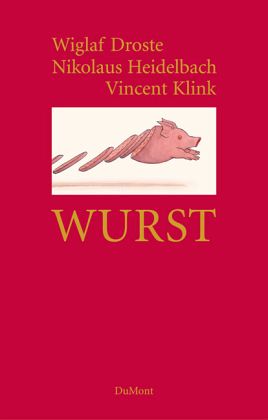





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.01.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.01.2007