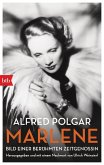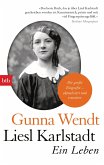Richard Burton, Bergarbeiterkind aus der walisischen Provinz, galt als größter Schauspieler seiner Generation und zählte in den 60er und 70er Jahren zur obersten Riege Hollwoods. Seine turbulenten Ehen mit Elizabeth Taylor und ihr glanzvolles Jetset-Leben, aber auch ihre tragischen Abstürze machten die beiden zu den prominentesten Figuren ihrer Zeit. Burtons erstaunlich unterhaltsame, witzige, kluge, oft auch nachdenkliche Tagebücher der Jahre 1965 bis 1972 sind das Zeugnis eines Filmstars, der trotz allem Ruhm und Reichtum ein tief zerrissener Mann war, der die Schauspielerei ebenso verachtete wie liebte, der dem Alkohol verfallen war und der ohne seine »E« kaum leben konnte.

Mannes Pilgergang
Viele Jahre lang hat Richard Burton Tagebuch geführt, über Kollegen,
Politik, seinen Alkoholismus und seine Frau Elizabeth Taylor. Ein Stück
starke Literatur eines Mannes, der die Schauspielerei im Herzen hasste
VON FRITZ GÖTTLER
Der Mann ist absolut begeisterungsfähig, sein Enthusiasmus berührt zutiefst. Da kam ein Brief von Professor Francis Warner aus Oxford, im Oktober 1968, ob Richard Burton eine Vorlesung halten wolle in St. Peter’s. „Ich bin ganz aufgeregt und will ihm schreiben, und vorschlagen, dass ich im Sommer 1970 kommen werde. Er sagt, er wolle uns Zimmer dort geben, und ich werde ihm anbieten, dass er dafür unsere Yacht oder eines unserer Häuser haben kann. Er sagt, er braucht eine Auszeit . . . Ich habe ja immer schon Gelüste nach dem akademischen Leben gehabt wie eine Schwangere.“ Ein phantastischer Deal, tausche Glamour- gegen akademisches Leben, und vice versa.
Mit Arbeit an der Literatur ging Burton schon lange schwanger, auf nahezu jeder Seite seiner Tagebücher wird vermerkt, welche Bücher er sich besorgt hat, was er gerade liest, in der Sonne, in einem Café oder im Bett, ein Glas neben sich, bis tief in die Nacht hinein. Gern würde der Weltstar aus Wales in Oxford walisische oder irische Autoren behandeln, seine geliebten „Fantasticks“, Donne und Traherne, Henry Vaughan und George Herbert. „Dieser Herbert hatte Dinge zu bieten wie ein doppelt bestückter Pralinenkasten. Von der englischen Sprache geht für mich der gleiche Zauber aus wie von einer schönen Frau.“ Tagebücher sind gewöhnlich ein zwiespältiges Genre, aber die von Richard Burton sind ganz eindeutig. Hier ist nichts intimistisch oder verdruckst, keine Spur eines bedenklichen „Nicht für die Veröffentlichung bestimmt“. Sie gehen von Anfang an in die Offensive, geben sich aggressiv für Öffentlichkeit bestimmt. Die Nazi-Version von Tab Hunter nennt er Hardy Krüger, mit dem er nicht wirklich gut auskommt, beim Drehen. Der Kollege Rex Harrison trägt Mäntel, wie es nur ein Kleiderbügel kann, seine Frau Rachel malträtiert ihn und liegt, wenn sie mal wieder restlos besoffen ist, auf dem Boden der Bar und bellt wie ein Hund. Boshaft stellt Burton eines Abends den Kritiker Kenneth Tynan Humphrey Bogart vor – „Bogie, das ist ein gewisser Mr. Ken Tynan, der kürzlich im Evening Standard über dich schrieb und dein Gesicht als ,Triumph der plastischen Chirurgie‘ bezeichnete“ – und bringt den armen Mann damit völlig aus dem Tritt, „ein stammelnder, stotternder Totenschädel. Ken hat schon immer ausgesehen wie Belsen im Anzug. Dachau im Dress. Buchenwald in braunem Samt.“ Eine grausige Zärtlichkeit, aber auch ein literarischer Stilwille – und der Alkohol schärft noch mal seine walisische Härte.
Das Tagebuch eines Trunksüchtigen sagt er selber. Mit sarkastischer Penibilität listet er das tägliche Quantum auf, früh Bloody Marys, mittags ein, zwei Flaschen Wein, dazwischen Campari Wodka Soda. Seine Frau Elizabeth Taylor, die manchmal alkoholisch mit von der Partie ist, hat die Einträge regelmäßig gelesen und auch selbst ein paar Passagen beigesteuert. Glorious, Slowtake oder Fatty nennt er sie zärtlich poetisch.
Manchmal gibt es mehrwöchige oder -monatige Lücken im Ablauf, ansonsten ist eine strenge, egozentrische Schreibdisziplin zu spüren. Im Vergleich zur englischen fehlen in der deutschen Ausgabe einige Jahre, aus der Jugend, 1939/40, und dann 1960, auch in den Siebzigern hat Burton nur sehr sporadisch Tagebuch geführt. Die deutsche Ausgabe startet in der Post-Cleopatra-Zeit, sie geht vom Januar 1965 bis März 1972, das heißt sie präsentiert die Tagebücher wie einen literarischen Text, einen Lebensroman. (Mit Erstaunen liest man, dass Burton auch einige seiner Kollegen – Robert Mitchum, Marlon Brando, Montgomery Clift, vielleicht auch Peter O’Toole – für potenzielle Literaten hält.)
Der Band fängt ein wenig stolpernd und monoton an, dem Klatsch mehr zugeneigt als der persönlichen Reflexion, aber dann entwickelt er einen Drive, einen grandiosen Sog, der von dem Paar im Zentrum, der Glamour-Super-Kombination Taylor/Burton ausgeht, die für Jahre die Schlagzeilen bestimmen, eine relativ offene Hofhaltung haben und ein lebhaftes Familienleben mit Kindern aus diversen Ehen. „Ah, mein Freund“, wird der wunderbare Kollege Roscoe Lee Brown zitiert, „selbst die königliche Familie ist es gewohnt zu warten, wenn die Burtons da sind. Ihre Anziehungskraft ist ein Naturgesetz, so wie der Mond die Gezeiten steuert.“
Burton/Taylor waren ein paradigmatisches Star-Paar in einer Zeit, als das Starsystem schon heftig bröckelte – symptomatisch dafür der Film, der sie zusammenbrachte, „Cleopatra“, 1963, eine der großen Schlagzeilen-Lachnummern der Kinogeschichte. Geschaffen von einem, der ähnliche Probleme mit Hollywood hatte wie Burton, Joseph L. Mankiewicz, einer der überdrehten Intellektuellen, die es nach Hollywood verschlagen hatte. „Cleopatra“ war ein Produktionsdesaster in Millionenhöhe, der Hollywood-Shakespeareaner Mankiewicz musste den Film übernehmen, als noch gar kein fertiges Drehbuch da war, die Bauten wurden errichtet, bevor es die Szenen gab, die darin spielen sollten. Mankiewicz arbeitete bis zur Erschöpfung, nur die Schauspieler standen zu ihm. Burton, der Erfolg gehabt hatte am Broadway oder im Old Vic in London wie in Hollywood, als Hamlet wie als Alexander im Film von Robert Rossen, muss den Niedergang gespürt haben. Seine Filme mit Elizabeth waren zwar überaus erfolgreich, „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von Mike Nichols und „Der Widerspenstigen Zähmung“ von Franco Zeffirelli, aber dann spielt er plötzlich Tito und Blaubart oder, in seiner einzigen Ko-Regie, den Doktor Faustus. Dass er es allemal besser gekonnt hätte als die meisten seiner Regisseure, daran lässt er nie einen Zweifel. Er führt Schattengefechte gegen die immer stärker aufkommende Autorentheorie. Nein, erklärt er trotzig, die Leute gehen doch nicht für einen Film von Joseph Losey oder Nick Ray – die er beide mag und schätzt – ins Kino, sondern für die Stars.
Es ist ein Tempowechsel, in den Fünfzigern, den Burton, der Sohn eines Bergmanns, stärker spüren mag als die anderen angry young men seiner Generation, Marlon Brando und Montgomery Clift in Hollywood, in London Larry Olivier und John Gielgud. Hass aufs eigene Metier spricht aus vielen Seiten dieses Bandes, auf die Journalisten, die immer mit ihren Fragen auf seine Hingabe ans Schauspielern abzielen. „Was sie nicht verstehen und vollkommen fehlinterpretieren, ist die Einstellung, die wir zu unserem Beruf haben. Ich glaube, Mr. Thompson war zutiefst schockiert, als ich ihm erklärte, dass das Schauspielern auf der Bühne oder im Film bis auf ein oder zwei aufregende Momente die reinste Plage war . . . Er konnte wohl nicht nachvollziehen, wie demütigend und ermüdend es ist, die Schriften eines anderen auswendig lernen zu müssen, unter denen 9 von 10 nur durchschnittlich sind, wenn man 43 Jahre alt und ziemlich belesen ist . . .“ Die Angst vor der Zweitklassigkeit, auch vor dem Versagen der eigenen kreativen Potenz. „Ich werde das alles hassen“, schreibt er, als er zur Premiere von „Agenten sterben einsam“ geht, ein wilder Actionfilm mit Eastwood: „Reicht mir ein Muschelrund voll Ruhe.“ Das mag er, die eigene Situation und Stimmung konzentrieren in die Anspielung auf einen Vers von Sir Walter Raleigh, aus „Des leidvollen Mannes Pilgergang“, 1604.
Das Buch wird irgendwann zum Manifest des neuen Hedonismus, der den alten Professionalismus ablöst. Das Leben genießen, gut frühstücken, ausgiebig mittagessen – auch hier wird alles penibel aufgelistet, in aller Köstlichkeit, Elizabeths Steaks, Muscheln, Backhuhn nach Südstaatenart, sogar verpönte Fastfood –, Yahtzee spielen, in der Sonne liegen und sich bräunen lassen, pendeln zwischen den Häusern in Gstaad und Porto Vallarta, im Privatjet oder auf der eigenen Jacht. Und lesen natürlich, Proust und Baudelaire, endlich im Original, Spengler oder eine Trotzki-Biografie, oder ein, zwei Krimis am Tag.
Es ist eine gebrochene Existenz, die hier manifest wird, ein Mann, der viel erreicht hat, aber nicht weiß, ob es das ist, was er will, was ihm zusteht. Der epische Atem fehlt Burton, man spürt die Müdigkeit, die unentwegte Bemühtheit, nichts zu versäumen. Eine Zeitlang hat er offenbar einer mysteriösen Weissagung geglaubt, er würde mit 33 sterben. „Einen Film in Durango mit Burt Lancaster und Audrey Hepburn, unter der Regie von John Huston, lehnte ich ab, weil ich hätte fliegen müssen.“ Spannender als seine wirkliche mag seine Anti-Filmografie sein, die abgesagten, versäumten Filme. Der Jesus gehört dazu, den man ihm für Nick Rays „König der Könige“ angeboten hatte. Irgendwann bleibt ihm nur Kraftmeierei: „Der Tod ist ein Arschloch. Ein unberechenbarer, gedankenloser, dreckiger, liebloser Schweinehund . . ., er hat schon viel Unheil angerichtet. Eines Tages werden wir es ihm heimzahlen.“
Die Anziehungskraft der Burtons
ist ein Naturgesetz, so wie der
Mond die Gezeiten steuert
Den Jesus hatte man ihm
angeboten, in Nick Rays
„König der Könige“
Liebe und Desaster:
Richard Burton und Elizabeth Taylor
im Juni 1962, in einer Drehpause
von „Cleopatra“. FOTO: GRAZIANI/PEOPLE PICTURE
Richard Burton: Die Tagebücher. Hrsg. von Chris Williams. Aus dem Englischen von Steffen Jacobs, Anna-Christin Kramer, Anna-Nina Kroll, u. a. Verlag Haffmans & Tolkemitt, Berlin 2013. 684 Seiten, 34,99 Euro. E-Book 26,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Sieben Jahre lang führte der Schauspieler Richard Burton Tagebuch, von 1965 bis 1972, berichtet Susanne Mayer, in diese Zeit fallen die Dreharbeiten zu Filmen wie "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", zahllose Alkoholexzesse, die erste Scheidung von Liz Taylor. Der erste Eintrag ist bezeichnend, verrät die Rezensentin: 1. 1. 1965 - "Vom Kater erholt." Vielleicht schrieb Burton, weil er sich angesichts seines Alkoholismus und seiner aufwallenden Depressionen ein wenig Stabilität wünschte, vielleicht einfach, weil er Bücher liebte, leidenschaftlich las und seinen Kopf zum Bersten mit Sprache gefüllt war, die Rezensentin weiß es nicht, aber sie ist dankbar dafür, dass er es getan hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Des leidvollen
Mannes Pilgergang
Viele Jahre lang hat Richard Burton Tagebuch geführt, über Kollegen,
Politik, seinen Alkoholismus und seine Frau Elizabeth Taylor. Ein Stück
starke Literatur eines Mannes, der die Schauspielerei im Herzen hasste
VON FRITZ GÖTTLER
Der Mann ist absolut begeisterungsfähig, sein Enthusiasmus berührt zutiefst. Da kam ein Brief von Professor Francis Warner aus Oxford, im Oktober 1968, ob Richard Burton eine Vorlesung halten wolle in St. Peter’s. „Ich bin ganz aufgeregt und will ihm schreiben, und vorschlagen, dass ich im Sommer 1970 kommen werde. Er sagt, er wolle uns Zimmer dort geben, und ich werde ihm anbieten, dass er dafür unsere Yacht oder eines unserer Häuser haben kann. Er sagt, er braucht eine Auszeit . . . Ich habe ja immer schon Gelüste nach dem akademischen Leben gehabt wie eine Schwangere.“ Ein phantastischer Deal, tausche Glamour- gegen akademisches Leben, und vice versa.
Mit Arbeit an der Literatur ging Burton schon lange schwanger, auf nahezu jeder Seite seiner Tagebücher wird vermerkt, welche Bücher er sich besorgt hat, was er gerade liest, in der Sonne, in einem Café oder im Bett, ein Glas neben sich, bis tief in die Nacht hinein. Gern würde der Weltstar aus Wales in Oxford walisische oder irische Autoren behandeln, seine geliebten „Fantasticks“, Donne und Traherne, Henry Vaughan und George Herbert. „Dieser Herbert hatte Dinge zu bieten wie ein doppelt bestückter Pralinenkasten. Von der englischen Sprache geht für mich der gleiche Zauber aus wie von einer schönen Frau.“ Tagebücher sind gewöhnlich ein zwiespältiges Genre, aber die von Richard Burton sind ganz eindeutig. Hier ist nichts intimistisch oder verdruckst, keine Spur eines bedenklichen „Nicht für die Veröffentlichung bestimmt“. Sie gehen von Anfang an in die Offensive, geben sich aggressiv für Öffentlichkeit bestimmt. Die Nazi-Version von Tab Hunter nennt er Hardy Krüger, mit dem er nicht wirklich gut auskommt, beim Drehen. Der Kollege Rex Harrison trägt Mäntel, wie es nur ein Kleiderbügel kann, seine Frau Rachel malträtiert ihn und liegt, wenn sie mal wieder restlos besoffen ist, auf dem Boden der Bar und bellt wie ein Hund. Boshaft stellt Burton eines Abends den Kritiker Kenneth Tynan Humphrey Bogart vor – „Bogie, das ist ein gewisser Mr. Ken Tynan, der kürzlich im Evening Standard über dich schrieb und dein Gesicht als ,Triumph der plastischen Chirurgie‘ bezeichnete“ – und bringt den armen Mann damit völlig aus dem Tritt, „ein stammelnder, stotternder Totenschädel. Ken hat schon immer ausgesehen wie Belsen im Anzug. Dachau im Dress. Buchenwald in braunem Samt.“ Eine grausige Zärtlichkeit, aber auch ein literarischer Stilwille – und der Alkohol schärft noch mal seine walisische Härte.
Das Tagebuch eines Trunksüchtigen sagt er selber. Mit sarkastischer Penibilität listet er das tägliche Quantum auf, früh Bloody Marys, mittags ein, zwei Flaschen Wein, dazwischen Campari Wodka Soda. Seine Frau Elizabeth Taylor, die manchmal alkoholisch mit von der Partie ist, hat die Einträge regelmäßig gelesen und auch selbst ein paar Passagen beigesteuert. Glorious, Slowtake oder Fatty nennt er sie zärtlich poetisch.
Manchmal gibt es mehrwöchige oder -monatige Lücken im Ablauf, ansonsten ist eine strenge, egozentrische Schreibdisziplin zu spüren. Im Vergleich zur englischen fehlen in der deutschen Ausgabe einige Jahre, aus der Jugend, 1939/40, und dann 1960, auch in den Siebzigern hat Burton nur sehr sporadisch Tagebuch geführt. Die deutsche Ausgabe startet in der Post-Cleopatra-Zeit, sie geht vom Januar 1965 bis März 1972, das heißt sie präsentiert die Tagebücher wie einen literarischen Text, einen Lebensroman. (Mit Erstaunen liest man, dass Burton auch einige seiner Kollegen – Robert Mitchum, Marlon Brando, Montgomery Clift, vielleicht auch Peter O’Toole – für potenzielle Literaten hält.)
Der Band fängt ein wenig stolpernd und monoton an, dem Klatsch mehr zugeneigt als der persönlichen Reflexion, aber dann entwickelt er einen Drive, einen grandiosen Sog, der von dem Paar im Zentrum, der Glamour-Super-Kombination Taylor/Burton ausgeht, die für Jahre die Schlagzeilen bestimmen, eine relativ offene Hofhaltung haben und ein lebhaftes Familienleben mit Kindern aus diversen Ehen. „Ah, mein Freund“, wird der wunderbare Kollege Roscoe Lee Brown zitiert, „selbst die königliche Familie ist es gewohnt zu warten, wenn die Burtons da sind. Ihre Anziehungskraft ist ein Naturgesetz, so wie der Mond die Gezeiten steuert.“
Burton/Taylor waren ein paradigmatisches Star-Paar in einer Zeit, als das Starsystem schon heftig bröckelte – symptomatisch dafür der Film, der sie zusammenbrachte, „Cleopatra“, 1963, eine der großen Schlagzeilen-Lachnummern der Kinogeschichte. Geschaffen von einem, der ähnliche Probleme mit Hollywood hatte wie Burton, Joseph L. Mankiewicz, einer der überdrehten Intellektuellen, die es nach Hollywood verschlagen hatte. „Cleopatra“ war ein Produktionsdesaster in Millionenhöhe, der Hollywood-Shakespeareaner Mankiewicz musste den Film übernehmen, als noch gar kein fertiges Drehbuch da war, die Bauten wurden errichtet, bevor es die Szenen gab, die darin spielen sollten. Mankiewicz arbeitete bis zur Erschöpfung, nur die Schauspieler standen zu ihm. Burton, der Erfolg gehabt hatte am Broadway oder im Old Vic in London wie in Hollywood, als Hamlet wie als Alexander im Film von Robert Rossen, muss den Niedergang gespürt haben. Seine Filme mit Elizabeth waren zwar überaus erfolgreich, „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von Mike Nichols und „Der Widerspenstigen Zähmung“ von Franco Zeffirelli, aber dann spielt er plötzlich Tito und Blaubart oder, in seiner einzigen Ko-Regie, den Doktor Faustus. Dass er es allemal besser gekonnt hätte als die meisten seiner Regisseure, daran lässt er nie einen Zweifel. Er führt Schattengefechte gegen die immer stärker aufkommende Autorentheorie. Nein, erklärt er trotzig, die Leute gehen doch nicht für einen Film von Joseph Losey oder Nick Ray – die er beide mag und schätzt – ins Kino, sondern für die Stars.
Es ist ein Tempowechsel, in den Fünfzigern, den Burton, der Sohn eines Bergmanns, stärker spüren mag als die anderen angry young men seiner Generation, Marlon Brando und Montgomery Clift in Hollywood, in London Larry Olivier und John Gielgud. Hass aufs eigene Metier spricht aus vielen Seiten dieses Bandes, auf die Journalisten, die immer mit ihren Fragen auf seine Hingabe ans Schauspielern abzielen. „Was sie nicht verstehen und vollkommen fehlinterpretieren, ist die Einstellung, die wir zu unserem Beruf haben. Ich glaube, Mr. Thompson war zutiefst schockiert, als ich ihm erklärte, dass das Schauspielern auf der Bühne oder im Film bis auf ein oder zwei aufregende Momente die reinste Plage war . . . Er konnte wohl nicht nachvollziehen, wie demütigend und ermüdend es ist, die Schriften eines anderen auswendig lernen zu müssen, unter denen 9 von 10 nur durchschnittlich sind, wenn man 43 Jahre alt und ziemlich belesen ist . . .“ Die Angst vor der Zweitklassigkeit, auch vor dem Versagen der eigenen kreativen Potenz. „Ich werde das alles hassen“, schreibt er, als er zur Premiere von „Agenten sterben einsam“ geht, ein wilder Actionfilm mit Eastwood: „Reicht mir ein Muschelrund voll Ruhe.“ Das mag er, die eigene Situation und Stimmung konzentrieren in die Anspielung auf einen Vers von Sir Walter Raleigh, aus „Des leidvollen Mannes Pilgergang“, 1604.
Das Buch wird irgendwann zum Manifest des neuen Hedonismus, der den alten Professionalismus ablöst. Das Leben genießen, gut frühstücken, ausgiebig mittagessen – auch hier wird alles penibel aufgelistet, in aller Köstlichkeit, Elizabeths Steaks, Muscheln, Backhuhn nach Südstaatenart, sogar verpönte Fastfood –, Yahtzee spielen, in der Sonne liegen und sich bräunen lassen, pendeln zwischen den Häusern in Gstaad und Porto Vallarta, im Privatjet oder auf der eigenen Jacht. Und lesen natürlich, Proust und Baudelaire, endlich im Original, Spengler oder eine Trotzki-Biografie, oder ein, zwei Krimis am Tag.
Es ist eine gebrochene Existenz, die hier manifest wird, ein Mann, der viel erreicht hat, aber nicht weiß, ob es das ist, was er will, was ihm zusteht. Der epische Atem fehlt Burton, man spürt die Müdigkeit, die unentwegte Bemühtheit, nichts zu versäumen. Eine Zeitlang hat er offenbar einer mysteriösen Weissagung geglaubt, er würde mit 33 sterben. „Einen Film in Durango mit Burt Lancaster und Audrey Hepburn, unter der Regie von John Huston, lehnte ich ab, weil ich hätte fliegen müssen.“ Spannender als seine wirkliche mag seine Anti-Filmografie sein, die abgesagten, versäumten Filme. Der Jesus gehört dazu, den man ihm für Nick Rays „König der Könige“ angeboten hatte. Irgendwann bleibt ihm nur Kraftmeierei: „Der Tod ist ein Arschloch. Ein unberechenbarer, gedankenloser, dreckiger, liebloser Schweinehund . . ., er hat schon viel Unheil angerichtet. Eines Tages werden wir es ihm heimzahlen.“
Die Anziehungskraft der Burtons
ist ein Naturgesetz, so wie der
Mond die Gezeiten steuert
Den Jesus hatte man ihm
angeboten, in Nick Rays
„König der Könige“
Liebe und Desaster:
Richard Burton und Elizabeth Taylor
im Juni 1962, in einer Drehpause
von „Cleopatra“. FOTO: GRAZIANI/PEOPLE PICTURE
Richard Burton: Die Tagebücher. Hrsg. von Chris Williams. Aus dem Englischen von Steffen Jacobs, Anna-Christin Kramer, Anna-Nina Kroll, u. a. Verlag Haffmans & Tolkemitt, Berlin 2013. 684 Seiten, 34,99 Euro. E-Book 26,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Mannes Pilgergang
Viele Jahre lang hat Richard Burton Tagebuch geführt, über Kollegen,
Politik, seinen Alkoholismus und seine Frau Elizabeth Taylor. Ein Stück
starke Literatur eines Mannes, der die Schauspielerei im Herzen hasste
VON FRITZ GÖTTLER
Der Mann ist absolut begeisterungsfähig, sein Enthusiasmus berührt zutiefst. Da kam ein Brief von Professor Francis Warner aus Oxford, im Oktober 1968, ob Richard Burton eine Vorlesung halten wolle in St. Peter’s. „Ich bin ganz aufgeregt und will ihm schreiben, und vorschlagen, dass ich im Sommer 1970 kommen werde. Er sagt, er wolle uns Zimmer dort geben, und ich werde ihm anbieten, dass er dafür unsere Yacht oder eines unserer Häuser haben kann. Er sagt, er braucht eine Auszeit . . . Ich habe ja immer schon Gelüste nach dem akademischen Leben gehabt wie eine Schwangere.“ Ein phantastischer Deal, tausche Glamour- gegen akademisches Leben, und vice versa.
Mit Arbeit an der Literatur ging Burton schon lange schwanger, auf nahezu jeder Seite seiner Tagebücher wird vermerkt, welche Bücher er sich besorgt hat, was er gerade liest, in der Sonne, in einem Café oder im Bett, ein Glas neben sich, bis tief in die Nacht hinein. Gern würde der Weltstar aus Wales in Oxford walisische oder irische Autoren behandeln, seine geliebten „Fantasticks“, Donne und Traherne, Henry Vaughan und George Herbert. „Dieser Herbert hatte Dinge zu bieten wie ein doppelt bestückter Pralinenkasten. Von der englischen Sprache geht für mich der gleiche Zauber aus wie von einer schönen Frau.“ Tagebücher sind gewöhnlich ein zwiespältiges Genre, aber die von Richard Burton sind ganz eindeutig. Hier ist nichts intimistisch oder verdruckst, keine Spur eines bedenklichen „Nicht für die Veröffentlichung bestimmt“. Sie gehen von Anfang an in die Offensive, geben sich aggressiv für Öffentlichkeit bestimmt. Die Nazi-Version von Tab Hunter nennt er Hardy Krüger, mit dem er nicht wirklich gut auskommt, beim Drehen. Der Kollege Rex Harrison trägt Mäntel, wie es nur ein Kleiderbügel kann, seine Frau Rachel malträtiert ihn und liegt, wenn sie mal wieder restlos besoffen ist, auf dem Boden der Bar und bellt wie ein Hund. Boshaft stellt Burton eines Abends den Kritiker Kenneth Tynan Humphrey Bogart vor – „Bogie, das ist ein gewisser Mr. Ken Tynan, der kürzlich im Evening Standard über dich schrieb und dein Gesicht als ,Triumph der plastischen Chirurgie‘ bezeichnete“ – und bringt den armen Mann damit völlig aus dem Tritt, „ein stammelnder, stotternder Totenschädel. Ken hat schon immer ausgesehen wie Belsen im Anzug. Dachau im Dress. Buchenwald in braunem Samt.“ Eine grausige Zärtlichkeit, aber auch ein literarischer Stilwille – und der Alkohol schärft noch mal seine walisische Härte.
Das Tagebuch eines Trunksüchtigen sagt er selber. Mit sarkastischer Penibilität listet er das tägliche Quantum auf, früh Bloody Marys, mittags ein, zwei Flaschen Wein, dazwischen Campari Wodka Soda. Seine Frau Elizabeth Taylor, die manchmal alkoholisch mit von der Partie ist, hat die Einträge regelmäßig gelesen und auch selbst ein paar Passagen beigesteuert. Glorious, Slowtake oder Fatty nennt er sie zärtlich poetisch.
Manchmal gibt es mehrwöchige oder -monatige Lücken im Ablauf, ansonsten ist eine strenge, egozentrische Schreibdisziplin zu spüren. Im Vergleich zur englischen fehlen in der deutschen Ausgabe einige Jahre, aus der Jugend, 1939/40, und dann 1960, auch in den Siebzigern hat Burton nur sehr sporadisch Tagebuch geführt. Die deutsche Ausgabe startet in der Post-Cleopatra-Zeit, sie geht vom Januar 1965 bis März 1972, das heißt sie präsentiert die Tagebücher wie einen literarischen Text, einen Lebensroman. (Mit Erstaunen liest man, dass Burton auch einige seiner Kollegen – Robert Mitchum, Marlon Brando, Montgomery Clift, vielleicht auch Peter O’Toole – für potenzielle Literaten hält.)
Der Band fängt ein wenig stolpernd und monoton an, dem Klatsch mehr zugeneigt als der persönlichen Reflexion, aber dann entwickelt er einen Drive, einen grandiosen Sog, der von dem Paar im Zentrum, der Glamour-Super-Kombination Taylor/Burton ausgeht, die für Jahre die Schlagzeilen bestimmen, eine relativ offene Hofhaltung haben und ein lebhaftes Familienleben mit Kindern aus diversen Ehen. „Ah, mein Freund“, wird der wunderbare Kollege Roscoe Lee Brown zitiert, „selbst die königliche Familie ist es gewohnt zu warten, wenn die Burtons da sind. Ihre Anziehungskraft ist ein Naturgesetz, so wie der Mond die Gezeiten steuert.“
Burton/Taylor waren ein paradigmatisches Star-Paar in einer Zeit, als das Starsystem schon heftig bröckelte – symptomatisch dafür der Film, der sie zusammenbrachte, „Cleopatra“, 1963, eine der großen Schlagzeilen-Lachnummern der Kinogeschichte. Geschaffen von einem, der ähnliche Probleme mit Hollywood hatte wie Burton, Joseph L. Mankiewicz, einer der überdrehten Intellektuellen, die es nach Hollywood verschlagen hatte. „Cleopatra“ war ein Produktionsdesaster in Millionenhöhe, der Hollywood-Shakespeareaner Mankiewicz musste den Film übernehmen, als noch gar kein fertiges Drehbuch da war, die Bauten wurden errichtet, bevor es die Szenen gab, die darin spielen sollten. Mankiewicz arbeitete bis zur Erschöpfung, nur die Schauspieler standen zu ihm. Burton, der Erfolg gehabt hatte am Broadway oder im Old Vic in London wie in Hollywood, als Hamlet wie als Alexander im Film von Robert Rossen, muss den Niedergang gespürt haben. Seine Filme mit Elizabeth waren zwar überaus erfolgreich, „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von Mike Nichols und „Der Widerspenstigen Zähmung“ von Franco Zeffirelli, aber dann spielt er plötzlich Tito und Blaubart oder, in seiner einzigen Ko-Regie, den Doktor Faustus. Dass er es allemal besser gekonnt hätte als die meisten seiner Regisseure, daran lässt er nie einen Zweifel. Er führt Schattengefechte gegen die immer stärker aufkommende Autorentheorie. Nein, erklärt er trotzig, die Leute gehen doch nicht für einen Film von Joseph Losey oder Nick Ray – die er beide mag und schätzt – ins Kino, sondern für die Stars.
Es ist ein Tempowechsel, in den Fünfzigern, den Burton, der Sohn eines Bergmanns, stärker spüren mag als die anderen angry young men seiner Generation, Marlon Brando und Montgomery Clift in Hollywood, in London Larry Olivier und John Gielgud. Hass aufs eigene Metier spricht aus vielen Seiten dieses Bandes, auf die Journalisten, die immer mit ihren Fragen auf seine Hingabe ans Schauspielern abzielen. „Was sie nicht verstehen und vollkommen fehlinterpretieren, ist die Einstellung, die wir zu unserem Beruf haben. Ich glaube, Mr. Thompson war zutiefst schockiert, als ich ihm erklärte, dass das Schauspielern auf der Bühne oder im Film bis auf ein oder zwei aufregende Momente die reinste Plage war . . . Er konnte wohl nicht nachvollziehen, wie demütigend und ermüdend es ist, die Schriften eines anderen auswendig lernen zu müssen, unter denen 9 von 10 nur durchschnittlich sind, wenn man 43 Jahre alt und ziemlich belesen ist . . .“ Die Angst vor der Zweitklassigkeit, auch vor dem Versagen der eigenen kreativen Potenz. „Ich werde das alles hassen“, schreibt er, als er zur Premiere von „Agenten sterben einsam“ geht, ein wilder Actionfilm mit Eastwood: „Reicht mir ein Muschelrund voll Ruhe.“ Das mag er, die eigene Situation und Stimmung konzentrieren in die Anspielung auf einen Vers von Sir Walter Raleigh, aus „Des leidvollen Mannes Pilgergang“, 1604.
Das Buch wird irgendwann zum Manifest des neuen Hedonismus, der den alten Professionalismus ablöst. Das Leben genießen, gut frühstücken, ausgiebig mittagessen – auch hier wird alles penibel aufgelistet, in aller Köstlichkeit, Elizabeths Steaks, Muscheln, Backhuhn nach Südstaatenart, sogar verpönte Fastfood –, Yahtzee spielen, in der Sonne liegen und sich bräunen lassen, pendeln zwischen den Häusern in Gstaad und Porto Vallarta, im Privatjet oder auf der eigenen Jacht. Und lesen natürlich, Proust und Baudelaire, endlich im Original, Spengler oder eine Trotzki-Biografie, oder ein, zwei Krimis am Tag.
Es ist eine gebrochene Existenz, die hier manifest wird, ein Mann, der viel erreicht hat, aber nicht weiß, ob es das ist, was er will, was ihm zusteht. Der epische Atem fehlt Burton, man spürt die Müdigkeit, die unentwegte Bemühtheit, nichts zu versäumen. Eine Zeitlang hat er offenbar einer mysteriösen Weissagung geglaubt, er würde mit 33 sterben. „Einen Film in Durango mit Burt Lancaster und Audrey Hepburn, unter der Regie von John Huston, lehnte ich ab, weil ich hätte fliegen müssen.“ Spannender als seine wirkliche mag seine Anti-Filmografie sein, die abgesagten, versäumten Filme. Der Jesus gehört dazu, den man ihm für Nick Rays „König der Könige“ angeboten hatte. Irgendwann bleibt ihm nur Kraftmeierei: „Der Tod ist ein Arschloch. Ein unberechenbarer, gedankenloser, dreckiger, liebloser Schweinehund . . ., er hat schon viel Unheil angerichtet. Eines Tages werden wir es ihm heimzahlen.“
Die Anziehungskraft der Burtons
ist ein Naturgesetz, so wie der
Mond die Gezeiten steuert
Den Jesus hatte man ihm
angeboten, in Nick Rays
„König der Könige“
Liebe und Desaster:
Richard Burton und Elizabeth Taylor
im Juni 1962, in einer Drehpause
von „Cleopatra“. FOTO: GRAZIANI/PEOPLE PICTURE
Richard Burton: Die Tagebücher. Hrsg. von Chris Williams. Aus dem Englischen von Steffen Jacobs, Anna-Christin Kramer, Anna-Nina Kroll, u. a. Verlag Haffmans & Tolkemitt, Berlin 2013. 684 Seiten, 34,99 Euro. E-Book 26,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de