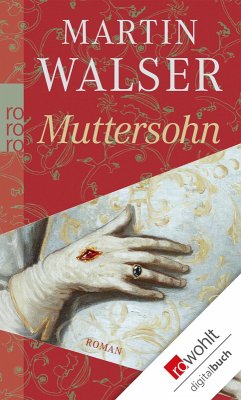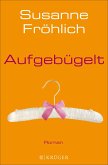Wovon handelt dieser Roman? Es ist leichter zu sagen, wovon er nicht handelt. Er handelt von 1937 bis 2008, kommt nicht aus ohne Augustin, Seuse, Jakob Böhme und Swedenborg, handelt aber vor allem von Anton Percy Schlugen. Seine Mutter Josefine, Fini genannt, ist Schneiderin; sie lebt, auch als sie mit einem Mann zusammenlebt, allein. Jahrelang schreibt sie Briefe an Ewald Kainz, der auf den Stufen des Neuen Schlosses in Stuttgart eine politische Rede hielt. Die Briefe schickt sie nicht ab; sie liest sie ihrem Sohn vor und vermittelt ihm so, dass zu seiner Zeugung kein Mann nötig gewesen sei. Mit diesem Glauben lebt Percy. Er wird Krankenpfleger im psychiatrischen Landeskrankenhaus Scherblingen, wird gefördert von Professor Augustin Feinlein und eines Tages mit einem Fall betraut, an dem die Ärzteschaft fast verzweifelt. Es geht um einen Suizidpatienten, einen Motorradlehrer, der sich allen Therapieversuchen stumm widersetzt. Dieser Patient heißt: Ewald Kainz. Percy ist inzwischen berühmt, weil er keiner Weltvernunft zuliebe verzichtet auf die von der Mutter in ihn eingegangene Botschaft vom Kind ohne leiblichen Vater. Berühmt auch durch seine prinzipiell unvorbereiteten Reden. Das ist sein Thema: Ich sage nicht, was ich weiß. Ich sage, was ich bin. In «Muttersohn» fügen sich Bekenntnisse und Handlungen zu einem Roman des Lebens: empfindungsreich, ironisch und schwerelos zugleich.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Bei bester Laune hat Rezensent Adam Soboczynski Martin Walser in diesem Roman erlebt, denn wenn auch andere Autoren im Alter zu formaler Strenge neigen, pflege Walser eher die menschenfreundliche Heiterkeit. Sehr verspielt geht es also bei "Mutttersohn" zu, biografisch und sehr anspielungsreich. Der Roman erzählt vom "anmutigen und würdevollen" Percy Anton, der angeblich ohne Vater gezeugt wurde und in seiner edlen Einfalt sowohl einem Talkshow-Publikum wie auch den Patienten in der Nervenklinik, in der er als Pfleger arbeitet, Trost und Glauben spendet. Um diesen Percy Anton herum baut Walser etliche Ärzte und Patienten, deren psychische Probleme Walser freudig entfaltet, wie sich Rezensent Soboczynski freut, denen er aber auch das "Glück gnädiger Vernebelung" zuteil werden lässt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Jesus am Bodensee: Martin Walsers neuer Roman erzählt von einem heiligen Muttersohn
"Es ist", sagt Walser, "die Glaubensfrage am schärfsten Beispiel. Wenn man das glaubt, kann man alles glauben. Da bleibt nur noch die Auferstehung."
Er heißt Percy, ist Pfleger in einer psychiatrischen Landesklinik in Süddeutschland, kam 1977 auf die Welt, und zu seiner Zeugung, so hat es ihm seine Mutter versichert, war kein Vater nötig. Der Roman, den Martin Walser über diesen Percy geschrieben hat, heißt "Muttersohn", und er selbst sagt, es sei sein bislang hellstes Buch geworden. Noch vor fünf Jahren wäre es ihm nicht möglich gewesen, ein solches Buch zu schreiben.
Martin Walser ist 84 Jahre alt, er hat in seinem Leben ungefähr so viele Bücher geschrieben, wie er Jahre zählt, und er ist der deutsche Schriftsteller schlechthin. Unter den Autoren seiner Generation, die das geistige Leben dieses Landes seit mehr als fünfzig Jahren prägen, ist er der mit Abstand produktivste. Einer, der das Leben schreibend erlebt, schreibend erfasst. Seine Romanwelt ist die des deutschen Mittelmannes, des deutschen Bürgers mit all seinen Lebensunterdrückungen, Sehnsüchten, seinen Ängsten vor allem. Seiner Angst. Es kann übrigens natürlich sein, dass das am Anfang gar nicht so war, dass es am Anfang von Martin Walsers Schreiben tatsächlich nur um selbst erlebte oder selbst erdachte Durchschnittslebenswiderstände ging, aber irgendwann war die Walser-Romanwelt so stark und seine Bücher so erfolgreich, dass der deutsche Mittelmann gar nicht mehr umhinkonnte, seine Unterdrückungen nach der Walser-Welt auszurichten. Walser ist ein großes Wir. So unangenehm einem das auch manchmal ist. In "Muttersohn" sagt ein suizidgefährdeter Motorradlehrer und Insasse der Psychiatrie: "Ich bin natürlich wie alle."
Sie sind keinen sehr weiten Weg gegangen, die Helden seiner Romane in den letzten fünfzig Jahren. Die Lebenskonventionen sind ähnlich geblieben, die hoffnungslosen Ausbruchsversuche auch. Im hohen Alter wirken ihre Kämpfe mitunter etwas lächerlicher, aussichtsloser, dadurch aber oft auch: heroischer. Der Autor selbst ist in diesen Jahren dafür einen umso weiteren Weg gegangen. So heißt es normalerweise: vom Kommunisten zum nationalbewussten Redner am rechten Rand. Walser selber sagt immer, er habe sich eigentlich gar nicht bewegt. Gegen den Vietnamkrieg, für die Wiedervereinigung, gegen die "Monumentalisierung unserer Schande", das Holocaust-Mahnmal in der Mitte Berlins, jetzt für Winfried Kretschmann und seine Grünen, für Angela Merkel, aber gegen ihre Außenpolitik und den Krieg in Afghanistan. Schlingerpfade einer deutschen Mitte. Oder auch: irgendwie geradeaus.
Und jetzt also: die Helligkeit. Jetzt also: Percy. Jetzt also: die letzte Wende. Viele Vorbilder gibt es ja nicht für einen vaterlos gezeugten jungen Mann, und als dieser Percy in der Mitte des Romans - sein Ruhm ist schon gewaltig - in einer Talkshow erstmals gefragt wird: "Dass Sie mit Nazareth konkurrieren ist Ihnen bewusst?", antwortet er zwar ausweichend: "Ich weiß nicht, was das ist: konkurrieren." Aber da ist es raus: Ja, Percy ist eine Jesus-Figur unserer Zeit. Ein Mann mit unglaublicher Herkunftsgeschichte. Walser selbst hat in einem Interview dazu gesagt: "Es ist die Glaubensfrage am schärfsten Beispiel. Wenn man das glaubt, kann man alles glauben. Da bleibt nur noch die Auferstehung."
Martin Walser hat einen Glaubensroman geschrieben, einen Roman gegen die Vernunft, über die Möglichkeit eines Percy in unserer Welt. Percy selbst macht gar nicht so eine große Sache daraus, aus der Vaterlosigkeit, der Wundererzählung seiner Mutter Fini. Doch der Mangel treibt ihn an, die Lücke in seinem Leben. Er sucht nach einem Vater. Nicht nach dem echten, das glaubt er schon, dass es den nicht gibt, aber nach einem anderen Vater, einem hier von dieser Welt. Diese Suche treibt ihn, treibt den Roman voran. Am Anfang steht Ewald Kainz, der Motorradlehrer, der sagt, dass er wie alle ist.
Er liegt in der Psychiatrie in Scherblingen, wo Percy Pfleger ist, im Bett und schweigt. Percy schweigt mit ihm, nur wenige können so gut und innig schweigen wie er, doch schließlich erzählt er ihm seine Geschichte: Percys Mutter hat Kainz geliebt, seit sie ihm bei einer Rede auf einer Demonstration in Stuttgart 1973 gegen Radikalenerlass und Vietnamkrieg einmal für wenige Minuten das Mikrofon halten durfte. Seit diesem Moment schrieb sie ihm Briefe, unendlich viele Briefe, Liebesbriefe, die sie nie abschickte. Ihrem Sohn Percy las sie die Briefe später vor, immer wieder. Er hat mit diesen Briefen Lesen gelernt. Er kann sie auswendig, bis heute. Jetzt trägt er Ewald Kainz, dem Selbstmordgefährdeten, der sich in der Praxis einer von ihm hoffnungslos Geliebten mit Kognak übergossen und angezündet hat, die Briefe vor. Die Wirkung auf den Patienten wird nicht die gewünschte sein.
Percys Mutter lebte damals, als sie diesen Kainz aussichtslos liebte und ihm diese Briefe schrieb, mit einem Mann zusammen, der sich Arno Schmidt nannte: ein schwuler, gewalttätiger Alkoholiker, der eigentlich Hugo Schwillk hieß, aber die Werke Arno Schmidts bis zur völligen Anverwandlung bewunderte, auswendig zitierte, sein Leben danach ausrichtete. Auch diesen Mann hatte Fini in Briefen lieben gelernt. Die schickte sie damals aber noch ab und empfing seine dafür. Die Wirkung seiner Worte war ungeheuerlich: "Sie ist, wenn sie wieder einen Brief von ihm gelesen hat, richtig zerzaust. An Leib und Seele. Seit sie seine Briefe liest, begreift sie die ganze Welt." Leider lernten sie sich kennen, in der Wirklichkeit: "Unsere Briefe haben sich ineinander verliebt. Als wir dann einander sahen, war es aus." Es folgte eine Ehe des Schreckens.
Dieser Arno Schmidt jedenfalls ist Percys Vater nicht. Wenn überhaupt sind seine Briefe eine Art Vaterschaft, die Vorstellung nur kann diesen Percy geschaffen haben.
Sein Ruhm wächst langsam. Zunächst ist es nur der Leiter des psychiatrischen Krankenhauses, Augustin Feinlein, Nachfahr eines Abtes, der ihn verehrt. Der gerne mit ihm schweigt, sich von ihm belehren lässt und selber lehrt. Latein bringt er ihm bei, die christliche Liturgie, Kirchengeschichte, die Lehren der Mystiker Jakob Böhme, Emanuel Swedenborg und Heinrich Seuse. Es geht um Einheit mit der Natur, Vertrauen, die Verschönerung der Welt mittels des Glaubens. Percy ist ein Sonnenmensch. Er hat unendliches Vertrauen in sich und in die Menschen, geht auf einem Lichtstrahl durchs Leben.
Seine Mutter, die in Briefen lebte und in Vorstellungen, hat es ihm mitgegeben. "Du bist geleitet", hat sie ihm gesagt und "Du bist ein Engel ohne Flügel". Irgendwann hat er seine Gabe zur öffentlichen Rede entdeckt. Percy redet einfach, Manuskripte kennt er nicht. Das Leben hat ihn genug gelehrt; er redet immer direkt. Sein einziges Bedürfnis sei es, "das Unwillkürliche zur Geltung zu bringen", sagt er. Reden gegen Redeschranken, gegen Unmöglichkeiten, gegen die sogenannte Vernunft, gegen die Verneiner. Percy ist der Jasager zum Leben und zur Unmittelbarkeit. Seine Wirkungen sind beeindruckend, aber nicht immer von langer Dauer.
Sein Lehrer und Schweigepartner Augustin Feinlein, den er sich zum Vater wählen wollte, wird ein jähes Ende nehmen. Feinleins Geschichte kennen Walser-Leser schon. Er hat das Feinlein-Kapitel des Romans letztes Jahr schon unter dem Titel "Mein Jenseits" vorveröffentlicht. Ein etwas ungewöhnliches Verfahren. Fast wirkte es so, als könne der stolze Autor keine Sekunde mehr damit warten, der Welt wenigstens schon einen Teil seines kommenden Erleuchtungsbuches zu präsentieren.
Jetzt fügt sich die Novelle bruchlos in den Roman ein. Feinlein wird schließlich zum Patienten in jenem Landeskrankenhaus, das er jahrzehntelang geleitet hatte. Er hatte dreißig Jahre einen falschen Glauben geglaubt, hatte an das Liebesversprechen einer Frau geglaubt, das eine Lüge war. Das wirft ihn aus der Lebensbahn. Doch war der Glaube falsch? Gibt es das, den falschen Glauben? "Glauben heißt, die Welt so schön machen, wie sie nicht ist", heißt es an einer Stelle des Buches. Früher hatte Walser immer dasselbe über das Schreiben gesagt, dass das Schreiben die Welt verschönere, dafür sei es da.
Die Welt, die Walser hier, in seinem neuen Roman, beschreibt, ist die Walser-Welt zwischen Donau und Bodensee, wie sie immer ist. Diesmal ist es eben eine Psychiatrie, am Ende eine neugegründete sogenannte Akademie für Unvollendete, eine Akademie für Musiker, die etwas klingen lassen wollen, ohne perfekt zu sein. Im Grunde eine Außenstelle der alten Psychiatrie. Die Unzulänglichkeiten, die Verzweiflungen der Walser-Helden sind die gleichen wie eh und je. Sie schlagen sich nur nicht mehr die Nasen blutig an den Wänden der Literatur, die sie umgibt. Es ist, als habe jemand eine Tür aufgestoßen und lasse Licht und Luft hinein in diese oftmals dunkle, schwere Walser-Welt.
Es ist, als habe er sich freigeschrieben von vielen bösen Geistern. "Wie im Rausch" habe er Teile des Buches verfasst, hatte er gesagt. Das musste jetzt für die Leser nicht unbedingt eine gute Nachricht sein. Doch Walsers Jesus-Rausch bringt in diesen 500-Seiten-Roman Tempo, Farbigkeit und Licht. Und am (natürlich dramatischen, wenn auch historisch irgendwie bekannten) Ende einen gelösten Abschiedston von einem Autor, der aber mit Sicherheit noch sechs, sieben Romane schreiben wird.
Über das Alter hat Walser gesagt, "dass es sehr anregend sein kann, wenn man spürt, es wird eng". Anregend für ihn und seine Leser. Mit seinem Percy winkt er zum vorläufigen Abschied so: "Ich verjuble alle Jahre, alle Zeit / Ich baue Leichtigkeit an wie andere Mais / und dünge sie mit Himmelslicht. / Ich hebe ab, um abzustürzen, / irre aufwärts in die Welt, zugeklebt / die Augen mit Schmetterlingsflügeln. / Ich bin eine prima Konstruktion. / Produziert ihr Kälte. / Ich produzier' Wärme."
VOLKER WEIDERMANN
Martin Walser: "Muttersohn". Rowohlt-Verlag, 500 Seiten, 24,95 Euro. Das Buch erscheint am 12. Juli.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ein Buch wie eine Monstranz: In seinem neuen Roman „Muttersohn“ erzählt Martin Walser vom Leben Jesu als Krankenpfleger in Oberschwaben
In der Jugend, sagt ein persisches Sprichwort, gleiche der Mensch seiner Zeit; im Alter seinen Vorfahren. Wenn das auf irgendeinen Schriftsteller zutrifft, dann bestimmt auf Martin Walser. Als er, kaum dreißigjährig, in den Fünfzigern auftrat, da bescherte er der noch jungen Bundesrepublik ihren exemplarischen Gesellschaftsroman, erst die „Ehen in Philippsburg“ und dann die Anselm-Kristlein-Trilogie, mit dem Auftakt „Halbzeit“ von 1960.
Der scharfe Blick des Autors kam vom zornigen linken Flügel (lange stand Walser den deutschen Kommunisten nahe); aber der Protagonist selber erlebte das alles von innen heraus, als den Zwang, sich bei Strafe des Untergangs jeder der rasch wechselnden Lagen anzupassen wie ein Chamäleon. „Mimikry“ hieß ein Großkapitel; und die Figur des Anselm Kristlein entfaltete ihre peinigende Brillanz in der permanenten Selbstverleugnung des ökonomischen Subjekts. Sah man genau hin, erkannte man jedoch, wonach es sich stattdessen sehnte: Weg aus Stuttgart und München wollte es, zurück in ein Land und eine Zeit, die es schon damals nicht mehr gab, ins alte katholische Oberschwaben zwischen Donau und Bodensee, wo seine und des Autors Familie herstammten.
Jetzt, ein rundes halbes Jahrhundert später, gibt es sie wieder. Walser hat es so beschlossen. Sein Schreiben hat den Zorn wie den Zwang abgestreift, um sich seine Welt so zu bauen, wie er sie haben will. Dass die Realität des Jahres 2011 ihm dabei gewisse Hindernisse in den Weg stellt, erkennt er nur insofern an, als er das Zentrum des Geschehens in ein Psychiatrisches Landeskrankenhaus verlegt.
Aber bei diesem handelt es sich um ein altes Prämonstratenserkloster, das dessen Leiter, Prof. Dr. Augustin Feinlein, in der Art eines milden Prälaten zu leiten bemüht ist, war doch ein Vorfahr von ihm der letzte Abt gewesen, bevor das Kloster im Jahr 1803 säkularisiert, die Klosterbibliothek auf Ochsenkarren weggeführt und vernichtet wurde. Augustin Feinlein: Schon der Name verkündet, dass hier ein geträumtes Altersbild des nur unter Druck so wendig gewordenen Handlungsreisenden Anselm Kristlein vorliegt; nun ist der Druck (nicht ganz, sonst käme ja kein Roman zustande, aber doch weitgehend) von ihm gewichen, und er kann führen, was er immer wollte, die vita contemplativa eines Mönchs, ein Leben in der Beschaulichkeit.
Der eigentliche Held des Buchs aber ist Anton Percy Schlugen, oder, um die aussagekräftigere volle Form zu verwenden, Anton Parcival von Schlugen. Er ist der titelgebende „Muttersohn“, ohne die verächtliche Verkleinerungssilbe, dem bestimmt ist, auf Erden jenes Einmalige zu verrichten, das dem in einer Komplettfamilie herangewachsenen Normalmenschen versagt bliebe.
Dieser Muttersohn zeichnet sich dadurch aus, dass zu seiner Erzeugung ein Vater überhaupt nicht erforderlich war, bzw. dass es seiner Mutter Josefine gelang, seine Empfängnis allein durch Briefe zu bewerkstelligen, die sie an den von ihr angebeteten Ewald Kainz schrieb, aber nie abschickte. Percy heilt Kranke, die alle anderen aufgegeben haben; Percy, rhetorisch völlig ungeschult, hält spontane Ansprachen, die die Hörer im Herzen erschüttern; Percy sammelt (obschon erst spät im Buch) ein rundes Dutzend Jünger um sich, die sich als Motorradgang verkleiden, und einer von ihnen (der, der ihn am meisten liebt) verrät und tötet ihn: Percy, mit einem Wort, ist Jesus. Davor ist Walser nicht zurückgeschreckt, und dafür muss er den Preis entrichten, den alle Schriftsteller zu zahlen haben, die für den Sohn Gottes einen neuen Sitz im Leben suchen: Das göttliche Charisma verfliegt, und der neuzeitliche Roman gelangt sozusagen von Amts wegen nicht über einen ziemlich banalen Menschenkitsch hinaus.
Genau einmal durfte Percys Mutter für Ewald Kainz, als er bei einer Demonstration in den Siebzigern gegen die Berufsverbote sprach, das Mikrofon halten; das hat als Inspiration für ein ganzes Leben zu genügen. Doch erscheint Ewalds Engagement für die linke Sache vor allem als Ausgeburt einer höchstpersönlichen Not: Denn er hat mit seinem Stottern zu ringen. Nun ist er im Landeskrankenhaus gelandet, ganz verstummt, wo Percy, Krankenpfleger und sein Sohn in einem höheren Sinn, sich ihm mit seiner „Schlafsacktherapie“ naht, welche ganz auf Güte und Schweigen setzt. Man begeht wohl keine biografistische Indiskretion, wenn man vermutet, Walser, der seinen Vater früh verlor und eine besonders enge Beziehung zu seiner Mutter unterhielt, habe hier Aspekte seiner eigenen Existenz auf zwei Rollen verteilt, den politisch umgetriebenen jungen Walser als den Alten besetzt und den alten, der seinen Frieden mit der Welt gemacht hat, als den jungen Erlöser.
Muss Ewald als Percys geistiger Vater gelten, so Augustin Feinlein als sein geistlicher; von ihm lernt er die beiden wichtigsten Fertigkeiten, die das Band mit dem Himmel knüpfen, Orgelspielen und Latein. Wenn die Figuren einander über Seiten hinweg Jakob Böhme und Swedenborg, Heinrich Seuse und Augustinus, aber auch Goethes Iphigenie, Arno Schmidt und Rilke vorlesen oder noch lieber auswendig rezitieren, trägt das zum Fortgang des Romans so gut wie nichts bei; offenbar erweist hier der Autor Walser den anderen Autoren die Reverenz, wie wenn er Büsten von ihnen in seinem Arbeitszimmer aufstellen würde. Es macht deutlich, dass Walser sein neues Buch höchstens noch zur Hälfte als eine öffentliche und literarische Angelegenheit betrachtet, vorwiegend jedoch als eine Privatsache, in die er die Leserschaft nur wie durch eine angelehnte Tür blicken lässt. (Sogar Lyrik teilt Walser auf diesem Weg mit; sie klingt, als ob einer, der sich allein glaubt, stillvergnügt vor sich hin summt.)
Darum nehmen die Mystiker unter seinen Gewährsleuten eine so herausgehobene Stellung ein. Nicht, als ob Walser selbst ein solcher wäre. Aber das mystische Erlebnis liegt doch insoweit auf seiner Linie, als es sich Anderen schlechterdings nicht mitteilen lässt und von ihm nur der Abglanz des indirekten Ausdrucks nach außen dringt. Bei Walser kommt eine trotzige Note hinzu. Als Motto des dritten Teils, „Mein Jenseits“ (der bereits letztes Jahr als selbständiges Buch herauskam), setzt er ein Zitat von Jakob Böhme: „Wer es verstehen kann, der verstehe es. Wer aber nicht, der lasse es ungelästert und ungetadelt. Dem habe ich nichts geschrieben. Ich habe für mich geschrieben.“
Das ist mehr, als ein bei Rowohlt publizierender Autor in Anspruch nehmen sollte. Es heißt die Freiheit des hohen Alters dann doch übertreiben und sich der Unbelangbarkeits-Erschleichung schuldig zu machen. In dieser Verquickung des öffentlichen Raums mit dem Bloß-Persönlichen gleicht Walser seinem Augustin Feinlein, der die Monstranz mit der Heilig-Blut-Reliquie aus der Stiftskirche stiehlt, um sie vor dem Unverständnis der Gegenwart in Sicherheit zu bringen. „Die herablassende Duldung, mit der die Gebildeten, egal ob kirchlich oder weltlich, die Reliquie als ein Relikt behandeln, das nur noch Peinlichkeiten bereitet, wann immer es irgendwo genannt werden muss. Für Theologen eine Torheit, für aufgeklärte Zeitgenossen ein Ärgernis.“
Der Apostel Paulus, von dem Walser den letzten Satz in leichter Abwandlung entlehnt hat, fährt fort: Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten. Walser und sein Feinlein hingegen haben dem Ärgernis und der Torheit nur ihr hochfahrendes Ich entgegenzusetzen. Glaubenkönnen, sagt Feinlein, das sei so etwas wie Musikalität: Der eine hat sie, der andere nicht, und wer nicht, dem fehlt was, ohne dass er es wüsste. So würde ein wahrer Gläubiger nicht sprechen, der seinen Glauben als widerfahrende Gnade statt als ihm gehöriges Talent begriffe. Dass Feinlein erwischt und daraufhin vom Klinikleiter zum Fall degradiert wird, betrachtet er als einen so unabwendbaren wie gleichgültigen Vorgang. Aber was es mit derartiger Weltabkehr bei Walser wirklich auf sich hat, zeigt sich, als Percy-Jesus mit seiner innigen Botschaft in einer Talkshow auftritt. „Percy: (...) Ein Mensch ist in jedem Augenblick alles, was er sein kann. Wenn man ihn reduziert auf das, was man über ihn wissen kann, ist es möglich, dass auch er sich selber nachher produziert als die Datei, die ihr aus ihm gemacht habt. (Vereinzelt Beifall aus dem Publikum.)“
Der Beifall bleibt dann keineswegs vereinzelt, das Publikum kommt in Schwung, lacht und klatscht und „(stimmt zu, ziemlich lebhaft)“. Hier ist eine Eitelkeit am Werk, die tut, als ob sie ihre Wirkungen nicht bemerkt, um sie insgeheim doch mit einem Taschenspiegel zu kontrollieren. Und es kann passieren, dass Percy plötzlich aus der Rolle des Allliebenden und Allesverzeihenden fällt und in seiner Predigt über die „Heruntermacher“ und das „Heruntermachen“ vom Leder zieht, sechzehnmal auf anderthalb Seiten. Da spürt man des Autors notorischen Groll durch, der sich regt, sooft ihm einer seine arglose Rührung nicht aufs Wort glauben mag.
Das Buch arbeitet sich ab an einem widersprüchlichen Vorsatz, den man mit nur geringer Überspitzung vielleicht so formulieren könnte: Dieser Autor will, dass man ihm dabei zuschaut, wie er sich selbst genügt. Es wäre trotzdem kein Walser-Buch, wenn in ihm nicht immer wieder auch erstaunliche Stellen und Formulierungen zu finden wären wie diese: „Meine Oberlippe kommt nicht in Frage, verglichen mit Deiner Oberlippe. Oberlippe, das kommt mir bei Dir vor wie eine Steigerung von Lippe.“ So schreibt Percy Liebesbriefe, wenn sein Schöpfer ihn nicht gerade zum Predigen verdonnert.
Hier flammt noch einmal des Autors alte Gabe auf, sich erotisch hinreißen zu lassen und bis zum Schamlosen an ein Du zu verlieren. Aber das Buch hat fünfhundert Seiten, auf denen beherrschend drei Walsersche Spiegel- und Wunschfiguren – Percy, Feinlein, Kainz – agieren. Als ein gelungenes sollte man es nach alledem nicht bezeichnen; nicht zuletzt, weil es ein landläufiges Gelingen gar nicht im Sinn hatte. Vielleicht sollte man ihm in Walsers überaus umfangreichem, mehr als ein halbes Jahrhundert umspannendem Werk einen Sonderplatz anweisen, ähnlich wie es sonst mit Briefen und Tagebüchern geschieht: als eine Alters-Apokryphe, einen Schatten am Rande des eigentlichen Corpus von Text und Mensch, der dessen Licht Kontur und Tiefe gibt.
BURKHARD MÜLLER
MARTIN WALSER: Muttersohn. Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek 2011. 505 Seiten, 24,95 Euro.
Die hier angewandte
„Schlafsacktherapie“ setzt ganz
auf Güte und Schweigen
Dieser Autor will, dass man
ihm dabei zuschaut,
wie er sich selbst genügt
Im neuen Roman von Martin Walser (links) nimmt Ewald Kainz mit seinem Motorrad an einer Ballon-Verfolgungsfahrt teil: „Der Ballon war immer noch rechts vor uns in der Höhe. Wenn das so weiterging, kämen wir auch noch durch Amtzell! Aber das doch nicht.“
Fotos (2): Felix Kaestle/dapd (links), Rex Features LTD/action press
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Ein großer Wurf. Welt am Sonntag