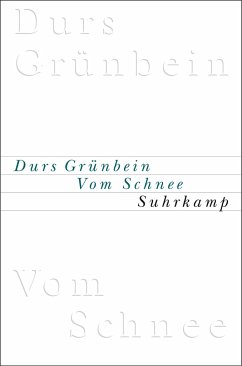»In welchem schneebedeckten Jahrhundert, mit Fingern / Steif / auf bereifte Scheiben gemalt, erschien dieser Plan / Zur Berechnung der Seelen?«, schrieb Durs Grünbein vor Jahren in einem Gedicht mit dem Titel Meditation nach Descartes. Der Held und das Leitmotiv des Gedichts sind nun zurückgekehrt in Form einer langen Eloge auf den Philosophen. Mehrere Winter lang hat der Autor an einem Poem gearbeitet, das nun vollständig vorliegt mit 42 Cantos, die den Kapiteln eines Romans entsprechen. Vom Schnee umkreist jenen Moment im Leben des René Descartes, da dieser im Winter des Jahres 1619 in einem süddeutschen Städtchen, einer Vision gehorchend, zu philosophieren beginnt. Das Erzählgedicht endet in einem anderen Winter, 30 Jahre später, mit dem plötzlichen Tod des Philosophen. In fortlaufenden Szenen werden Jugend und Reife des großen Denkers an der Schwelle der Neuzeit ineinandergespiegelt nach der Regie eines Traums.
Vom Schnee oder Descartes in Deutschland ist vieles. Ein Bilderrätsel; eine Unterhaltung in Versen, eine Hommage an die kälteste Jahreszeit und die Lehre von der Brechung des Lichts. Ein Bericht von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges und von der Geburt des Rationalismus aus dem Geist des Schnees.
Vom Schnee oder Descartes in Deutschland ist vieles. Ein Bilderrätsel; eine Unterhaltung in Versen, eine Hommage an die kälteste Jahreszeit und die Lehre von der Brechung des Lichts. Ein Bericht von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges und von der Geburt des Rationalismus aus dem Geist des Schnees.

Wie René Descartes das moderne Denken erfand: „Vom Schnee”, ein kongeniales Langgedicht von Durs Grünbein
Bald wird man Durs Grünbein in Schutz nehmen müssen. Zu bereitwillig war er in die Rolle des ebenso jungen wie gelehrten Dichters geschlüpft, als dass nun, da man ihn für reichlich erwachsen halten muss, nicht mancher auf den Gedanken käme, im offensiven Bekenntnis zur Gelehrsamkeit vor allem die Technik des persönlichen Erfolgs zu erkennen. Zu sehr war dieser Dichter zum Helden der Bildungsbeflissenen geworden, zum neunmalklugen Tausendsassa, der einen nickelbrilligen Hasen nach dem anderen aus den tiefen Taschen der Philosophie, der Naturwissenschaften oder der Literaturgeschichte holte. Doch kommt gegenwärtig der Grobianismus gut voran, er will Durs Grünbein für seinen frühen Aufstieg büßen lassen.
Dem Dichter geschieht dabei Unrecht, und den Banausen ist ein solcher Triumph nicht zu gönnen. Schon gar nicht aus Anlass dieses langen Gedichts. Ein Virtuose der lyrischen Form hat es geschrieben, der in beliebigen Rhythmen durch die Verse zu staksen, zu stolpern oder zu rauschen vermag, ganz wie es ihm gefällt. Er findet seltene Reime, und wenn ihm das Register der lautlichen Parallelen in den deutschen Endsilben zu klein dünkt, dann erweitert er es, indem er die männlichen mit den weiblichen Reimen mischt. Oder er lässt ein paar Reime aus, kaum dass man dies bemerkte.
Wo war das noch und wann?
Grünbein ist ein Meister der leicht angeschrägten, aber um so präziseren Assoziation: Das Jahr ist alt geworden und vergeßlich. Niemand zeugt / Für all die Vielfalt, die vor Tag im Schnee verschwand. / Zwei Männer, selbstvergessen, trotten wie betäubt / Vorbei an Weiden, die wie Keulen, Morgensterne drohn. In diesem Langgedicht in zweiundvierzig Cantos oder Kapiteln, ein jedes aus sieben Strophen zu je zehn Zeilen bestehend, hat der Dichter einen so großartigen, hinreißend schönen und erstaunlich lebendigen Stoff gewählt, dass ein paar Peinlichkeiten der jüngeren Zeit, die Übersetzung der „Sieben gegen Theben” von Aischylos etwa, sofort aus dem Gedächtnis verschwinden.
Kaum zweiundzwanzig Jahre alt ist der französische Edelmann René Descartes, als er in der Armee des Prinzen Moritz von Nassau-Oranien in den Dreißigjährigen Krieg zieht. Im Herbst 1619 schlägt seine Einheit in Neuburg bei Ulm ihr Winterquartier auf. Dann fällt der Schnee, in Massen, die Wege werden unpassierbar, kein Brief kommt mehr durch. In einer „Ofenstube eingeschlossen”, die Tage vertrödelnd, soll den jungen Soldaten hier, dem autobiographischen Bericht des Discours de la méthode von 1637 zufolge, der Einfall überkommen haben, mit dem die neuzeitliche Philologie beginnt: Auf einen Schlag, so sagt Ihr, mitten in der Nacht / Hat Euch ein Geistesblitz erweckt.
Gelten soll fortan nur, was der Zweifel übriglasse, lautet die neue Maxime. Gewiss sein soll nur, was klar und deutlich erkennbar sei. Wahr sein soll nur, was man in mathematischer Form darstellen könne. Die Geistesgeschichte lehrt, dass so das rationalistische Zeitalter beginne, wobei man sich den Verstand in diesem Fall als eine sehr mechanische Einrichtung vorstellen muss. Tatsächlich aber beginnt so vor allem die moderne Metaphysik: das Denken über das Denken.
Wo war das noch und wann? In einem hellen Augenblick / Hat er das Gleichgewicht der Welt gespürt - im Schnee. Diese Zeilen sind von tiefer, allzu begründeter Zweideutigkeit. Denn der radikale Skeptizismus, den René Descartes mit einem „Heureka” entwirft, ist ein durch und durch negatives Programm. Er ist, anders als der Philosoph erhoffte, ein tatsächlich unendliches Ausschließen. Anstatt dass nach einer Weile hartnäckigen Zweifelns etwas zweifellos Verbürgtes übrig bliebe, ist am Ende gar nichts mehr da. Der Schnee ist eine kühne, aber überaus treffende Metapher für das, was dieser methodische Zweifel seinen Gegenständen antut. Er raubt ihnen die Kontur, er deckt sie zu, bis von ihnen nichts mehr zu sehen ist, er schickt sie in die endlose, weiß-graue Leere eines langen Winters: Vom Frost geputzt der Zeichentisch - ein idealer Boden / Für den Discours, Monsieur. Allez! Für die Methode. Empathie scheint der Dichter für seinen Helden zu empfinden, doch gemeinsame Sache mit ihm macht er nicht.
Grünbein hat sein Gedicht zweigeteilt. Die ersten einunddreißig Cantos siedelt er in Neuburg an der Donau an, Sprünge in andere Zeiten und an andere Orte eingeschlossen: Man ist in Deutschland. Es herrscht Krieg. Im Frost erstarrt, / Steht vor dem Fenster schwarz, ein Bataillon, der Wald. Bestimmt wird dieser Teil von Dialogen mit dem erfundenen Diener Gillot, einem frühen Verwandten des fatalistischen Jacques, der stets nur den Körper im Sinn hat, wenn sein Herr vom Geist reden will. Der zweite, kürzere Teil spielt dreißig Jahre später im winterlichen Stockholm, wohin Königin Christine von Schweden das „Murmeltier” gerufen hat, um sich morgens um fünf Unterricht in Philosophie geben zu lassen: Hier heißt er snö. Ein Laut der in der Nase kitzelte / Wie eine Prise frischen Tabaks. Dieses ,Hö, hö, hö' / Klang sehr vulgär. Der Philosoph überlebt die Lektionen nicht. Der Tod, sagt der Dichter, unterliegt keinem Zweifel.
Es passiert viel in diesem Gedicht. Gustav Adolf von Schweden stirbt in der Schlacht bei Lützen. Der Blutkreislauf wird erläutert. Galilei Galileo scheitert am päpstlichen Gericht. Der Diener bewahrt eine Magd davor, ins Feldbordell verschleppt zu werden. Die Philosophen Thomas Hobbes, Pierre Gassendi und René Descartes trinken Burgunder. In den Niederlanden werden Winterlandschaften gemalt, die später im Museum hängen. Durs Grünbein geht ins Detail, so sehr, dass der Leser sich zuweilen einen Kommentar wünscht, der ihm die weniger selbstverständlichen Anspielungen erschließen könnte.
Auch dieser Reichtum ist beabsichtigt. Nicht nur, weil er wirkt, als dränge von überall her die Konkretion herbei, die das Denken in mathematischen Formen ausschließen soll. Sondern vor allem, weil der methodisch operierende Zweifel ein fahriges, unsystematisches, von Einfall zu Einfall, von Szene zu Szene, von Prüfung zu Prüfung springendes Denken zur Folge hat, ohne doch je zur Ruhe kommen zu können, allen Idealen einer skeptischen Gelassenheit zum Trotz.
Kippfiguren der Unsicherheit
Die Poesie bekommt hier etwas zu fassen, was sich die Geistesgeschichte gern entgehen lässt, wenn sie René Descartes zur Gründergestalt des neuzeitlichen Rationalismus erhebt. Die Maxime „Im Zweifelsfall – halt dich am Zweifel fest” bietet alles andere als Gewissheit, und das cogito ergo sum, der größte Gassenhauer der Philosophie, lässt sich auch als Fluch verstehen: als Verpflichtung zum Grübeln. Vielleicht ist das Leben nur ein Traum? Vielleicht leben wir nur im Traum eines anderen? Und wer träumt den anderen? René Descartes ist nicht deshalb zur Gründergestalt des modernen Denkens geworden, weil er ihm ein paar Antworten gefunden, sondern weil er seine Probleme erfunden hat – denn so, wie er seine Fragen stellt, müssen sie unlösbar sein.
Durs Grünbein bietet nun sein ganzes, großes lyrisches Können auf, um den raschen Wechsel zwischen methodischem Zweifel und sinnlicher Gewissheit, diesen Kippfiguren radikaler Unsicherheit, sinnfällig werden zu lassen: Ja, ja. Nein, nein. Habt ihr nicht oft geklagt, wie rasch / Eins umschlägt in das andere? Ein jedes Ding / Zeigt, lang genug besehn, uns bald sein Hinterteil. In der Wechselrede verliert der Leser schnell die Kontrolle darüber, wer spricht. Zuweilen stürzen die Bilder eher übereinander, als dass sie wanderten, und jede Figur ist hin und wieder moderner, als sie im siebzehnten Jahrhundert hätte sein können.
„Dann leg im Geist dich in die Kurve”, sagt der Dichter, und diese poetische Schräglage ist der philosophischen Erkenntnis ausgesprochen förderlich. Geschrieben hat Durs Grünbein sein Gedicht mit hohem formalen Aufwand, in Alexandrinern, im bevorzugten Versmaß des Barock, auch wenn seine Verse selten in reiner Gestalt daherkommen. Manche haben sieben Hebungen, manche fünf, und mit der Zäsur nach der dritten Hebung nimmt es der Dichter nicht so genau. Konsequenter gebraucht er den Jambus, der seine Rede in einen zuweilen mäandrierenden, doch regelmäßig und sehr melodisch plätschernden Bach verwandelt. Und schließlich liebt er die Stanze, die Strophe mit den gewöhnlich drei, hier aber vier wechselnden Endreimen und einem Reimpaar am Schluss. Sie treibt er voran bis hin zur gelegentlich albernen Pointe: Vorbei die Weihnacht. Im Regal der Speck wird ranzig. / Es geht aufs Ende zu. Bald schreibt man 1620.
Jeden, der in der Schule noch auf Reste humanistischer Bildung gestoßen ist, müssten die starken musikalische Effekt an die deutsche Klassik erinnern, an die „Zueignung” etwa in Goethes „Faust”. Durs Grünbein will die Vergangenheit der Dichtkunst lebendig werden lassen – und in diesem Klassizismus ist der einzige ernsthafte Einwand begründet, den man diesem langen Gedicht machen kann. Es fühlt sich wohler in der alten Form, als es ihm und seinem abgründigen Gegenstand gut tut.
Längst hat die strenge Form einen exquisiten Nebensinn bekommen, längst sagen Alexandriner oder Hexameter „klassisch”, „souverän” und „alt”, noch bevor ein Wort ausgesprochen ist. Schon das achtzehnte Jahrhundert hat sich dem Reim verweigert, Friedrich Gottlieb Klopstock allen voran, es hat zugleich die Versmaße ins Extrem des Artifiziellen getrieben. Durs Grünbein erzählt eine wunderbare, große, ernste Geschichte, und er erzählt sie in bewegender Schönheit und mitreißenden Bildern. Aber er kann nicht verhindern – wenn er es denn überhaupt wollte –, dass dem poeta doctus, der mit Begeisterung von seinen Lektüren erzählt, der Schatten des poeta laureatus über die Schulter fällt, der im Namen kultureller Selbstgewissheit zu sprechen scheint.
Ob Durs Grünbein diesen Effekt beabsichtigt, ist indessen alles andere als gewiss. Er möchte ein gelehrter Dichter sein, er will etwas Ernstes und Großes sagen. Es bleibt ihm also gar nichts anderes übrig, als das alte Podest des autonomen Dichters vom Dachboden zu holen und sich darauf zu stellen. Aber das Pathos der alten Form wirkt befremdlich, der Dichter auf seinem Podest sieht aus, als trage er ein Kostüm, und das Gedicht klingt, als habe es jemand zu stark geschminkt. Aber auch dies Risiko, zuweilen in beklemmende Nachbarschaft zum Kitsch zu geraten, ist Grünbein vermutlich bewusst. Eine Wahl hatte er nicht.
THOMAS STEINFELD
DURS GRÜNBEIN: Vom Schnee. Oder Descartes in Deutschland. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 144 Seiten, 19, 90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Ein Kabinettstück: Durs Grünbeins Winterbuch der Poesie
Der Philosoph dachte und schrieb in einer Kleinen Eiszeit: keine schlechten Produktionsbedingungen für den Begründer des neuzeitlichen Rationalismus! Um 1560 setzte in Mitteleuropa eine epochale Klimaverschlechterung ein: Die Temperaturen sanken spürbar, die Winter wurden kälter, der Schnee lag länger, Seen und Flüsse vereisten häufiger und dauerhafter, die alpinen Gletscher rückten bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts markant voran. In den Niederlanden, in denen der Philosoph die besten Jahre seines Lebens verbrachte, war die Durchschnittswintertemperatur, wie die Klimaforschung gezeigt hat, im ersten Viertel des siebzehnten Jahrhunderts besonders niedrig.
Die Kunst reagierte rasch auf diesen Klimawandel. Im Februar 1565 schuf Pieter Bruegel der Ältere mit seinen berühmten "Jägern im Schnee" das erste Gemälde, dessen eigentliches Thema eine Winterlandschaft bildet. In der Nachfolge Bruegels, von dessen noch im selben Jahr entstandener "Winterlandschaft mit Schlittschuhläufern und Vogelfalle" nicht weniger als 127 Kopien entstanden, wurde die Winterlandschaft zu einer höchst populären Gattung in der niederländischen Landschaftsmalerei. René Descartes (1596 bis 1650) war ein Zeitgenosse von Hendrick Avercamp, Jan van Goyen und Aert van der Neer, denen wir viele der schönsten Darstellungen in Schnee und Eis versunkener Landschaften verdanken. Es ist von hohem Reiz, sich Descartes als den idealen Betrachter dieser unter dem Pinsel des Malers eingefrorenen Landschaften vorzustellen.
Der Dichter als Ruisdael
Durs Grünbein erzählt vom Leben und Sterben des René Descartes in Form von 42 Winterbildern, und oft will es dem Leser scheinen, als hätten die Schöpfer der niederländischen Winterlandschaften des siebzehnten Jahrhunderts dem Dichter dabei die Hand geführt. "Ruisdael als Dichter" hat Goethe seinen schönsten Aufsatz zur Landschaftsmalerei betitelt; ein Aufsatz über das neue Buch von Durs Grünbein aber könnte den Titel tragen: Der Dichter als Ruisdael. Dies Buch ist ein Meisterwerk: eine Galerie aus 42 Kabinettstücken, zumeist Interieurs, in die das kalte Licht des Winters fällt, dazwischen Schneelandschaften, durch die sich einsame Spaziergänger ihren Weg bahnen.
Die Bilder haben alle dasselbe Format: sieben Strophen mit jeweils zehn alexandrinerähnlichen Versen. In dieses formale Schema wird das Leben des Descartes gebannt und dichterisch damit auf kunstvolle Weise ins Enge gezogen. Seine Welt reduziert sich auf das beleuchtete Zimmer inmitten der Eiswüste einer durch die Schneedecke reduzierten Landschaft, auf das Bett als Schneelandschaft sui generis, auf den kühlen eigenen Kopf. In dem aber hat bekanntlich die ganze Welt Raum. Und so auch in den engen Formaten der Grünbeinschen Kabinettstücke: Genreszenen aus dem Leben eines Philosophen, in denen eine ganze Welt Platz findet: "Momentlang wird ein Mensch im Schnee / Zum Ebenbild, wie er dort stapft und trägt in sich das All, / Bevor ihn Zeit schluckt, Landschaft, und sein Ruf verweht." So werden im poetischen Bild Augenblick und Ewigkeit, Landschaftsausschnitt und All ineinandergeschaltet.
Mit der Virtuosität eines Feinmalers - tatsächlich wird an einer Stelle Gerrit Dou erwähnt - kostet Grünbein als Schöpfer von Winterbildern die Effekte aus, die ihm die Affinität seines dichterischen Verfahrens zu demjenigen eines Malers eröffnet. Das zehnte Bild oder Kapitel trägt den Titel "Landschaft mit Zeichner". Es stellt den jungen Descartes und seinen Diener Gillot zu Ende des Jahres 1619 bei einem Spaziergang durch eine tiefverschneite und bitterkalte Winterlandschaft dar - und siehe da, hierbei erweist sich, wie in unserem eingangs angestellten Gedankenspiel erwogen, Descartes tatsächlich als ein genauer Kenner der zeitgenössischen niederländischen Winterbilder.
"Glühendes Eis, flambierter Schnee": in solchen petrarkistischen Oxymora faßt Descartes den Eindruck einer gleißenden Winterlandschaft zusammen, deren "Zeichner" der Teufel ist. Aber in Wahrheit kennt er diesen "flambierten Schnee" aus der Malerei: "Man sieht ihn manchmal auf Gemälden." So verwandelt sich die Winterlandschaft, die Herr und Knecht durchwandern, vor ihren Augen nun selbst in eine Serie von Bildern, die klar und deutlich von ihnen wahrgenommen werden: "Nur ihre Augen absorbieren weiter Bild um Bild. / Die Leinwand blendet."
Aber so, wie ihnen die Winterlandschaft als Bild erscheint, werden auch sie selbst als Staffage eines Winterbildes vom Leser klar und distinkt wahrgenommen. Und hier nun meldet sich so plötzlich wie unvermutet ein Ich zu Wort, das keine der erzählten Figuren repräsentiert. Es ist das Ich des Autors, das sich hier einmal - und nur an dieser Stelle! - selbst ins Bild setzt. Denn er ist der "Zeichner" dieser Landschaft, der mit seiner Einbildungskraft Zeit und Raum überwindet: "Ich seh sie noch. Was sind schon drei-, vierhundert Jahre? / Im hohen Schnee wird alles Bild. Als Winterlandschaft / Gerahmt, kehrt jede Szene wieder, die einst war." So inszeniert sich der Dichter als Landschaftsmaler in sein eigenes Bild hinein: wie ein Vedutist des siebzehnten oder achtzehnten Jahrhunderts auf seinem Repoussoir.
Durs Grünbeins Buch "Vom Schnee", das in dieser Zeitung vorabgedruckt wurde, gliedert sich auf eine Weise in zwei Teile, die von ferne an Petrarcas "Canzoniere" mit seiner Aufteilung der Gedichte "in vita" und "in morte di Madonna Laura" erinnert. Der 31 Szenen umfassende erste Teil der Verserzählung spielt in jenem Winter 1619/20, den der junge Descartes, der seit 1618 in den Diensten des Statthalters Moritz von Nassau und Tillys stand, im Winterlager bei Ulm verbrachte: in dem entscheidenden Abschnitt seines Lebens also, als sich bei Descartes jene innere Revolution vollzog, die in die Ausbildung der Gewißheit des "cogito ergo sum" und seiner Methode, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, mündete.
Der zweite, mit elf Kapiteln sehr viel kürzere Teil erzählt vom Tod des alternden Philosophen im kalten Winter 1649/50, den er am Hof der Königin Christine in Stockholm verbrachte. Vita et mors, Leben und Tod: auf diese beiden Pole konzentriert Grünbein seine Erzählung - dazwischen aber erstreckt sich die weite Todeslandschaft des Dreißigjährigen Krieges, der in Erwartung und Erinnerung des skeptischen Rationalisten beständig gegenwärtig ist. Von der riskanten Welt dieser europäischen Eiszeit, in der der Schnee vom Krieg "flambiert" wurde, spricht Durs Grünbein wie ein Andreas Gryphius des 21. Jahrhunderts: "Die Wette gilt - der nächste Tag zertritt wie Gras / Die heile Welt von gestern, die das Kindchen wiegt. / Was einmal jung war und begehrt, wird schließlich Aas. / Träg ist der Leib, Not macht erfinderisch. Der Krieg / Tritt rasch ins Haus - so ungebeten wie die Pest. / Das Epos Leben zehrt davon, daß keiner sich recht freut. / Hier reift ein Held heran, da ein Verrat, dort ein Abszeß, / Nach dem Prinzip der isolierten Bilder - täglich neu."
Es macht die Größe dieses philosophischen Winterbuchs als Poesie aus, daß es nie die Gedankenwelt des Descartes referiert, sondern sie ganz und gar aufgehen läßt im poetischen Bild: in den Träumen des Denkers, in seinen Empfindungen und Wahrnehmungen, im Wechselspiel von Figur und Landschaft, in den Dialogen des jungen Herrn mit seinem Faktotum Gillot. Darin erinnert Grünbeins dichterisches Verfahren an dasjenige des herrlichsten philosophischen Sommerbuchs, Diderots "Jacques le fataliste", in dem aller Ernst der Philosophie aufgehoben wird in der schwerelosen Heiterkeit der Erzählung. Grünbeins Erzählung aber ist von schwerelosem Ernst - und dies nicht allein deshalb, weil sie, anders als diejenige Diderots, grundiert ist von der Allgegenwart des Krieges und weil sie schließlich in den Tod mündet, während Diderots Roman mit komödiantischer Verehelichung schließt. Sondern dieser Ernst resultiert auch daraus, daß Grünbeins Erzählung, ihrem Gegenstand gemäß, immer in den Grenzen des einsam denkenden Ich verbleibt.
"Ich war nur Kopf und Handschrift": so beschreibt Descartes in dem 21. Kapitel, das die Mitte des Buches bildet, seine Situation in dem verschneiten süddeutschen Dorf in jenem Augenblick der Inspiration, da ihm die erlösende Gewißheit zuteil wurde: "Ich war erlöst. Ich war ein neuer Mensch. Erst jetzt / War ich mir sicher: ja, René - du bist, du bist." Aber die Wiedergewinnung der Gewißheit, in die der bis an seine äußerste Grenze geführte Skeptizismus umschlägt, hebt die Einsamkeit des Ich nicht auf, sondern bestätigt sie: "Ich seh ihn noch, die Stirn gesenkt, / Den jungen Mann im Zimmer: mich. Der Winter hält / Den Tag mit Eisenpranken. Und ein Menschlein überdenkt / Die große Unbekannte draußen - jene Glitzerwelt. / ,Tabula rasa' murmelt er, der dort noch immer sitzt. / Er atmet ruhig. Er scheint weit weg. Er lacht verschmitzt." Die vom Schnee in ihrem Formenreichtum reduzierte Naturszenerie ist nicht allein die Spielfläche der analytischen Geometrie und einer Vernunft, für die die Welt berechenbar wurde - "Schnee abstrahiert. Nehmt an, er hat das Bett gemacht / Für die Vernunft." -, sondern sie ist in Grünbeins Buch zugleich eine allegorische Landschaft, in der sich die Situation des denkenden Ich im Zeitalter des neuzeitlichen Rationalismus poetisch vergegenwärtigt. Die Welt als Tabula rasa, ihr Zentrum: das einsam denkende Ich.
Kleine Eiszeit des Denkers
Daß dieses ernste Poem in jedem seiner Verse dennoch nahezu schwerelos erscheint, dafür sorgt eine Sprache von solcher Biegsamkeit, solcher Geschmeidigkeit und solchem Variationsreichtum, wie sie in der deutschen Gegenwartsliteratur ohne Beispiel sein dürften. Das historische Versepos hat seine letzte große Blüte in der deutschen Literatur während der Biedermeierzeit erfahren: in "Die Schlacht im Loener Bruch" der Droste etwa oder in Lenaus "Albigensern"-Texten. An diese Tradition läßt sich nicht mehr anschließen. Der historisierende Duktus, in den Grünbein seinen Text kleidet, wird denn auch auf virtuose Weise ironisch gebrochen durch eine Vielfalt von Stilzitaten, die sich vom Balladenton ("Bei Lützen wars") über das Geschichtsdrama bis zum historischen Roman erstrecken, und manchmal klingt, willentlich oder unwillentlich, auch ein wenig Wilhelm Busch hervor: "Ein Thermometer mißt zum ersten Male hohes Fieber. / Der Logarithmentafel folgt der Rechenschieber." Dies alles aber fügt sich einem poetischen Duktus ein, der vor allem durch eines charakterisiert wird: durch jene Entspanntheit und Unangestrengtheit eines dichterischen Zugriffs, die allein Meisterschaft gewährt. So formt sich dem Dichter als Landschaftsmaler das Bild des Denkers in der Kleinen Eiszeit aus der Präzision der Wahrnehmung, des künstlerischen Gedankens und der sprachlichen Vergegenwärtigung zu einer Winterlandschaft, in deren Unwirtlichkeit auch der Betrachter des 21. Jahrhunderts sich zu spiegeln vermag.
Durs Grünbein: "Vom Schnee oder Descartes in Deutschland". Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 144 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Als präventive Verteidigungsschrift gegen die Grünbein-Verächter unter den Gebildeten legt Thomas Steinfeld seine Rezension dieses Gedichts in 42 Cantos an. Entsprechend überschwänglich fällt sie aus: Als "Virtuose der lyrischen Form" wird Grünbein gepriesen, gewählt habe er einen "großartigen, hinreißend schönen und erstaunlich lebendigen Stoff" - nämlich nicht weniger als Leben und Denken Rene Descartes. Zwischen Leib und Verstand, zwischen sinnlicher Konkretion und nicht beendbarem Gegrübel werde der Philosoph hier verortet, in "mitreißenden Bildern", in einem ohne formale Pedanterie ausgeführten Alexandriner-Rhythmus, der den Text in einen "sehr melodisch plätschernden Bach" verwandele. Gänzlich überzeugend findet Steinfeld auch die "kühne, aber überaus treffende Metapher" vom Schnee, der die im grundlegenden Zweifel angestrebte Schärfe des Denkens in grundlose Ununterscheidbarkeiten verwandele. Nur eins muss Steinfeld, nach der Hymne, die er gesungen hat, am Ende doch anmerken: Der formale Klassizismus des ganzen Unternehmens bleibe ein nicht wegzudiskutierendes, ja nachgerade problematisches Faktum. Ungestraft fällt ein Dichter in dieser Manier denn doch nicht aus der Zeit. Dieser große Gesang bewegt sich für Steinfeld deshalb in bezaubernder Weise mitunter in "beklemmender Nachbarschaft zum Kitsch".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Grünbein entwirft das Bild eines kalten, kargen Landes. Die Eleganz und die Intelligenz seiner Verse aber wärmen zumindest den Hörer."