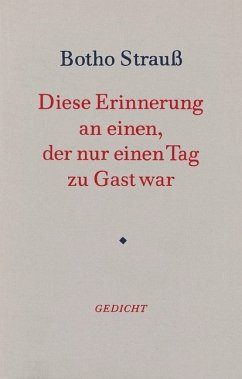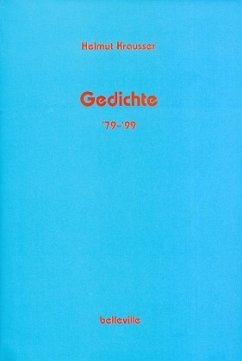schönen Harmonie: "Helga M. Novaks Gedichte erzählen. . . vom Leben im Wald, vom Leben jenseits westlicher Sehnsüchte."
Vor zwölf Jahren hat Helga M. Novak einen Zyklus mit dem Titel "Legende Transsib" veröffentlicht; eine Landkarte mit dem Verlauf der Transsibirischen Eisenbahn illustrierte die poetische Reise, aber die Dichterin hatte "das sibirische Weiß nicht gesehen", sie hatte sich "den Landstrich schreibend angeeignet", die Legende weitergeschrieben. Daß man auch den Wald erfinden und erdichten muß, selbst wenn man drin wohnt, ist keine unwichtige Botschaft dieses Werks. "Verwildertsein", "Duelle", "Artemisleben" heißen die drei Abteilungen des Bändchens und bezeichnen genau, daß es nirgends um das Einvernehmen mit der Natur, "jenseits westlicher Sehnsüchte", geht, sondern um Mythos, Sage, Legende und den Atavismus der Jagd.
Gleich das erste Gedicht ist "verwildert", es spricht nicht über den Wald, sondern über die Wilde Jagd, über Geisterheere der Zwölf Nächte - doch nicht aus eigener Erinnerung steigen die Sagengestalten der toten Jäger auf, sie sind buchstäblich aus den Artikeln "Wilde Jagd" und "Wilde Männer" des Großen Brockhaus direkt ins Gedicht montiert; "silvatica", erfährt man, heißt "Waldfrau"- heilkundig, männergierig oder jungfräulich wie Artemis. Das lyrische Ich ist in diesen Gedichten immer eine Frau, ist auch Helga M. Novak, und versetzt sich in viele Gestalten. Als "Handlangerin" folgt sie dem Jäger, der ein Wilderer ist, aber den Namen des heiligen Eustachius trägt: nach der Legende hat diesen römischen Feldherrn ein Hirsch mit einem strahlenden Kreuz zwischen den Stangen seines Geweihs zum Christentum bekehrt. Die Volkssage hat das Wunder dann dem Maastrichter Bischof Hubertus untergeschoben.
Die Jagd, seit Jahrtausenden scheinbar bis zur Neige allegorisch ausgebeutet, erweist sich noch einmal als Fallgrube und Fangnetz für eine Reihe von vitalen und poetischen Anliegen der Dichterin, zuerst das soziale: "Landvolk hat viele Münder". Der nicht erst in der DDR (aber immerhin dort am intensivsten) wiederentdeckte Thomas Müntzer hatte vorwurfsvoll geschrieben: "Unsere Herren und Fürsten nehmen alle Kreaturen zum Eigentum." Ganz im Müntzerschen Sinne feiert Helga Novak das Wilderer-Idyll im Gedicht "sonntags": ". . . Rupfen und Häuten in allen Küchen / statt Kirchengang diese Ernte / im gottgeschenkten Revier / Schnapsbrennen ist auch verboten". Der Wilddieb, ihr Eustachos, lebt allerdings gefährlich, aber "hängen sie ihn stirbt er / mit vollem Bauch / wenigstens mit vollem Bauch."
Dem sozialkritischen Engagement steht ein ökologisches ganz nahe: die Wilde Jagd ist Imagination, aber "die Motorsägen kommen näher / kein Wunder geschieht dem der Bäume fällt". Das "Muspilli", in althochdeutschen Stabreimversen nicht lange nach Karl dem Großen gedichtet, scheint zu der Dichterin in ihrer eigenen Sprache zu sprechen: sie übersetzt ein Stück daraus ("das Moor verschluckt sich selbst") und nimmt es ironisch wieder auf in "gebrochenes Herz": "steigendes Meer wie es sich verschluckt / an Schrottbergen". In einer Art Lügengedicht zeichnet sie den Wald als Schlaraffenland ("zu einem Gastmahl hat der Wald geladen. . . "), bis der ernüchternde Schlußvers alles zurücknimmt: "Ich gebärde mich als sei die Natur noch genießbar."
Tiefer, persönlicher und poetisch eigenwilliger dringt schließlich jene uralte Gleichsetzung von Jagd und Liebe hervor, hart nebeneinandergestellt in den Versen: "die Jagd wird aufgehen immer wieder / denn Liebe hat keine Schonzeit." Die Silvatica ist die "Handlangerin" ihres Eustachos, aber sie ist auch das Wild: "mit aufgestellten Ohren und auf dem Sprung / habe ich auf dich gewartet du Wildbeuter / ein Fossil wie der letzte Jäger" und: "warum nicht mich niederstrecken vor Knall und Fall". Der Jungfräulichkeit der Artemis steht die abergläubische Enthaltsamkeit des Jägers gegenüber, "denn Liebe kommt dem Jagen nicht zugute". Aber das widerstrebt der wilden Waldfrau: "hab keine sieben Jahre mehr / für eine neue Jungfernhaut / kann nicht mehr warten / bin zu alt komm her".
Das Thema des Alters verschlingt sich mit dem Thema der Liebe bald auf bedrückende, bald auf befreiende Weise. Neben dem bedrückenden Ausdruck des Scheiterns ("zu spät noch einen Fangschuß zu erbitten von dir") gibt es kein Glück: "Brust an Brust mit dir daß keine Kugel zwischenpaßt / ist lange her daß ich ein Schmaltier gewesen bin / dies Beben jetzt ist eine Altersliebe schönes Zittern". Das vorletzte Gedicht "Abenteur am Abend" versucht wiederum diesen Ton: "warum nicht zielklaren Händen sich hingeben in Liebe / warum nicht die Lebtage krönen / mit dem Abenteuer des Alterns". Das wäre eine schönere Art des "Wartens auf den großen grauen Jäger", klänge wie Schwanengesang, wüßte die Dichterin es nicht besser: "Schwäne singen übrigens nicht / sie weinen bloß / wenn sie nicht mehr zuschlagen können / mit ihren Hälsen."
Helga M. Novak: "Silvatica". Gedichte. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 1997. 95 S., geb., 32,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
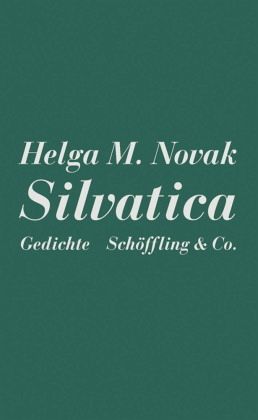




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.11.1997
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.11.1997