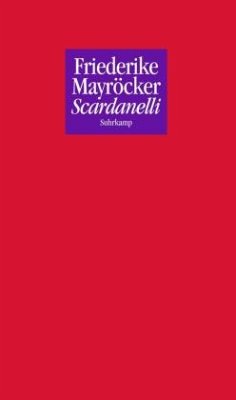mit Scardanelli
im Grunde deines Mundes, damals
wann weisz die Schwalbe dasz es Frühling
wird nachts nadelst du als Regen an mein Fenster ich
liege wach ich denke an die Nachmittage umschlungenen
Mitternächte, vor vielen Jahren diese Rosenkugeln die
Schaafe auf der dunklen Himmels Weide
Die Spur führt nach Tübingen, in eine Turmstube oberhalb des Neckars. Dort sitzt einer und schreibt. Hölderlin nennt er sich indes nicht mehr. Seine Gedichte unterzeichnet er "Mit Unterthänigkeit / Scardanelli".
Seine Stube verläßt er nur selten, und doch begegnet ihm Friederike Mayröcker auf ihren Streifzügen durch magische Kopf- und Sprachlandschaften auf Schritt und Tritt: Mal stößt sie auf ihn, "wo junge Blättchen wo verborgene Veilchen schwärmten", mal zeigt er sich als "1 schöner / Wanderer mit Alpenhut und einer Blume in seiner / Hand".Zwischen Januar und September 2008 entstanden 40 Gedichte, in denen Friederike Mayröcker dem hymnischen Ton und den freien Rhythmen Friedrich Hölderlins folgt. Meist reicht ein einzelnes Wort, manchmal ein Teil einer Verszeile, um die Sehnsucht zu beflügeln: "ich möchte / leben Hand in Hand mit Scardanelli".
im Grunde deines Mundes, damals
wann weisz die Schwalbe dasz es Frühling
wird nachts nadelst du als Regen an mein Fenster ich
liege wach ich denke an die Nachmittage umschlungenen
Mitternächte, vor vielen Jahren diese Rosenkugeln die
Schaafe auf der dunklen Himmels Weide
Die Spur führt nach Tübingen, in eine Turmstube oberhalb des Neckars. Dort sitzt einer und schreibt. Hölderlin nennt er sich indes nicht mehr. Seine Gedichte unterzeichnet er "Mit Unterthänigkeit / Scardanelli".
Seine Stube verläßt er nur selten, und doch begegnet ihm Friederike Mayröcker auf ihren Streifzügen durch magische Kopf- und Sprachlandschaften auf Schritt und Tritt: Mal stößt sie auf ihn, "wo junge Blättchen wo verborgene Veilchen schwärmten", mal zeigt er sich als "1 schöner / Wanderer mit Alpenhut und einer Blume in seiner / Hand".Zwischen Januar und September 2008 entstanden 40 Gedichte, in denen Friederike Mayröcker dem hymnischen Ton und den freien Rhythmen Friedrich Hölderlins folgt. Meist reicht ein einzelnes Wort, manchmal ein Teil einer Verszeile, um die Sehnsucht zu beflügeln: "ich möchte / leben Hand in Hand mit Scardanelli".

Diese wunderbaren nächtlichen Geschöpfe: In ihren neuen Gedichten tritt Friederike Mayröcker in ein intimes Zwiegespräch mit Friedrich Hölderlin und beschwört zugleich idyllische Momente mit Ernst Jandl.
Ein harmloser Zeitvertreib ist das Dichten für Friederike Mayröcker nie gewesen. Ihr Vertrauen in die schöpferische Kraft der Sprache und ihre Unbekümmertheit gegenüber allen literarischen Moden haben im Lauf der Jahrzehnte ein vielseitiges Werk hervorgebracht. Bei aller verspielten Sprachlust, der Freude an kühnen Bildern und manchen Verstößen gegen die Grammatik hat sie nie die großen Themen aller Kunst - Liebe, Vergänglichkeit, Tod - gescheut. Vielleicht ist es gerade dieser existentielle Ernst, der Friederike Mayröcker nun den Dialog mit Friedrich Hölderlin suchen lässt.
Scheu vor dem berühmten Kollegen kennt Mayröcker nicht. Gleich das erste Gedicht ihrer neuen Sammlung setzt, fast wie ein Kochrezept, mit einer "Prise Hölderlin" ein, und wenig später bekennt sie: "ich möchte / leben Hand in Hand mit Scardanelli". "Scardanelli", zugleich der Titel des Buchs, ist jener rätselhafte Name, mit dem Hölderlin viele seiner späten Gedichte unterzeichnete. Zu dieser Zeit lebte der kranke Dichter bereits im Tübinger Turmzimmer, das ihm für mehr als drei Jahrzehnte zur eng umgrenzten Heimat werden sollte. Keine einfache Lebensgemeinschaft zwischen den Jahrhunderten also ist hier zu erwarten.
Mit dem schwäbischen Turmbewohner teilt Friederike Mayröcker in diesen vierzig neuen Gedichten zunächst das Vergnügen an der Landschaft am Neckar, dessen "bläuliche Silberwelle", so hatte Hölderlin ihn beschrieben, nun auch durch ihre Verse fließt. Mayröcker weiß aber auch von den Gefährdungen alles Schreibens: "die Bilder in meinem Kopf rasen wie irrwitzige". Von solchem Irrwitz ist es möglicherweise nicht weit zu jener "Umnachtung", als die man Hölderlins Geisteskrankheit gern umschrieben hat. So hebt denn auch eins von Mayröckers Gedichten mit dem Wunsch nach Beistand an: "sei du bei mir in meiner Sprache Tollheit".
Von "Tollheit" kann hier allerdings keine Rede sein. Im Gegenteil: Friederike Mayröcker, die seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr, also seit nunmehr siebzig Jahren, Gedichte schreibt, hat sich erstaunliche sprachliche Präzision wie Originalität bewahrt. Im steten, mitunter erfrischend unkonventionellen Dialog mit Hölderlins Dichtung entstehen vielschichtige Texte, die oft an Vexierbilder erinnern. Denn obwohl es Mayröcker ihren Lesern auf den ersten Blick leichtzu machen scheint und die vermeintlichen Hölderlin-Zitate graphisch hervorhebt, ist ihr niemals zu trauen. Längst nicht alle Entlehnungen von Hölderlin werden nämlich markiert, und oft genug entpuppt sich ein scheinbar wortgetreues Zitat als virtuose Montage, in der Fremdes und Eigenes miteinander verschmelzen. "Im Grunewald / ,oft ich weinend und blöde' (Hölderlin)" lautet zum Beispiel die verwirrende Titelzeile eines Naturgedichts, das der Berliner Literaturwissenschaftlerin Heidrun Loeper gewidmet ist.
Nun kannte sich Hölderlin zwar in der schwäbischen Topographie und an den Küsten des antiken Griechenlands bestens aus; die Hauptstadt des fernen Preußens aber blieb ihm, dem Sänger "heiliger Wälder", mitsamt dem profanen Grunewald fremd. Tatsächlich stammt der Hölderlin zugeschriebene Halbvers nicht von ihm, vielmehr fügt Mayröcker hier Vokabeln, die er gern gebraucht hat, neu zusammen, um ein Bild ihrer eigenen melancholischen Menschenscheu mit dem Gruß an die deutsche Freundin zu verbinden. Überdies bringt hier die Wortgeschichte die Sprache auf ungewohnte Weise zum Klingen: Das in heutigen Ohren abwertend klingende "blöde" bedeutete für Hölderlin und seine Zeitgenossen nichts anderes als "schüchtern".
Oft variiert Mayröcker auch ein und denselben Hölderlin-Vers. Besonders angetan haben es ihr seine Naturbeschreibungen und sein Blick für das Kleine, Unscheinbare. "Wo die verborgenen Veilchen sprossen", heißt es in einem seiner Tübinger Turmgedichte, und Mayröcker lässt nun an vielen Stellen des Buches diese Veilchen in immer neuen Zusammenhängen "sprieszen" und "schwärmen".
Stärker noch als bei Hölderlin, gelegentlich aber in seiner Sprache, ist die Natur für Friederike Mayröcker vor allem Erinnerungsraum an glückliche vergangene Tage, und wie schon in ihren vorangehenden Büchern ist dabei auch hier das Andenken an ihren im Jahr 2000 verstorbenen Lebenspartner Ernst Jandl allgegenwärtig. Die Schilderung einer Wanderung "auf dem Cobenzl" mündet in die Beschwörung der lebensrettenden Nähe des Freundes: "ach es drängte mich deine / Hand zu ergreifen um dem Bedürfnis nicht nachgeben zu / müssen mich in den Abgrund zu stürzen (dem blüthenlosen)". Momente des ungetrübten Einklangs mit "EJ" beschwört Mayröcker in einer der wenigen Idyllen der Sammlung: "er lädt mich zum Essen es war schon Frühling wir waren / uns eins ich spürte die Fülle seines Geistes er trank / 1 Glas Rotwein und mehr ich blickte ihn lange an faszte / nach seiner Hand die Zeit verging noch nicht so rasch wie / heute er wuzste Bescheid ich war geborgen."
Diese Geborgenheit aber hat mit dem Tod des Gefährten aufgehört, und oft findet Mayröcker Trost in dem Gedanken an ihre eigene Vergänglichkeit. Besonders anrührend ihr Epitaph auf sich selbst: "Besuch mich / nicht an meinem Grab es hilft mir nicht ich bin schon / tot. Ich bin so traurig jetzt und habe Angst vor dem / Verlassen dieser Welt die ich so sehr geliebt mit ihren Blüthen / Büschen Bäumen Monden mit ihren wunderbaren nächtlichen / Geschöpfen. Mein Leben war zu kurz für meinen Lebenstraum."
Noch aber verfügt Friederike Mayröcker über die Kraft, diesen Lebenstraum, der ein Traum in Sprache und aus Sprache ist, fortzuführen. Im freundschaftlichen Zwiegespräch überblendet sie die eigenen Erfahrungen mit denen ihres Vorgängers, was der Natur in ihrer Variation auf Hölderlins Ode "Chiron" geradezu magische Züge verleiht: "Verzaubert ist mir die Welt / und fiebrig in meinem Schädel Nachtviolen Fuchsien Weiden Pinien / und Reseden lauschend im Garten (ich) Krokus und Haferkorn auch, / kirschenessend in tiefer Nacht, auch, ich auch den weich' Kräutern, / Hölderlin." Auf der poetischen Landkarte der Friederike Mayröcker grenzt ihre Heimat Wien unmittelbar an die schwäbischen Neckarufer.
SABINE DOERING
Friederike Mayröcker: "Scardanelli". Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009. 56 S., br., 14,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Mein Leben im Robinienflor: Friederike Mayröcker schaut vom Hölderlinturm in den Neckar, verbündet sich mit allerhand Dichtern und schafft den Sprung über ihren eigenen Schatten Von Hans-Herbert Räkel
Mit Unterthänigkeit Scardanelli" signierte Friedrich Hölderlin, seit 1806 psychisch krank, jene eigentümlichen Gedichte, die er gegen Ende seines Lebens im Wahnsinn verfasste. Dass unser Umgang mit der Dichtung sich oft unmerklich in einen Umgang mit den Dichtern verwandeln möchte, ist nicht so tadelnswert, wie eine strenge Fraktion der Literaturwissenschaft behauptet. „Scardanelli” im Munde Friedrich Hölderlins und aus seiner Feder ist ein poetisches Produkt, eben das Wort, in welchem der Dichter sich selber überlebte. „Scardanelli” als Titel des neusten Gedichtbändchens von Friederike Mayröcker ist nun vollends eine poetische Chiffre, die von dem darunter verborgenen und sich selber fremd gewordenen Friedrich Hölderlin abstrahiert und ihrer Stimme einen verfremdeten und doch ganz eigenen Klang gibt.
Dass auch der Name „Hölderlin” eine poetische Aura besitzt, konstatiert sie beinahe ironisch im ersten Vers des Bändchens, der den Eindruck eines Besuchs in Tübingen wiedergibt: „eine Prise Hölderlin”. Jedesmal wenn der Name in den Gedichten auftaucht – sogar abgekürzt als „Höld.”, enthält er eben als poetische Chiffre eine „Prise Hölderlin”. „Scardanelli” und „Hölderlin” üben einen Zauber aus, haben die Kraft eines poetischen Klischees, ja Fetisch-Charakter.
Ein ganz kurzes Gedicht heißt zwar „mit Scardanelli”, aber es zeichnet mit kräftigen Strichen Friederike Mayröckers eigenes poetisches Grundthema seit dem Tod des „Freundes” Ernst Jandl: „ich denke an die Nachmittage umschlungenen / Mitternächte, vor vielen Jahren diese Rosenkugeln die / Schaafe auf der dunklen Himmels Weide”. Dass hier in Bildern eine Liebe aufersteht, die der Tod zerbrochen und geheiligt hat, ist für das lyrische Ich als Erlebnis dargestellt, für Leserinnen und Leser spontan verständlich. Doch spricht dieses Ich nicht nur aus eigener Inspiration, sondern lässt Gelesenes einfließen und signalisiert es bei der Niederschrift sogar durch Kursivdruck und die altertümliche Rechtschreibung „Schaafe”. Das Ich (und die Autorin) schreibt also nicht allein, sondern „mit Scardanelli”, obwohl das Gedicht, aus dem diese „Schaafe” grüßen, ganz am Anfang von Friedrich Hölderlins langer Leidenszeit verfasst worden ist, als er sich noch gar nicht Scardanelli nannte: „Da, auf den Wiesen auch / Verweilen diese Schaafe.”
Die poetischen Fragmente, die Friederike Mayröcker aus Hölderlin-Scardanelli heraushebt, gehorchen demselben Prinzip: Es sind Chiffren für eine hölderlinische Poetizität im Dienste ihrer eigenen, oder umgekehrt: Das lyrische Ich lässt sich von Hölderlin-Scardanelli die Feder führen. Jenes Gedicht, das mit „eine Prise Hölderlin” beginnt, datiert am 6.6.89 nach einem Besuch im „Hölderlinturm, am Neckar, im Mai”, funktioniert wie ein Prolog der kleinen Sammlung und endet mit einem Zitat aus Hölderlins Gedicht „Der Neckar”: „es / glänzt die bläuliche Silberwelle”. Mit diesen Worten schlüpft die Besucherin sozusagen in den Blick des Dichters (obwohl er noch lange nicht in dieses Turmzimmer verbannt war, als er so den Neckar bedichtete).
Dem Prolog folgt ein poetisches Tagebuch von neununddreißig genau datierten Gedichten, die (bis auf das zweite) alle von Januar bis September 2008 entstanden sind. Sie enthalten zwar immer wieder solche Bruchstücke, aber selten bringen sie deren eigene poetische Aussage mit wie dort im Prolog. Im Gegenteil scheint sich die Dichterin zu bemühen, die zitierten Fragmente noch weiter zu fragmentieren. Am Anfang des Gedichts vom 31. 5. steht wie Kauderwelsch: „die mir geblieben sind die blühend holden Gestirne zu oft mich dessen' Höld.” Das befremdliche „dessen” gehörte bei Hölderlin zu dem hier unterdrückten Verb „mahnen”, und die Stelle hieß in „Mein Eigentum” (1799): „...doch wie Rosen, vergänglich war / Das fromme Leben, ach! und es mahnen noch, / Die blühend mir geblieben sind, die / Holden Gestirne zu oft mich dessen.” Die brüchige Syntax irritiert zwar, aber sie überlässt auch das gesamte poetische Feld den Bildern. Dieses lyrische Ich will nicht aussagen, sondern evozieren.
Die dichterische Phantasie greift auch zu anderen Gewährsleuten: Durs Grünbein, John Updike, Elke Erb. Andere bleiben anonym; wenn man sucht, findet man manchmal die Quelle, wie bei dem „viel war mir teuer” vom 1.5. und auch schon, versteckter, am 5.4. Es erinnert an den unglücklichen jüdischen Wiener Dichter Theodor Kramer, der, nach langem Londoner Exil nach Wien zurückgekehrt, 1958 starb und der in Lenauscher Manier gedichtet hatte: „Nichts bleibt – und viel war mir teuer – / nichts, nun die Zeit mir verrinnt, / nichts als das sinkende Feuer / und in den Bäumen der Wind.” Hier kann man im Vergleich spontan erkennen, wo Friederike Mayröckers dichterische Potenz steckt. Wenn sie an das Vergangene denkt, bleibt ihr nicht „nichts” wie dem traurigen Theodor Kramer, dessen Klage sie doch so gut nachfühlen kann, sondern eine mit großer Anstrengung zur Sprache gebrachte lebendige Erinnerung.
Das Wunder der Dichtung ist bei Friederike Mayröcker eine extreme Form von Sublimierung, ja Absolutsetzung des Lebens, bei der es der Dichterin selber und auch den Leserinnen und Lesern zu schwindeln beginnt. Es gibt darum wohl immer wieder Momente in den Gedichten, wo der Zauber unterbrochen scheint und eine persönliche Stimme ironisch oder ernüchtert zu sagen versucht: Ich geb's auf! Am 29.5. fällt ein emphatischer Aufschwung abrupt in einen Alltag zurück mit „endlich die 1. Kirschen im Körbchen”, und in einem Epitaph auf sich selbst heißt es ganz und gar ungeschützt: „Ich bin so traurig jetzt und habe Angst vor dem / Verlassen dieser Welt ...” Diese Realität wird nicht mystifiziert, aber sie macht um so deutlicher, dass die Poesie ein Lebenselixier ist: „Wir halten uns an die Schrift weil 1 anderes Geländer haben wir nicht, Thomas Kling.”
Dass es wirklich Schrift ist, macht Friederike Mayröcker seit jeher mit kleinen manieristischen Zeichen deutlich, mit ihrem „sz”, mit ihren Ziffern für den unbestimmten Artikel, aber auch mit ihren Verszeilen, die jetzt oft die Tatsache unterstreichen, dass diese Sprache gedruckt ist. In der dünnen Luft der geglückten Evokation sucht die Dichterin wie aus Furcht vor dem Absturz nach einer Rückbindung. Darum datiert sie ihre Gedichte so penibel genau im Ablauf der Tage, manchmal sogar bis auf die Stunde genau, zum Beispiel am 4. März 2008, „5 Uhr früh”; darum wohl widmet sie die meisten Gedichte lebenden Personen und verankert sie so in der anderen, der nichtpoetischen Wirklichkeit.
Das Niemandsland zwischen Dichter und Gedicht hat Friederike Mayröcker ihren Lesern zur Erkundung freigegeben. Obwohl sie sich dabei stilistisch und thematisch treu geblieben ist, hat sie sich „mit Scardanelli” weit überboten.
Friederike Mayröcker
Scardanelli
Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main 2009. 52 Seiten, 14,80 Euro.
Nichts bleibt, und viel war mir teuer – nichts
Friederike Mayröcker Foto: Isolde Ohlbaum
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Sabine Doering zufolge grenzen im neuen Gedichtband von Friederike Mayröcker Wien und Schwaben unmittelbar aneinander. Das aus den Texten sprechende Vertrauen in die Kraft der Sprache und in die eigene Originalität lässt die Autorin laut Doering mit Gewinn den Dialog mit Hölderlin suchen. Ohne Scheu, wie es hier heißt, und offen noch für die Gefährdung. Dafür, dass es bei der Gefährdung bleibt und nicht zum Desaster kommt, sorgt laut Rezensentin Mayröckers Meisterschaft. So entstehen "Vexierbilder" aus offenen und verdeckten Zitaten und Neuzusammensetzungen, die die Rezensentin durchaus Mühe hat, als solche zu erkennen. Variiert, erklärt sie, werden so Hölderlin'sche Topoi wie Natur und Tod, oft gewinnen sie "geradezu magische Züge" hinzu.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Friederike Mayröcker, die seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr, also seit nunmehr siebzig Jahren Gedichte schreibt, hat sich erstaunliche sprachliche Präzision wie Originalität bewahrt.« Sabine Doering Frankfurter Allgemeine Zeitung 20090508