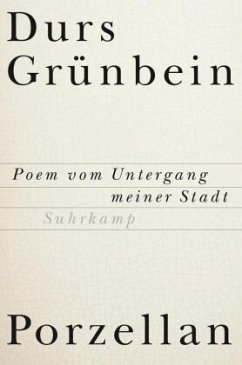»Komm ins Zentrum. Und wo liegt das? Unterm Stolperstein / Dir zu Füßen, tief im Erdreich.« Der hier auffordert, ihm in die Unterwelt, an den Ort der Orte zu folgen, sieht mit dem inneren Auge das glanzvolle und düstere Bild einer, seiner Stadt: er sieht das Augusteische Dresden, den Ursprungsort des weißen Goldes, ein Zentrum des Erfindungsreichtums und Gewerbefleißes, das Elbflorenz der Vedutenmaler und der Flaneure - und er sieht das Dresden der totalen methodischen Zerstörung, den ausgebrannten Skelettbau. Es ist dieses Menetekel, die bis heute nicht gelöschte Flammenschrift auf Dresdens Steinen, die den Dichter nicht ruhen läßt: »Was hätte sein können, wenn ...«
Aber diese 49 Strophen errichten kein urbanes Erinnerungswerk, sind weder Hymnus noch Abgesang auf etwas unwiderruflich Verlorenes. Was wäre auch im Wort zu retten von der einst schnee weißen Galatea, den kurvenreichen Porzellanfiguren, den Muscheln und Delphinen? Grünbeins Poem entfaltet sich in der Rückbesinnung auf die eigene Prägung durch Erinnerungen, Berichte, Relikte und Ahnungen. Ein Widerstreit von Trauer und Sarkasmus, Spott, Liebe und Heimweh bestimmt diese Verse, und doch tritt ihr Dichter als Verfasser zurück, geht in sich, hört zu, als Empfänger, Antenne und Traumstation: Stimmen und Kindheitswellen sind es, die ihn von ferne erreichen, Muttersignale und Herztöne, in denen sich seine Frage nach dem Sinn der Geschichte vervielfacht.
Aber diese 49 Strophen errichten kein urbanes Erinnerungswerk, sind weder Hymnus noch Abgesang auf etwas unwiderruflich Verlorenes. Was wäre auch im Wort zu retten von der einst schnee weißen Galatea, den kurvenreichen Porzellanfiguren, den Muscheln und Delphinen? Grünbeins Poem entfaltet sich in der Rückbesinnung auf die eigene Prägung durch Erinnerungen, Berichte, Relikte und Ahnungen. Ein Widerstreit von Trauer und Sarkasmus, Spott, Liebe und Heimweh bestimmt diese Verse, und doch tritt ihr Dichter als Verfasser zurück, geht in sich, hört zu, als Empfänger, Antenne und Traumstation: Stimmen und Kindheitswellen sind es, die ihn von ferne erreichen, Muttersignale und Herztöne, in denen sich seine Frage nach dem Sinn der Geschichte vervielfacht.

Poetisches Gedächtnis: Durs Grünbeins Dresdner Elegien
Als "Komplizen der Vergänglichkeit" hat sich der "Silbenschmied" Dürs Grünbein einmal bezeichnet. Dazu paßt, daß er sich noch immer emphatisch als Dresdner versteht, obwohl er schon seit 1985 in Berlin lebt. In "Porzellan" erscheint "die ruinierte Stadt" als Chiffre eines poetischen Ingeniums, das nicht vergessen kann und will, was doch unwiederbringlich verloren und nie wiedergutzumachen ist. Diese Bindung ans Vergangene zeigt sich in Form und Gehalt des Erinnerns zugleich. In der Tradition der "Tableaux Parisiens" Charles Baudelaires versammelt der Band neunundvierzig Dresdner Bilder in je zehn unregelmäßig gereimten trochäischen Sechshebern, in denen sich Altes und Neues traumhaft überlagern. "Diese heiklen Formen. Worum geht es hier? - Einer lauscht, / Was die Töchter Mnemosynes ihm diktieren. / Und er tauscht die Zeiten, Räume, Maße, tauscht und tauscht." Für "Nimmerwiederkehr" aber weiß der Dichter nur ein anderes Wort: "heute".
Diese Elegien sind aber weder sentimentale Klagen um den Zustand der einst schönheitstrunkenen Stadt noch gar empörte Anklagen gegen ihre Zerstörung. "Nein, Erinnerung, der Vorrat an Legenden / Ist längst aufgebraucht, und jede Heimkehr wird bestraft." Das lyrische Ich erscheint in verschiedenen Haltungen distanzierter und desillusionierter Beobachtung und Untersuchung. Der Dichter ist wechselweise Flaneur, Chronist, Archäologe, Geograph oder Historiker, seine Verfahren sind Sondierung, Beschreibung, Abtragung von Schichten und Analyse der Quellen und Sachreste. Die Zerstörung Dresdens durch britische Bomber ist den Gedichten eingeschrieben, aber das Datum ist nicht unhintergehbar. Schon vorher wurde in Dresden viel Porzellan zerschlagen und Kristall. "Unschuld, sagt ihr? Lag die Stadt nicht längst geschändet?" Doch noch immer verursacht die Erinnerung Schmerzen: "Ja, es tut noch weh."
Und dennoch entziffert der poetische Cicerone in der ruinierten Gestalt Dresdens und des Elbtals immer wieder die Merkmale der Schönheit und der unerschütterlichen Haltung. So erinnert der Blick auf die Elbe noch immer an Hogarths Ideal der schönen Form, und die zerstörte Frauenkirche kann zum Emblem einer eigentümlichen Würde und Standhaftigkeit werden.
"Lange ist sie so, gebrochnen Rückgrats stehengeblieben." Das sind Bilder Dresdens, die man traumvertraut nur mit geschlossenen Augen sehen kann und die sich dem touristischen Blick nicht erschließen. "Das soll Dresden sein, Venedigs Schwester, Elbflorenz? / Dies Provinznest, in Beton ergraut, sowjetisch trist?" Der Genius loci Dresdens ist ein Restaurator jenseits des Wiederaufbaus von Gebäuden. "Nicht dort draußen spielt sie, die Musik - im Schädelinnern. / Hier, mémoire involontaire, hier geht sie aus und ein." Solche Erinnerung geht mehr noch als die Prousts über Zeiten und Räume hinweg und begreift auch die Städte in das Gedächtnis des Leidens ein, die das Schicksal Dresdens auf die eine oder andere Weise teilen mußten: Troja, Pompeji, Lissabon, Coventry, Guernica oder Warschau.
Dresden aber ist die Stadt, in der lauter Kurfürsten wohnen, die man um den Thron gebracht hat. Was ihnen bleibt, ist Spielraum für eine Phantasie, der die Zeitläufte nichts anhaben können. So ist sie auch der Ort für einen Lyriker, der wohl weiß, daß mit seiner Kunst kein gesellschaftlicher Lorbeer mehr zu erringen ist. Das imaginative Dresden Durs Grünbeins wird so zum Reflexionsmedium eines produktiven Aushaltens und Verwindens, eines unheroischen poetischen Widerstands gegen die zerstörerische Macht der Zeit und des blinden Interesses. "Von wegen Tragik, pah! Wo, wenn nicht hier, war man / Der Hans-im-Glück, dem Zeit nichts nehmen kann?" Die Gedichte bringen in ihrem Ineinander traditioneller Form und heutigen Ausdrucks das Haben zur Anschauung, das im Verlorenhaben steckt, und so sind sie auf höchst kunstvolle Weise tröstlich, nicht nur für Dresdner.
Durs Grünbein: "Porzellan". Poem vom Untergang meiner Stadt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005. 72 S., geb., 14,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Durs Grünbein kittet Dresdner Porzellan zusammen
Eine Stadt wurde vernichtet. Mehr als sechzig Jahre danach wird dem Ereignis ein Zyklus von Gedichten gewidmet: „Stell dir vor”, heißt es darin, „es hat / Eine Opernpause nur gedauert, Zeit zum Zigarettenholen, / Und auf Straßen, Todesfallen, brodelte der Teer. / Eben Frost noch, blau am Fahrradlenker klebt die Hand.” Dresden heißt die Stadt, und jeder weiß es. Ihr Untergang im Februar 1945, der Tod von mindestens mehreren zehntausend Zivilisten, der Schrecken - das alles ist dokumentiert und bekannt und bildet, spätestens seitdem der Schriftsteller W. G. Sebald im Herbst 1997 eine große Sprachlosigkeit der Literatur angesichts des Luftkriegs bemerkte, einen beliebten Topos im öffentlichen Nachdenken über den Zustand der aktuellen Dichtkunst: und zwar vor allem im Reden über das Schweigen. Dabei ist es keineswegs erwiesen, dass die Literatur die Pflicht habe, ein getreues und vollständiges Bild der ihr vorausgehenden Wirklichkeit zu zeichnen.
Vom Untergang Dresdens spricht nun auch Durs Grünbein. „Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt”, heißt der Band. Das Possessivpronomen im Titel überrascht. Denn in der Regel vermeidet es dieser im Jahr 1962 an ebenjenem Ort geborene Dichter, das lyrische und erst recht das eigene Ich in seinen Versen auftreten zu lassen. Das Possessivpronomen signalisiert nun nicht nur eine Betroffenheit, sondern auch eine Inbesitznahme: Das Leid, die Toten, die Vergangenheit, das alles soll jetzt auch zu ihm, dem „Spätgeborenen”, gehören. Schon hier, beim Titel, stellt sich der Verdacht ein, es gehe in diesem Werk nicht ganz redlich zu. Das Unbehagen wächst, wenn man erfährt, wie diese Gedichte zustande gekommen sein sollen. Seit über zehn Jahren, so lautet die zum Gedichtzyklus gelieferte Legende, und stets im Februar, habe Durs Grünbein an diesen Versen gearbeitet. Ein poetischer Totenkult? Ein geheimnisvolles Ritual, ein Wirken dunkler Kräfte, die man nur bei blassem Winterlicht wahrnehmen kann?
In den vergangenen Jahren hat Durs Grünbein einen leicht erkennbaren Stil entwickelt: den antikisierenden Vers, den er benutzt, um eine Vergangenheit lebendig werden zu lassen, in Szenen, Stimmen, kleinen Allegorien. Das klingt jetzt so: „Klar die Frostluft: unterm Flügel, Augenweide, / Lud der Fluß, ein schlankes S, die Bomberstaffel ein. / Nachts der Stadt blieb keine Zeit, sich anzukleiden. / Besenhexe kocht, Metall, Asphalt und Stein.” Auf diese Weise geht es fort und fort, und Vers wird mit Vers verknüpft, so, als wäre hier eine empfindsames Nähmaschinchen am Werk, das, nicht streng, aber immer hübsch jambisch, ein Stückchen ebenso vergangener wie poetisierter Erlebniswelt nach dem anderen zusammenfügt. Wo aber ist der Gewinn, der sich mit dieser Dichtkunst einstellt? Was fügt die lyrische Form einem Bericht hinzu? Oder stehen hier nur deshalb Verse, bietet hier einer seine beträchtlichen dichterischen Fähigkeiten und historischen Kenntnisse nur deshalb auf, um bei einem mit Lyrik wenig vertrauten, aber kulturbeflissenen Publikum mächtig Eindruck zu machen?
Schon dieses Misstrauen ist fatal. Und es sieht sich schnell bestätigt: in der Leidenschaft des Dichters für das grelle, allzu eindringliche, aufdringliche Bild. Die Stadt Dresden, die nicht angekleidete Frau, über die sich die feindliche Luftwaffe wirft, mag dabei gerade noch angehen. „Porzellan, viel Porzellan hat man zerschlagen hier, / Püppchen, Vasen und Geschirr aus weißem Meißner Gold” - das ist peinlicher, ganz abgesehen davon, dass das um des Binnenreimes willen nachgestellte „hier” den Rhythmus zerschlägt. Und „Bombe, Bombe - blankpoliert fiel durch den Schacht / Tonnenweise Schrott in den Mätressenschoß”: Das ist, in seiner Verbindung von Massensterben und Geilheitsmetapher, schon sehr weit jenseits von Poesie, um von Geschmack erst gar nicht anzufangen. Was an solchen Stellen passiert, ist falsches Pathos, Dienst an der Sensation, schlechter Journalismus.
Das Verfahren hat ein Prinzip, das von vornherein angelegt war in Durs Grünbeins Projekt der antikisierenden Verlebendigung. Dieses Prinzip ist - man muss es so deutlich sagen - wesentlich pornographisch. Denn es geht hier um eine radikale Überhöhung des Realistischen um der Wirkung willen, um eine Aufhebung der intellektuellen wie der ästhetischen Distanz, darum, dass hier ein Künstler am Werk ist, der seinen Leser nicht mehr zur ästhetischen Reflexion, sondern zum direkten, unverstellten, fassungslosen Hingucken zwingen will. „Sieh: / Deine Vorfahrn, eng gedrängt, im letzten Hemd.” Und was man sieht, wenn man so blickt, das muss, eben jener Überwältigung wegen, das Erwartbarste, das Klischee schlechthin sein, und so kommt der „Führer” zu dem albernen Attribut „im Mercedes der Messias”, und die „Urgroßmutter” erhält ihre „Kasserolle”.
Diese Art von Pornographie ist der Kunst grundsätzlich nicht fremd. Die Maler des Mittelalters, Matthias Grünewald etwa, haben sich ihrer bedient, als sie die Wunden der Geißelung am Körper Christi darstellten, als seien sie Pestbeulen, und die Finger des am Kreuz hängenden Herrn sich in äußerstem Schmerz verkrampfen ließen. Aber auch diese Kunst muss sich die Frage gefallen lassen, warum sie das tut. Und die Antwort muss lauten, dass der überhöhte Naturalismus nicht der Reflexion dient, sondern im Gegenteil der frommen Wirkung und der Propaganda wegen veranstaltet wird. Das geht auf, solange der Wirkung eine Intensität des Glaubens entspricht, die sich in den Details des Schreckens bestätigt sieht. Beim modernen Dichter aber liegt der Fall anders: Er hofft und kalkuliert, sein Gedicht möge an die Stelle dieser Intensität treten - und deswegen ist es so grell, so bunt, so kunstgewerblich.
Einmal ist Durs Grünbein mit dieser Technik etwas Großartiges gelungen: Im Langgedicht „Vom Schnee”, vor zwei Jahren erschienen, beschrieb er die Entstehung der Philosophie von René Descartes, als dieser zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges im Winterlager bei Neuburg an der Donau lag. Auch dieses Gedicht war szenisch, redete in Stimmen, sprach in belebten Bildern. Aber hier schuf die Poesie etwas, was vorher nicht da war, ließ etwas Neues entstehen, indem sie die Konsequenzen eines radikalen Skeptizismus schon im Augenblick seiner Entstehung sichtbar werden ließ: Wie René Descartes in immer wieder dieselben Zweifel stürzte, wie er in seinem Denken nichts Festes mehr zu greifen bekam, wie er Rettung in der sinnlichen Gewissheit suchte und sich drehte und drehte und nicht mehr weiterkam - das war hier zu lesen und zu hören und bildete am Ende eine poetische Phänomenologie eines von vornherein hoffnungslosen philosophischen Unternehmens.
Aber schon in den „Historien” (1999), und „Neuen Historien” (2002), Durs Grünbeins poetischen Anverwandlungen der Antike, lag der Fall anders. Auch sie sind im Grunde nicht lyrische, sondern epische Wiederbelebungen eines hinreichend erschlossenen Materials. Ihr Reiz mag wohl vor allem darin liegen, dass der Leser das noch heute Menschliche in einer für heutige Zwecke ausgeguckten und herausgeputzten Antike wiedererkennen darf: „Und kommst du endlich, um Jahre gealtert, nach Haus / Steht der Germane in deiner Tür, und es winkt dir / Das strohblonde Kind deiner Frau.” Gleichwie, dieses Verfahren ist harmlos, solange es dabei um Seneca auf Korsika oder Tiberius auf Capri geht, denn diese Stoffe sind derart in die abendländische Überlieferung eingeschmolzen, dass sie eine weitere Kultivierung ohne weiteres vertragen.
Aber schon Wolfgang Borcherts kleines Drama „Draußen vor der Tür” - erzählt es nicht auch von einem sehr unwillkommenen Kriegsheimkehrer? - würde seine Verwandlung in antikisierende Verse, seine Verarbeitung zu Kunstgewerbe nicht ertragen - und zwar weniger, weil die Toten des Zweiten Weltkriegs noch lebendig wären, sondern vor allem, weil der Stoff noch immer politisch ist. Und dann so etwas? „Nein, kein Polterabend war, was Volkes spitze Zungen / Die Kristallnacht nannte, jener Glückstag für die Glaser.” Polterabend? Ach, Quatsch. Eine äußerst preziöse Form der lyrischen Verwurstung stellt dieser Gedichtband dar, an einem denkbar unpassenden Gegenstand. THOMAS STEINFELD
DURS GRÜNBEIN: Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005. 52 Seiten, 14,80 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
" Auf "höchst kunstvolle Weise tröstlich" findet Rezensent Friedmar Apel Durs Grünbeins Gedichtzyklus über den Untergang Dresdens. Das Besondere dieser Texte liegt für ihn im "Ineinander von traditioneller Form und heutigem Ausdruck". Eindruck macht Grünbein aber auch, weil seine neunundvierzig, in "unregelmäßig gereimten trochäischen Sechshebern" verfasste Dresdener Bilder aus Sicht des Rezensenten nicht als Anklage daherkommen. Stattdessen erscheine das "lyrische Ich" in verschiedenen Gestalten: als "Flaneur, Chronist, Archäologe, Geograf oder Historiker", sondiere und trage Erinnerungsschichten ab, analysiere, oder spreche schlicht von Trauer. Mit seiner Art des Erinnerns geht Grünbein für den Rezensenten außerdem mehr noch als Proust "über Zeiten und Räume hinweg". Macht die Erinnerung zum Ort für den Lyriker, in dem er darin Spielräume für eine Fantasie eröffnet, der weder die "zerstörerische Macht der Zeit" noch "blindes Interesse" etwas anhaben könnten.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"