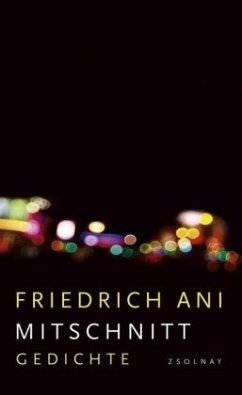Friedrich Ani ist als Krimiautor in Deutschland berühmt geworden, doch nur wenige wissen, dass er schon immer Gedichte schreibt: Liebesgedichte und Verzweiflungsgedichte, Gedichte des Suchens und des Findens. "Mitschnitt" stellt zum ersten Mal Friedrich Anis Lyrik in einer umfangreichen Sammlung vor: Gedichte von einem, der sich nicht nur von Rilke, sondern auch von Bob Dylan beeinflussen lässt, der nicht nur die Bücher, sondern auch die nächtliche Großstadt kennt, für den Gedichte von der Gegenwart und in der Sprache der Gegenwart sprechen müssen.

Friedrich Ani, populär als Autor von Kriminalromanen, überrascht uns mit Gedichten. Die Überraschung ist nicht wirklich so groß, wenn man bedenkt, dass Edgar Allan Poe, der Erfinder der Kriminalgeschichte, auch Lyriker war. Als solcher suchte er das perfekte Gedicht, nicht den perfekten Mord. Ani freilich ist nicht auf Rivalitäten aus. Er schreibt seine Gedichte eher als Entlastungen vom Spannungs- und Unterhaltungsgenre, das er bedient. Er liefert im Sinn des Buchtitels einen "Mitschnitt" des gewöhnlichen persönlichen Lebens. "Dies ist kein Tag, der nicht zu dir gehört", heißt es gleich zu Beginn. Man liest einige berührende Stücke, etwa "Jahr um Jahr" über die wiederkehrende Erinnerung an den Tod des Großvaters. Mehr als die persönlichen Innenwelten aber interessieren Ani epische Stoffe, Figuren und Handlungen. Ihn faszinieren die Außenseiter, der Häftling, die Hure, der ausländerfeindliche Junge. Er schreibt Balladen und Moritaten mit Brecht-Motiven, doch ohne Brechtschen Biss. "Die Brüste sogen / meine Blicke ein, und ich zerfiel / zu Asche, als Jonny ohne Warnung / schoss" - derlei passiert in dem vierzehnseitigen Gedicht "Stadt der somnambulen Hunde". Das ist leider nichts, was den renommierenden Schluss glaubhaft machte: "So lang ich schreibe, Stadt, so / lange brennt der Himmel - von Giesing bis ins gottverlassne Schwabing." Da brennt nämlich gar nichts, jedenfalls nicht im Leser. (Friedrich Ani: "Mitschnitt". Gedichte. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2009. 128 S., geb., 14,90 [Euro].) H.H.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Friedrich Ani erdichtet den Engel, der ihn das Dichten lehrt
Zu entdecken ist ein Poet, für den „Gedichte von der Gegenwart und in der Sprache der Gegenwart sprechen müssen” – so stellt sich ein schöner Gedichtband vor, der seinen Werbetext gleich auf der ersten Seite Lügen straft: „Dort ist dein Tag, der / dich ersehnt. Er fordert, / daß du loderst. Gib ihm / Glut und Sinn. // Da ist der Tag, der / groß für dich vergeht, seit / jeher deiner Schritte / Urbeginn.” Der hier im hohen Tone reimt, weiß, was er tut. Mit großem Erfolg schreibt er seit vielen Jahren eigenwillige Kriminalromane. Er sagt selber, er wolle „das Drama des in seinem Lebenszimmer gefangenen Menschen” darstellen. „Wir sind gefangen. Haben aber / lebenslänglich Ausgang”, heißt es in einem Gedicht mit dem Titel „Erkenntnis”. Auch der Romanautor sitzt in einem Gefängnis, dem der Gattungskonvention, die ihm verbietet, seine Emotionen zu zeigen, aber wie frei darf er sich trotzdem als allwissender Erzähler fühlen!
Das ist in der Lyrik nur scheinbar anders. Wenn es dem Autor gelingt, Emotionen und Gedanken der Sprache anzuvertrauen, entsteht ein Gedicht. Auch der Dichter entsteht erst beim Schreiben; er muss sich also selbst erschaffen. Ein großes dreiteiliges poetologisches Gedicht mit dem Titel „Was heut geschieht” drückt das auf kühne und noble Weise aus, indem es den „Engel Ich” erfindet: „Und wurdest endlich Wort vom / Wort, berührbar, heiter wie / Menschen, die spielend / andere sind. Du leihst dich aus an / viele, sie mimen dich und / du – soufflierst den Göttern. // . . .. du / hast dein Schweigen gut geschmiedet. / Heute erhörst du deinen Engel: dich, den Dichter.”
Ist es da erstaunlich, dass andere Dichter ihn faszinieren, dass er wissen will, wie sie ihren „Engel Ich” erweckt haben? Da begegnen wir Jannis Ritsos, dem griechischen Freiheitshelden, der dieses Jahr hundert Jahre alt geworden wäre. Er preist ihn überschwänglich, denn aus seinem Gefängnis „ . . . brachen die Verse / auf für immer, Gesandte der Gnade auf / dem Weg zu ihren Brüdern, / den Menschen”. Nicht weniger wird Rilke gepriesen, der das „Stimmenspiel . . . mit nichts als bloßen Silben” füllte: da „ragten die / Wörter hin zu lohem Staunen, Urneues / in eins mit Ewigem. Gott schwieg, während er schrieb.” Öfter ist Poesie der Anlass zum Dichten: die Frömmigkeit von Gryphius, die Heimatlosigkeit eines von Bob Dylan besungenen „rolling stone”, Hölderlins inständige Suche nach den Göttern. Seine Worte spuckt er mit verzweifelt-forcierter Respektlosigkeit aus: „So voll von wilden Rossen / hängt meine Birne in den Kochelsee, aus dem / ich stamm, genüchtert nie, statt heilig nur / katholisch.”
Blickt man von diesen Gedichten auf die Romane zurück, bemerkt man wohl, dass dort ein Lyrikbedürfnis wie Grundwasser eindringt. Da hört sich der jugendliche Held („Durch die Nacht, unbeirrt” Hanser 2000) „staunend” ein Gedicht an, von dem wir dann zusammen mit ihm selber erfahren, dass es von Jesse Thoor ist, dem vor den Nazis geflohenen Dichter, der Trost in der Mystik suchte und mit 47 Jahren 1952 starb. Von Thoor stammt auch das Motto zum Roman – und vielleicht jener Engel, der sich erst im Gedicht zum „Engel Ich” mausert: „Ich bin blank und bloß. / Aber mein Engel ist groß”. Und jener Simon in dem frühen Krimi „Killing Giesing”, drauf und dran, sich mit seiner Beretta 92D zu erschießen, hat ein Tagebuch geschrieben, das er seinem Hausmeister hinterlassen will. In seinen Erinnerungen an die Zeit, als er in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche saß, gerät er in poetologische Reflexionen: „Gibt’s einen Himmel, Doktor, oder bloß ein Sanatorium? Egal, ich leg mich überall hin. Im Paradies wachsen uns Beeren in den Mund wie Schläuche, die machen süße Bäuche. So schnell wird man Poet. . . . Einmal, als ich dem Arzt die Zunge herausstreckte, schlug er mit der flachen Hand drauf, und ich biss mir vor Schreck so heftig auf die Zunge, dass sie blutete. Auf der Zunge auf der Zunge sitzt ein kleiner Frosch, der scheißt mir in die Lunge, auf der Zunge auf der Zunge liegt mir was, das sag ich nicht, denn ich halt die Gosch.” Wer das einmal gelesen hat, wird sich erinnern, wenn er in einem großen Gedicht mit dem Titel: „Stadt der somnambulen Hunde”, das sich über vierzehn Seiten erstreckt, nun liest: „Auf der Zunge, auf der / Zunge hockt ein gelber / Frosch, der scheißt mir in / die Lunge . . .” Das Gedicht hat zum Inhalt, was sein Refrain kurz und knapp sagt: „Wer hier überlebt, war / vorher schon / unsterblich”. Die Reime von der Zunge aus Simons Tagebuch sind hier im Gedicht sozusagen umfiktioniert. Nicht mehr Simon, sondern ein anonymes lyrisches Ich greift heftig ein und zerschlägt die primitiv gereimten Verse gerade da, wo keine Reime sind.
Umso klarer tritt hervor, was zwar ebenfalls von jenem Simon geborgt ist, aber aus seiner Prosa stammt: „Ich war leicht / gläubig von Natur aus, und / das hat man ausgelacht. Mir / ist versprochen worden und / versprochen. Und das Warten war / ein Pfad mit rechts und / links Vergissmeinnicht. Und / als ich ankam, fraß die Lüge mich wie einen / Wurm.” Hier lässt sich leichter erkennen, was vom Leser erwartet wird: weder der Autor noch das lyrische Ich wird ihm direkt begegnen. Der Text ist ein „Mitschnitt”, wie der Titel des Buches sagt, und der Leser kann das gedichtete Ich, welches dahintersteht, nicht einfach voraussetzen, sondern muss immer wieder neu seine Bekanntschaft suchen.
Ganz selten einmal begnügt sich der Autor mit seinem eigenen Ich, ohne auf den Engel zu warten – und reizt den Leser, mit dem Rotstift einzugreifen. „Kleines Buch” wäre so vielleicht ein schöneres Liebesgedicht geworden, wenn der Anfang und der Schluss fehlen würden, wo es am Anfang heißt:„Ich schrieb ein kleines Buch / in der Hardenbergstraße / für die Frau, die ich liebe” und am Schluss: „ . . . in der Hardenbergstraße / für die Frau, die ich / liebe stadtnah / und / stadtfern.”
In seiner ungeschriebenen Poetik hat das Wort, das sprachliche Klischee ein Gewicht, das anerkannt werden muss, ehe man die Sprache als Material bearbeitet. Auch im Krimi ironisiert Friedrich Ani nicht die Klischees der Gattung, sondern nutzt sie in der Überzeugung, dass das Klischee übermittelt, was darin „aufgehoben” ist. Das rechtfertigt jene poetischen Vokabeln, die in der Sprache der Gegenwart nirgends mehr vorkommen, ja geradezu verpönt sind. Wie Fremdwörter in neuer Umgebung sind sie nicht mehr, was sie einmal waren, sondern bitten den Leser um ein neues Verständnis. In dem Gedicht „Rilke lesen” und öfter taucht zum Beispiel das preziöse Adjektiv „loh” auf, das uns vielleicht noch aus dem Struwwelpeter im Ohr ist, wo Paulinchen „lichterloh” verbrennt. Verwandt damit ist das seltene „lodern”, das uns schon in „Kein Tag” begegnet ist. Die letzte Strophe des Gedichts „Mein altes Schauen” kulminiert in diesem Wort: „So nahm mein altes / Schauen mich zurück und / schickt seither mein Lodern los, von / Süd nach Nord, von Ost nach West.”
Poesie hat sich immer zuerst durch ihre Form als solche ausgewiesen. Auch der Simon des Krimis, voller Selbstironie, findet sich poetisch, weil er reimt. Die Form war ein paar Jahrhunderte lang Brücke und Krücke des Sinns, und der größte Vorzug des freien Verses schien noch bei Brecht und weit über ihn hinaus ein Rhythmus, der die Wahrheit evident machen soll. Aber ist nicht jede poetische Form heute Kunstgewerbe? Der Dichter Harald Hartung hat diesen Zweifel geäußert, als er bemerkte: „Der Vers ist offenbar doch ein archaisches Medium.” Er hat darum mit einem neuen Verstyp experimentiert, der auch noch seine eigene Form bescheiden zurücknimmt: es sind radikal silbenzählende Verse. Man kann diese Form nicht spontan hören, ja nicht einmal auf dem Papier sehen wie die sogenannte konkrete Poesie. Harald Hartung sagt: „Je mechanischer, willkürlicher und rigider diese Regel, um so größer die Hoffnung des Autors darauf, dass durch sie der poetische Geist sich freisetzt.”
Friedrich Ani praktiziert die radikale Silbenzählung in vielen der hier veröffentlichten Gedichte. In sehr einfacher Form findet sie sich in den sieben Strophen des oben zitierten Gedichts „Kein Tag” mit Versen von je 5, 6, 6 und 3 Silben; oft umfasst sie größere Strophen wie in „Rilke lesen” und in dem poetologischen „Was heut geschieht”. Die radikale Silbenzählung neutralisiert gewiss den „archaischen” Anspruch der Verse: der Dichter verneint mit dieser Form das Idyllische auch in der Poesie, und für den Leser ist sie wie die durchsichtige, sorgfältig gewählte Verpackung eines Geschenks. HANS-HERBERT RÄKEL
FRIEDRICH ANI: Mitschnitt. Gedichte. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2009. 128 Seiten, 14,90 Euro.
Der hier im hohen Tone reimt, weiß, was er tut: Der Krimiautor ist Lyriker
„So nahm mein altes / Schauen mich zurück und / schickt seither mein Lodern los”: Friedrich Ani. Foto: Stefan M. Prager/imago
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Eingenommen ist Rezensent Hans-Herbert Räkel von Friedrich Anis Gedichtband "Mitschnitte". Er kennt und schätzt ihn als Autor eigenwilliger, erfolgreicher Kriminalromane. Dass Ani nun auch als Lyriker und Poet hervortritt, verwundert Räkel nicht, schließlich hat er schon in einigen der Krimis Anis Lyrikbedürfnis verspürt. Die Gedichte des Bandes "Mitschnitte", aus denen er viel zitiert, sind nach Räkel zumeist in einem hohen Ton gehalten. Er attestiert Ani, genau zu wissen, was er tut, etwa wenn dieser poetische Vokabel verwendet, die heute geradezu verpönt erscheinen. Überhaupt stellt er einige poetologische Überlegungen an, die zum Beispiel die Form der Poesie betreffen. Bei Ani findet Räkel die "radikale Silbenzählung" praktiziert, welche den "archaischen" Anspruch der Verse neutralisiere: "der Dichter verneint mit dieser Form das Idyllische auch in der Poesie", resümiert er, "und für den Leser ist sie wie die durchsichtige, sorgfältig gewählte Verpackung eines Geschenks."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH