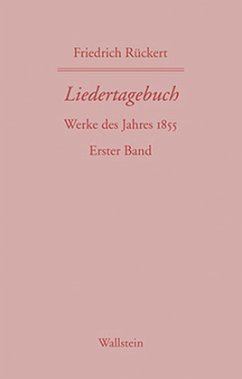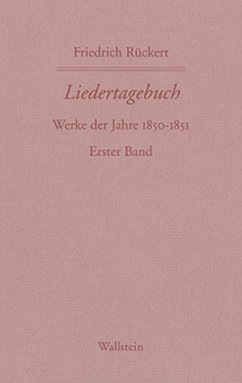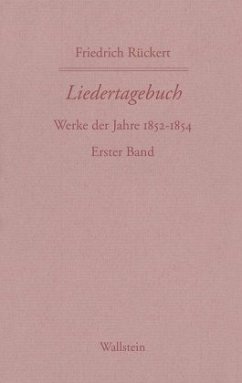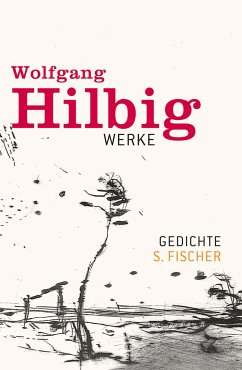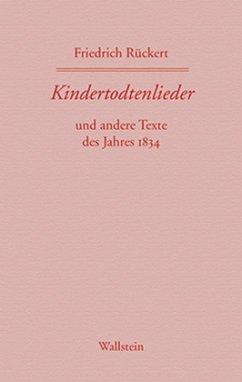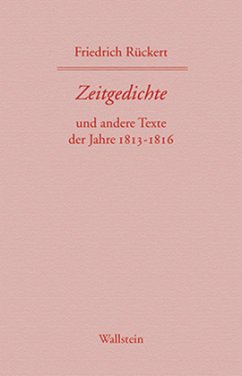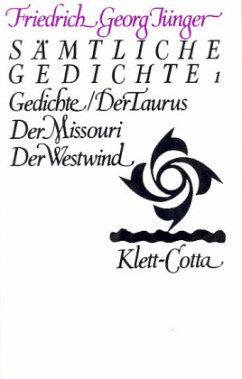ist das Wort "Liedertagebuch", das in einem einzigen der zehntausend Gedichte vorkommt.
Das sind, aufs Ganze gerechnet, nicht eben starke Gründe, und ob Rückert wirklich wollte, daß seine losen Blätter ein Loseblatt-Werk seien, wird wohl nie mit Sicherheit zu entscheiden sein. Dennoch ist das Unternehmen respektabel, die chronologische Anordnung noch die beste unter allen denkbaren Alternativen, die Texte bisher unbekannt und die Edition insgesamt philologisch sorgfältig gemacht und gut kommentiert.
Der erste Band des "Liedertagebuchs", der 420 Gedichte aus den Jahren 1846 und 1847 enthält, läßt den Tagebuchcharakter noch einigermaßen plausibel erscheinen, denn die Gedichte wurden vom Autor selbst datiert - und Rückert schrieb, abgesehen von zwei jeweils mehrmonatigen Lücken, Tag für Tag mehrere davon. Die Folgebände werden, da die Hundert-Fächer-Ordnung von früheren Nachlaßverwaltern durcheinandergebracht wurde, es hauptsächlich mit undatierten, von den Herausgebern erst chronologisch anzuordnenden Texten zu tun haben, die das Tagebuchkonzept doch ein wenig in Frage stellen. Am Ende soll das Liedertagebuch acht Bände umfassen. Nimmt man den jetzt erschienenen Band als Norm, so ergibt die Hochrechnung allerdings, daß für zehntausend Gedichte 25 Bände erforderlich sein werden. Rechnet man ab, daß im vorliegenden Band noch eine kleine Abteilung "Briefe" zu finden ist, die es nicht in jedem Lieder-Band geben wird, bleiben überschlagsmäßig immer noch zwanzig Bände übrig. Die Gesamtplanung der Ausgabe, von der bisher drei Bände (aus verschiedenen Lebensabschnitten und ohne Bandzählung) erschienen sind, scheint noch ziemlich nebulös zu sein. Der Verlag spricht von etwa vierzig Bänden, die zu erwarten seien, im Verlauf von wahrscheinlich nicht wenigen Jahren. Aber vielleicht werden es auch sechzig, wenn die Sponsoren mitmachen, deren eindrucksvolle Tafel die letzten Seiten der geschmackvoll ausgestatteten Bände ziert.
Im Jahr 1846 ist Rückert Professor für Orientalistik in Berlin und hält vor drei Hörern ein Kolleg über die ältesten arabischen Volkslieder. Er ist berühmt, will aber von der Welt nichts wissen, meidet insbesondere den König von Preußen, der ihn ehrenhaft berufen hatte und seine Abendgeselligkeiten gern mit ihm geschmückt hätte. Kränklich und bedrückt, erbittet der Gefeierte Urlaub, erhält ihn und verbringt den Winter 1846/47 in Neusäß bei Coburg, wo die meisten Gedichte des Bandes entstehen. Eine Art Altersmelancholie hat ihn erfaßt. Die von ihr ausgehende Handlungshemmung erfaßt aber nur sein äußeres, nicht sein inneres Leben; er zieht sich aus der Gesellschaft fast völlig zurück, schreibt aber Gedicht um Gedicht. Freilich merkt man dieser Lyrik an, daß ihm das Publikum völlig gleichgültig geworden ist. Er dichtet vor sich hin, wo er geht und steht, zur eigenen Befriedigung, und genießt die Freiheit von Qualitätsansprüchen. Er dichtet viel Holpriges, Banales, unrein oder gewaltsam Gereimtes, voll von unreifen Halb-Ideen und unausgegorenen Reflexiönchen, freilich dazwischen auch Stücke mit strengstem, wenn auch gequältem Formanspruch:
"Du bist die seufzendste der Kreaturen, / Die je geseufzt in Lebens Todesreichen. / Die Morgen- und die Abendsegen fuhren / Zum Himmel als Erlösungsfragezeichen / In Seufzerform; Du seufzest, wenn an Huren / Du denkst, und seufzest, wenn du denkst an Leichen. / Die Atemzüge gehn auf Seufzerspuren, / Und auch die Winde seufzen, die dir streichen."
Rückert muß sehr einsam gewesen sein. Die Gedichte spiegeln so gut wie nie die Gesellschaft. Die meisten handeln der Jahreszeit folgend von Blumen, Vögeln oder Schnee. Des Sohnes Agrikulturstudien spiegeln sich in einigen Gedichten über Chemie, dazu kommt gelegentlich biedermeierlich Humoristisches über Berliner contra Neusäßer Öfen und über des Pfarrers Metzelsupp. Politisches ist ganz selten (ein Gedicht gegen die dänischen Ansprüche auf Schleswig-Holstein), Religiöses gibt es fast gar nicht, nicht einmal an Weihnachten. Rückert kam mit Festen nicht zurecht: "Auch wie andre Lebensgäste / Feiert' ich wohl meine Feste, / Aber selten auf den Tag, / Wo eins anberaumet lag. // Oft wie ungeduld'ge Gäste / Kam ich vor dem Fest zum Feste, / Oder kam zum Festnachtrag, / Niemals auf den rechten Tag" (Heiligabend 1846).
Ob die Sachen gut sind oder schlecht, ist umstritten seit anderthalb Jahrhunderten. Ab und zu ein Gulden in der Sahara, urteilte Peter von Matt über einen früheren Band. Die Herausgeber Rudolf Kreutner und Hans Wollschläger sind vom Gegenteil überzeugt, aber sie sprechen natürlich auch pro domo, wenn sie vorschlagen, das Liedertagebuch "als das größte geschlossene Poesiewerk des neunzehnten Jahrhunderts" und als "ein Alterswerk exemplarischer Art" zu erkennen. Die ersten Stippvisiten im Lande dieser Lyrik wirken befremdend, ein trivialer Reimeschmied scheint am Werk, der ohne Selbstkontrolle jeden Satz, der ihm durch den Kopf geht, zu Papier bringt. Er reimte schneller, als er denken konnte. Liest man länger, teilt sich jedoch noch etwas anderes, Tieferes mit - jene Verschlossenheit des Alternden, die zugleich Bedürfnislosigkeit und Lässigkeit ist, eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Publikum, die etwas Souveränes hat, ein halb schlampiges, halb überlegenes Ist-doch-egal, eine Freiheit von jeglicher Ruhmsucht, ein Abschied von der Welt, der noch einmal das "Alles ist eitel" des Predigers Salomo orchestriert - und einem den brummigen Schwarzseher doch irgendwie sympathisch macht.
HERMANN KURZKE
Friedrich Rückert: "Liedertagebuch". Werke der Jahre 1846-1847. Erster Band. Herausgegeben von Rudolf Kreutner und Hans Wollschläger. Wallstein Verlag, Göttingen 2001. 443 S., geb., 59,-
.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.03.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.03.2002