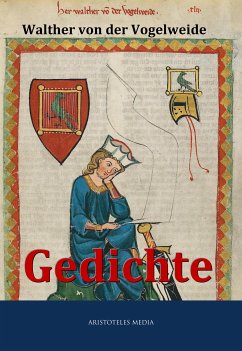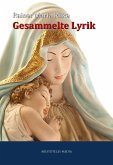Der bedeutendste deutschsprachige Lyriker des Mittelalters, Walther von der Vogelweide, ist neben der Neidharts und Frauenlobs die umfangreichste des deutschen Mittelalters. Schon im 13. Jahrhundert war er Vorbild, später zählt er zu den zwölf alten Meistern der Meistersinger. Die erste moderne Ausgabe seiner Werke stammt von Karl Lachmann des Jahres 1827.

Er verfasste seine Poesie vor achthundert Jahren, doch nie ist er vergessen worden. Nun gibt es eine neue Prosaübersetzung der mittelhochdeutschen Gedichte des Walther von der Vogelweide, ausgewählt und kommentiert von Horst Brunner. Was sie leistet, schätzt hier der 1971 geborene Lyriker Jan Wagner ein.
Von Jan Wagner
Vielleicht muss man sich die Szene im Winter vorstellen, um das Existentielle der Situation zu verinnerlichen: Eine früh hereingebrochene Nacht, sämtliche Fenster einer Burg oder eines Klosters mit schweren Teppichen verhängt, die Hof- oder Ordensgemeinschaft um die offene Feuerstelle versammelt, um sich die dunkle Zeit so angenehm und gesellig wie nur möglich zu gestalten - als ein Fremder gemeldet wird, ein Minnesänger, der um Einlass bittet, um etwas Wärme und Verköstigung als Entgelt für seine Lieder, die der Gesellschaft zu Gehör zu bringen er anbietet. Man muss keinen Schneesturm hinzuimaginieren, kein in der Ferne heulendes Rudel von Wölfen, die es um das Jahr 1200 selbstverständlich noch in ganz Europa gab, um sich auszumalen, was eine Zurückweisung durch den Burgherrn oder Abt bedeutet hätte. Und doch gab es fahrende Sänger, die dieses Risiko auf sich nahmen, mittelalterliche Freischaffende mit der steten Drohung eines fest verschlossenen Tors vor Augen - wie Walther von der Vogelweide.
Er ist der Berühmteste von ihnen, dessen Reisen, schenkt man seinen Texten Glauben, ihn an Elbe und Rhein führten, von der Seine bis zu Mur und Trave, vom Po bis ganz nach Ungarn. Vorstellbar also, dass die Herrschaften seinen Namen schon einmal gehört hatten und deshalb empfänglicher für sein Bitten waren, sicher zudem, dass Unterhaltung und musikalischer Vortrag immer gern gesehen waren, nicht nur während der kalten Monate. Trotzdem ist es verblüffend, mit welchem Selbstbewusstsein Walther sich in Szene zu setzen wusste.
"Ir sult sprechen willekomen", so stolz und fordernd hebt eines seiner berühmtesten Stücke an: "Heißt mich willkommen, / ich bin der, der euch Neuigkeiten bringt. / Alles, was ihr bisher gehört habt, / das ist gar nichts - fragt jetzt mich! / Ich will freilich bezahlt werden. / Bekomme ich eine anständige Belohnung, / so berichte ich euch ganz gewiss etwas, was euch guttut." Welcher Dichter würde heute, trotz ungleich besserer Lebensbedingungen und einer ganzen Reihe von Aufenthaltsstipendien, derart auftrumpfend die Bühne betreten, fragt man sich unwillkürlich - und ahnt doch, dass sich die zur Schau getragene Selbstgewissheit auch der Notwendigkeit verdankt, zu überreden, zu überrumpeln, sich lange vor der Entstehung eines Marktes für Literatur anzupreisen und so im Wettstreit mit anderen Dichtern um die warmen Schlafplätze und die gutgefüllten Töpfe und Karaffen zu bestehen.
Ob Walther aus freien Stücken oder aus blanker Not, aufgrund eines jähen sozialen Abstiegs etwa, als wandernder Dichter durch die mittelalterliche Welt zog, ist nicht sicher, doch weiß man, dass jenes Wörtchen "willkommen" in einem anderen Gedicht verhaltener klingt. Er dürfe, klagt Walther da, nie "willkommen" sagen und einzutreten bitten, weil er kein Heim sein Eigen nenne, immer sei er nur Gast und müsse sich verneigen; als Hausherr müsse man keine Scham empfinden, ewig auf der Suche nach einer Herberge hingegen schon, und er wünschte nur, auch einmal begrüßen, auch einmal den Dank entgegennehmen zu dürfen. Der reisende Berufsdichter sei, so der stolze Walther, im Grunde "in butzen wîs" - "wie ein Hausgespenst".
Ähnlich schwer zu fassen wie ein solches Hausgespenst ist Walther selbst: Ein einziges Dokument, das ihn zu Lebzeiten namentlich erwähnt, ist erhalten und lässt uns den Dichter im Umkreis des Passauer Bischofs Wolfger von Erla erblicken, der im Winter der Jahre 1203 und 1204 eine längere Reise unternahm. Eine Auflistung der Reisekosten vermerkt, dass man einem "Walthero cantori de Vogelweide" hundertfünfzig Silberpfennige zum Kauf eines Pelzmantels ausgehändigt habe. Die spärliche Faktenlage lässt Raum für allerlei Spekulationen, die beim Geburtsort beginnen - neben Bozen, dem Grödnertal, der Schweiz und Franken wurde auch Frankfurt am Main vorgeschlagen - und beim Namen selbst noch lange nicht enden, der vermutlich kein Herkunftsname, erst recht nicht adliger Natur, sondern ein frei gewählter nom de plume war, der auf die gesanglichen Qualitäten des Künstlers verwies. Darauf deuten auch die Worte hin, die in Walthers Grabstein gemeißelt wurden - er sei, heißt es da, "im Leben der Vögel Weide gewesen, eine Blüte der Beredsamkeit, Mund der Pallas". Einig ist man sich darüber, dass Walther seine letzte Ruhestätte in Würzburg gefunden haben muss, im Lusamgärtchen des dortigen Münsters.
Alles andere, was man über Walthers Leben weiß oder zu wissen glaubt, beruht auf Andeutungen in seinen Liedern - allerdings weniger in jenen der Minne gewidmeten. Das liegt daran, dass diese Liebesdichtung weitgehend unpersönlich war, was zunächst paradox anmutet - jedenfalls dann, wenn man, wie heute meist üblich, Gedichte und gerade Liebesgedichte als Ausdruck ureigensten Empfindens auffasst. In der Hohen Minne aber ging es nie um eine tatsächliche Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, die beide, auch als Kunstfiguren, stets Teil der höfischen Gesellschaft zu sein hatten. Ihr Zweck war vielmehr die kunstvolle Variation zweier festgelegter poetischer Rollen: der des ewig preisenden Verehrers, der im Zustand der sehnsuchtsvollen Spannung zu verharren hatte, und der in ideale Sphären entrückten und schon deshalb praktisch unberührbaren Dame.
Nicht Erfüllung, sondern Treue und Stetigkeit lauten die Grundbegriffe dieser strengen Kunstform, die Peter Rühmkorf einmal, etwas gehässig, als "gehobene Schlagerkultur mit festen Huldigungsrequisiten" bezeichnet hat. Walther, der, wie er selbst einmal bemerkt, am österreichischen Hof im "Singen und Dichten" ("singen unde sagen") geschult worden war, begann sich bald vom allzu rigiden Schema zu lösen - und damit auch von Reinmar, dem Großmeister der Hohen Minne, der in Wien sein Lehrer gewesen war. Nicht nur lehnt Walther die Rolle des unbelohnt Schmachtenden ab und fordert die Verehrte auf, sich doch bitte schön zu entscheiden, und zwar für ihn; er stellt auch der formelhaft gewordenen "frouwe", der meist adligen Herrin, das Wort "wîp" entgegen, "Frau" - denn dies sei doch eines, so Walther, das sie alle kröne, gleich welcher Herkunft. Für Walther verdient die Liebe nur dann so genannt zu werden, wenn sie guttut und nicht schmerzt, denn: "Liebe ist die Freude zweier Herzen."
Mehr noch denn als Neuerer, als Begründer nämlich, trat Walther allerdings mit einer anderen Gattung hervor - mit der Sangspruchdichtung, die sich jenseits aller Stereotypen und Gepflogenheiten dem Alltag öffnete und damit auch der Politik und der Religion, die zudem viel mehr als der Minnesang das eigene Leben und Erleben des Dichters in den Mittelpunkt rückte. Diese von 1198 an neben den Liedern verfassten Gedichte mit ihrem jeweils eigenen "tôn" (also einem sie kennzeichnenden Reimschema, Metrum und einer Gesangsmelodie) machen noch heute Walthers Wanderungen nachvollziehbar - und seine Wandlungen, denn für Walther als fahrenden Dichter war Loyalität zwangsläufig ein dehnbarer Begriff und unmittelbar abhängig von der Zahlungsfähigkeit und der politischen Fortune seines Arbeitgebers.
W. H. Auden hat in seiner großen Elegie auf den Tod von W. B. Yeats eine prägnante Wendung für das Weiterwirken des irischen Dichters nach dem Tode gefunden: "he became his admirers." Ähnliches ließe sich von Walther sagen, der so ganz in der eigenen Dichtung aufging, dank dieser Dichtung schon zu Lebzeiten gerühmt wurde und seither in keiner Epoche Gefahr lief, vergessen zu werden.
Im neunzehnten Jahrhundert begann aber die Vereinnahmung Walthers durch nationalistische Kreise (auch Hoffmann von Fallersleben orientierte sich für sein "Lied der Deutschen" an Walthers "Preislied"), die im Missbrauch durch die "nazideutsche Großraumgermanistik" gipfelte - eine Formulierung, die abermals von Peter Rühmkorf stammt. Der war es auch, der in der Nachachtundsechziger-Zeit (und nachdem Peter Wapnewski mit einer hunderttausendfach verkauften Ausgabe schon 1962 bewiesen hatte, wie populär Walther nach wie vor war) den vielleicht kühnsten Versuch einer lyrischen Frischzellenkur unternahm: mittels einer Nachdichtung, einer "Annäherung bis auf Tuchfühlung" vielmehr, die Rühmkorf in dem bescheiden betitelten Buch "Walther von der Vogelweide, Klopstock und ich" präsentierte und kommentierte. Dies, so Rühmkorf in einem Brief an den Lektor, sei "der jetzt endgültig aus dem Jenseits in die Gegenwart übersetzte Walther", den er "aus dem reaktionären Traditionsbett gelöst" und "kühn an die eigene Brust gerissen" habe, "neu beatmet - wollen sehen, inwieweit das der weiteren Überlieferung guttut".
Nun lädt eine neue, von dem Würzburger Kenner Horst Brunner herausgegebene, auf Grundlage der Handschriften edierte Auswahl von achtzig Strophen dazu ein, die wahren Herrlichkeiten in diesem alten und vermeintlich längst so vertrauten Werk wiederzuentdecken. Brunner bietet nicht nur Lesarten und Varianten an, sondern auch einen Kommentarteil, der an Informationen zu Zeit und Werk alles bereitstellt, was wünschenswert ist, sich aber nie in wissenschaftlichen Spitzfindigkeiten oder für den Laien unerquicklichen Fachdebatten verliert.
Brunners Sorgfalt rahmt ein, worauf es ankommt, und hebt es ins Licht: Die selbst nach achthundert Jahren originellen Wendungen ("Bevor ich noch lange so lebte, / würde ich lieber den Krebs roh essen"), all die Gedichte Walthers, die man zitieren möchte - das sogenannte "Traumlied" etwa, in dem es tatsächlich zu einer erfüllten Liebesbeziehung zu kommen scheint, bevor sich das Stelldichein überraschend als bloßer Traum entpuppt. Am Schluss setzt Walther seine Pointe, indem er sich an die anwesenden Frauen im Publikum wendet: "Meine Damen, seid so freundlich, / schiebt Eure Hüte zurück! / Ach, sähe ich sie doch mit dem Kranz!"
Und wie reizend sind jene Gedichte, die man, tandaradei, schon in der Schule als "Mädchenlieder" gelesen haben mag (Brunner vermeidet den Begriff und ordnet die Stücke in das Kapitel "Winter- und Sommerlieder, scherzhafte und erotische Lieder" ein) und die doch nichts von ihrer Frische eingebüßt haben, wo unter der Linde noch immer "unser beider Lager" ist, wo nur "geknickte Blumen und niedergedrücktes Gras" die Leidenschaft wachrufen, dafür aber umso eindrücklicher, wo also Diskretion und Erotik eine staunenswerte Liason eingehen: "Küsste er mich? unzählige Male, / tandaradei, / seht nur, wie rot mein Mund ist!" Das ist hinreißend, selbst in Prosa - womit ein grundsätzliches Problem berührt ist.
Den meisten Heutigen ist das Mittelhochdeutsche nahezu so fremd wie das Französische oder das Englische. Mit anderen Worten: Eine Übersetzung tut not, wenn der Leser Walthers Dichtkunst mit allen Feinheiten kennenlernen soll, und wie bei Übersetzungen aus dem Französischen oder dem Englischen kann man sich trefflich und ausdauernd darüber streiten, was der richtige, was der beste Weg in ein modernes Hochdeutsch ist.
Brunner wählt einen Mittelweg, möchte "sprachlich einigermaßen ansprechend" sein, flicht hier und da, wenn auch eher zufällig, einen Reim ein, versucht gelegentlich, den Rhythmus nachzubilden ("Besinne dich, besinn dich" wird aus "bekêrâ dich, bekêre"), bleibt aber bei einer Prosa, die genau sein will. Was zwangsläufig dazu führt, dass aus knappen und einprägsamen Formulierungen bisweilen etwas bemühte, in jedem Fall eher unlyrische Konstrukte werden, aus den zwei Zeilen "wan ich sîn vil schône enpflag, / daz kumt von grôsser liebe vil!" etwa das eher gewundene "Dass ich mich seiner mit übergroßer Freundlichkeit annahm, / beruht auf meiner übermächtigen Zuneigung." Dies wäre die Frage: Kann es eine Prosagenauigkeit in einer Kunstform geben, deren Wesen nicht zuletzt in ihrer Geformtheit und im Reichtum ihrer Sprache besteht? Könnte also eine zunächst eher untreu erscheinende Nachdichtung, die sich ganz auf die Eigenheiten der Poesie verlässt, letztlich dies sein: genauer?
Es lohnt sich, die Versionen zu vergleichen, die von Brunner, Rühmkorf und Wapnewski und eine vierte, die wie die Rühmkorfsche die Form zu wahren sucht. Sie stammt von Thomas Kling, der einige Gedichte Walthers für seine Anthologie "Sprachspeicher" übertrug. Walthers Strophe im sogenannten "Unmutston", der sich alle vier Übersetzer gewidmet haben, ist abermals eine Kollegenschelte und bezieht sich auf Neidhart, der sich, zu Walthers Verdruss, wachsender Beliebtheit erfreute. Um wen genau es sich hingegen bei "Stolle" handelt, ist nicht bekannt.
"Nun will ich aber doch einmal einen scharfen Ton anschlagen! / Wo ich sonst zaghaft bat, da will ich jetzt gebieten", hebt Walther in Wapnewskis Fassung an, die in der zweiten Zeile immerhin sechshebig und jambisch ist und sich mit dem Ausrufezeichen am Ende der ersten trotz allem gewisse interpretatorische Freiheiten nimmt. Noch etwas nüchterner klingt es bei Brunner: "Jetzt will auch ich mir einen schneidenden Ton zulegen. / Dort, wo ich sonst ängstlich gebeten habe, da will ich nun befehlen." Und weiter: "Ich erkenne, dass man die Gabe der Herren und die Freundlichkeit der Frauen / gewaltsam und mit ungehobeltem Benehmen erringen muss." Kling und Rühmkorf, die Dichter, wahren demgegenüber durchgehend das Walthersche Reimschema wie auch den Jambus. Hören wir die ersten vier Zeilen bei ihnen, die beide auf die Reimwörter "nutzen" und "Dank" setzen, aber zu anderen Lösungen finden. Bei Kling hören wir Walther so:.
Jetzt hab ich auch mal lust den scharfen ton zu nutzen:.
wo ich verzagt sonst bat, will ich nun runterputzen.
hab es kapiert, daß man der herren lohn, der frauen dank.
nur mit gewalt und mieser tour erlangt.
Und Rühmkorf baut in Zeile zwei sogar einen weiteren Binnenreim ein:.
Jetzt will ich meine scharfe Klinge auch mal nutzen.
Wo ich sonst Klinken putze, ein paar Federn stutzen.
Ich weiß schon, daß man Herrenlohn und Frauendank.
am ehesten erreicht mit Lärm und Mißgesang.
Man mag über Ausdrücke wie "hab es kapiert", "miese Tour" und "Klinken putzen" uneins sein, muss sich aber fragen, ob nicht der Ton etwas von der Kühnheit und der Frechheit des Originals transportiert, für unsere Ohren transponiert. Das gilt erst recht für die folgenden Zeilen, die noch gröber sind, denn "da sie nun einmal Boshaftes wollen, so werde ich ihnen damit den Hals schon vollstopfen", so Wapnewski. Bei Brunner lesen wir:.
Singe ich meinen höfischen Gesang, beklagen sie sich bei Stolle.
Wahrhaftig, davon schwillt meine Zornesader.
Da sie Grobheit wünschen, stopfe ich ihnen den Hals.
In Österreich erlernte ich das Singen und Dichten,.
dort will ich mich zuerst beschweren.
Rühmkorf sucht die Genauigkeit in Klang und Tonlage:.
Singe ich höfisch, werd ich gleich bei Stolle angeschmiert -.
Paßt auf! für Wutanfälle wird nicht garantiert.
Wer mich bespeien will, dem geh ich an den Kragen.
In Österreich hab ich gelernt zu dichten und den Takt zu schlagen.
Dort will ich mich zunächst beklagen.
Zu guter Letzt Kling, der mit dem Wörtchen "gossen-tour" zweifellos am weitesten geht, sich die größere Freiheit aber mit dem unauffälligen Doppelpunkt nimmt, den er am Ende der dritten Zeile setzt - und so, sicherlich mit voller Absicht, die österreichische Schule des Dichtens und die Effektivität beim Austeilen in einen unmittelbaren Zusammenhang bringt.
sing meinen höfischen gesang ich - klagen sie es Stolle.
paßt auf, wer weiß, ob nicht auch mir die zornesader rolle.
sie wolln die gossen-tour? das läßt sich sicher richten:.
in Österreich lernte ich hofgesang und dichten!
da soll zuerst man meine klagen sichten.
Welcher Übersetzung man auch den Vorzug gibt: Man wird gut daran tun, das Original danebenzulegen und, so möglich, laut zu lesen. Seine Gedichte sind Grund genug, ihn in unserer Welt, die so ganz anders ist als seine, immer wieder willkommen zu heißen.
Walther von der Vogelweide: "Gedichte". Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch.
Hrsg., übersetzt und kommentiert von Horst Brunner. Reclam Verlag, Stuttgart 2012. 315 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main