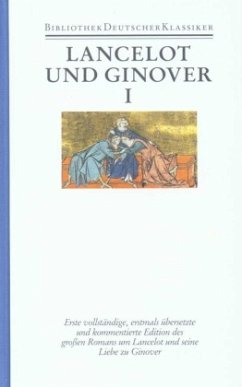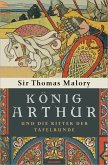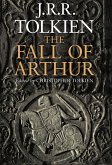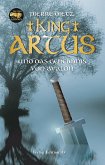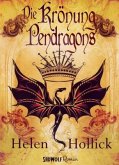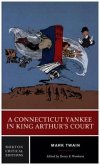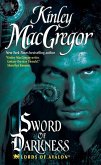Der nach Anspruch, Umfang und Wirkung beispiellose mittelalterliche Romanzyklus von Lancelot und dem Gral ist in seiner mittelhochdeutschen Fassung zugleich auch der erste deutsche Prosaroman. Mit einem bis dahin unerhörten Aufwand an epischer Phantasie führt er die episodische Welt der klassischen Artusromane zu einem enzyklopädischen Ganzen zusammen und interpretiert sie neu. Der Prosalancelot ist ein überaus farbiges Werk von labyrinthischer Stoffülle und thematischer Komplexität, ein faszinierendes Epos von der Macht der höfischen Liebe und vom Glanz und Untergang der mittelalterlichen Ritterwelt, dessen Figurenreichtum und Handlungsvielfalt mit einem bewunderungswürdigen Maß an konstruktiver Energie bewältigt wird. Die beiden ersten Bände des Prosalancelot erzählen von Lancelots Herkunft und Aufnahme in die Tafelrunde und die Geschichte seiner Liebe zu Ginover bis zur Vereinigung der Liebenden im »Land ohne Wiederkehr«. Die Ausgabe des Klassiker Verlags bietet die erste vollständige, erstmals übersetzte und kommentierte Edition.

Lancelot: ein Ereignis der deutschen Gegenwartsliteratur / Von Hans-Herbert Räkel
Wenn es stimmen sollte, daß wir in ein Zeitalter dicker Bücher eingetreten sind, dann setzt dieser Roman "um Lancelot und seine Liebe zu Ginover" Maßstäbe, die auch für weiteste Felder und fernste Buchten der deutschen Gegenwartsliteratur zu groß sein dürften: An die 2400 Seiten umfassen die beiden Bände in der Bibliothek deutscher Klassiker - und sind doch nur der kleinere Teil des auf fünf Bände berechneten Werks. Ein Klassiker, den fast keiner kennt? Gibt es das noch, nach knapp zweihundert Jahren deutscher Philologie?
Während jedenfalls Parsifal und Tristan unter den formenden Händen des Bayreuther Demiurgen zu strahlenden Zeitgenossen des vorigen, des jetzigen und wohl auch des kommenden Jahrhunderts erstanden sind, fand ihr Ritterkollege Lancelot nicht einmal im Schattenreich der Literaturgeschichte eine Zuflucht: Seine kapitale deutsche Inkarnation, der gegen 1250 entstandene Prosa-Lancelot, liegt erst seit 1974 in einer vollständigen Ausgabe vor, und Uwe Rubergs erste bedeutende Studie dazu ist kaum dreißig Jahre alt. "Das Riesenwerk gehört zu den einmaligen Leistungen des dichterischen Mittelalters", schreibt Max Wehrli 1980 in seiner Literaturgeschichte und gestattet sich hier einmal freimütige Superlative, wenn er es als "nobelstes, reifstes Werk ritterlichen Spätgefühls" charakterisiert.
Allerdings hatte nicht erst die Germanistik hier einen blinden Fleck: Auch die deutschen Zeitgenossen, an die sich der Roman wandte, scheinen nach Wehrli "kein Organ" dafür gehabt zu haben, während sein französisches Vorbild, wie der Kommentar das Publikum belehrt, "der bei weitem erfolgreichste mittelalterliche Artusroman, ja der erfolgreichste mittelalterliche Roman überhaupt" wurde. Die Aufnahme des Werks in die Bibliothek Deutscher Klassiker ist darum so etwas wie eine späte Anerkennung, gleichzeitig ein mutiger Eingriff in den gültigen Kanon der deutschen Literatur des Mittelalters und - warum eigentlich nicht? - ein Ereignis der deutschen Gegenwartsliteratur.
Für die Ausblendung des Romans läßt sich allerdings ein einfacher Grund angeben, ein Mangel, für dessen positive Schätzung uns möglicherweise gerade erst ein "Organ" gewachsen ist: Der deutsche Prosa-Lancelot ist im herkömmlichen Sinne kein "Originalwerk, auch keine Bearbeitung mit eigenem konzeptionellen Anspruch wie die Artusromane Hartmanns von Aue und Wolframs von Eschenbach, sondern eine im Prinzip wörtliche, von den Spuren einer komplexen Entstehungsgeschichte gezeichnete Übersetzung". Daß wir deren Autor nicht namentlich kennen, ist also zwar bedauerlich, aber doch nach althergebrachter Vorstellung gar nicht so schlimm - wäre etwa Tieck ein deutscher Autor geworden, wenn er nur Shakespeare übersetzt und nichts selber geschrieben hätte? Das Originalgenie, jedenfalls das deutsche, ist eben unsterblich, auch wenn es nie gelebt hat, und der Epigone ist, vom Übersetzer ganz zu schweigen, schon tot, ehe er geboren wird.
Das französische Monumentalwerk, dem also alle jene an der deutschen Fassung gerühmten Qualitäten eigentlich zugehören, ist allerdings unbegreiflicherweise auch nur anonym überliefert, sogar "der für den fiktionalen Artusroman charakteristische Erzähler ist eliminiert, an seine Stelle tritt die Fiktion der Augen-und Ohrenzeugenschaft und der authentischen Überlieferung - die Aventüren der Artusritter werden nach deren eigenen Berichten von den Schreibern des Hofes aufgezeichnet, und diese (angeblich von Walter Map ins Lateinische übersetzten) Aufzeichnungen bilden die unmittelbare Grundlage für den Roman". Der erzählt sich also selbst, braucht weder Erfinder noch Erzähler, höchstens Kopisten . . . und Übersetzer, welche für die Verbreitung dessen sorgen, was "die Historie" seit eh und je berichtet.
Unter diesen Umständen gerät die dem mittelhochdeutschen Text an die Seite gestellte neuhochdeutsche Übersetzung in eine Art Erfüllungszwang der Entelechie dieses Romans, in den Sog seiner besonderen Literarizität, die darin zu bestehen scheint, daß er nie etwas anderes als Übersetzung und Nacherzählung gewesen sein will. Sie darf nicht nur, sie muß denselben Anspruch erheben und erfüllen, den die Reihe ihrer Vorgänger erhob. Und sie tut es, auf ihre Weise, so daß tatsächlich ein neuer Roman entsteht, nicht aus Versehen, aber doch beinahe ohne Absicht. Das geheime Bild, das der Leser sich vom Übersetzer macht, wird im Laufe der Lektüre immer größer und achtunggebietender. Zwar steht sein Name auf dem Titelblatt, aber wie in einer diesem Werk adäquaten Imitatio-Geste der Unterdrückung ist er nicht bis auf den Buchumschlag vorgedrungen.
Wer sich auch nur schwach an die Schwierigkeit Wolframs oder des Nibelungenliedes erinnert, wird überhaupt gleich rechts, das heißt neuhochdeutsch, beginnen: "Im Grenzland von Gallien und der Bretagne lebten in alter Zeit zwei Könige, die waren Brüder . . ." - und überrascht sein, beim ersten neugierigen Blick nach links ohne jedes Pfingstwunder so gut wie alles zu verstehen: "In der marcken von Galla und von der Mynnren Brytanien warn zwen konig by alten zyten, die waren gebrudere . . ." - und während er noch heimlich zweifelt, ob er wirklich wissen will, daß der Sohn des Königs Ban von Bonewig auf den Namen "Galaad" getauft, aber mit dem Beinamen "Lancelot" gerufen wurde, wird er schon mit hineingenommen in die Erzählung: "Wie er aber den Namen Lancelot bekommen hat, wird dies Buch später berichten, denn jetzt haben wir dazu keine Gelegenheit, weil wir dem geraden Gang der Erzählung folgen müssen."
Das müßte und möchte der Leser nun eigentlich auch, er braucht ja auch nur weiterzulesen - aber es reizt ihn doch, zu erfahren, wie der mittelhochdeutsche Prosaist solche erzähltechnischen Zwänge ausdrückt, und er riskiert einen Blick nach links: . . . volgen der gerechten zal . . . hieß dieses "dem geraden Gang der Erzählung folgen". Das hätte er nun doch nicht gleich verstanden oder bei der ,Zahl' nach geheimnisvollen Konnotationen gesucht; vielleicht hätte er sogar im Zeilenkommentar im zweiten Band nachgeschaut und hierzu nichts, aber zur Technik des ,geraden Gangs der Erzählung' hochinteressante Parallelen nachgewiesen gefunden . . . doch wenn er so weitermacht, wird er nie etwas von der Liebe Lancelots zu Ginover erfahren.
In der Tat macht die oft überraschende syntaktische und lexikalische Nähe, dann wieder die intrigierende Unvereinbarkeit der beiden Idiome die Lektüre zum latenten Vergleich und den Text zu einem prinzipiell in jedem Detail diskordierenden Zwischentext, der seinen Leser beständig verführt, nicht zwischen den Zeilen (da gibt's keine Geheimnisse), sondern zwischen den Seiten zu lesen, immer mit dem Eindruck, er versäume etwas, wenn ein Stück mittelhochdeutscher Text es erlaubt, den Blick nach rechts zu verschmähen oder wenn ihn umgekehrt die Ereignisse plötzlich unbemerkt zwanzig neuhochdeutsche Seiten im Galopp fortgetragen haben. Ja, trotz der dauernden Präsenz des Originals und trotz seiner leichten Lesbarkeit vermag die Übersetzung ihren Leser fortzureißen - aber ohne daß er auch nur einen Augenblick vergißt, eine Übersetzung zu lesen, ohne daß er doch immer die Lust verspürt, sich im Mittelhochdeutschen selber zu bedienen.
Diese Übersetzungssprache biedert sich nämlich nicht unserem Neuhochdeutschen an, benutzt oft sogar jene steifen Versatzstücke aus dem germanistischen Proseminar, wo man mittelhochdeutsch "guot" und "wol!" auf hundert Arten, aber nicht mit "gut" und "wohl" übersetzen durfte: ". . . das ich einen so guten ritter erdötet han" - ". . . da ich einen so trefflichen Ritter getötet habe"; "Wir wenen werlichen das er den frauwen wol helffen sol" - "Wir glauben ganz fest, daß er ihr wirksam helfen wird". Das ist alles sehr bewußt so gemacht: "Die Tatsache, daß es sich um die Übersetzung einer Übersetzung handelt, sollte ebensowenig überspielt werden wie die, daß mittelalterliche Prosa anderen Stilprinzipien folgt als moderne. Die neuhochdeutsche Fassung will nicht ,besser' sein als ihre Vorlage." Wenn sie nicht besser sein will, so ist sie doch auch bestimmt nicht schlechter. Sie erfüllt in bewunderungswürdigem Maße die Forderung, welche der Roman seit seiner Entstehung im Frankreich des frühen dreizehnten Jahrhunderts zu erheben scheint, den erfindenden Autor und seinen allwissenden Erzähler zugunsten des Lesers und einer scheinbar gegebenen Geschichte verschwinden zu lassen. Gerade wo der Übersetzer sich einige Freiheiten herausnimmt, kann er sicher sein, daß sein Leser ihn dabei beobachtet, nicht nach einem letztlich aufgehobenen Originaltext sucht, sondern sein Urteil fällt, ob diese oder jede Wendung der "Geschichte" angemessen sei.
Gelegentlich wird die neuhochdeutsche Übersetzung sogar mittelalterlicher als die Vorlage: ". . . und es schien ihm, daß sie nichts Gutes gegen ihn im Schilde führten" - links liest man nur "und ducht yn das si im ubel wolten thun"; aber indem die Übersetzung so beständig auf sich aufmerksam macht und damit selber dazu beiträgt, den Originaltext und die Autorinstanz zu demontieren, baut sie auch deren Widerpart, den "idealen Leser", die "Leserfigur" ab und gibt dem wirklichen Leser die Chance, Ansprüche zu stellen statt Ansprüchen zu genügen, sich im Zwischentext auf eigene Faust zu bewegen, das Erzählte als solches zu beurteilen und sich von einem Schauplatz zum anderen führen zu lassen wie in einem durch dauernden Szenenwechsel zerschnittenen Film: "Hier wollen wir die Geschichte von den beiden Königinnen mit dem Bruder lassen und weiter vom König Claudas von der Wüste erzählen. Aber zuerst müssen wir ein wenig von der Frau vom See erzählen. Ihr werdet gleich erkennen, warum - da vernemt ir kurczlich wol warumb das ist gethan".
Wer sich einmal im Zwischentext wohl fühlt, greift aber auch immer öfter und immer lieber zum Zeilenkommentar, sozusagen einem Übertext, wo man zu Fragen des Wortlauts und seiner Überlieferung, über das Verhältnis zu den altfranzösischen Quellen (manchmal sogar mit Originalzitaten) und vor allem über wichtige Elemente der dargestellten Realität und die literarischen Traditionen ihrer Darstellung unterrichtet wird. An der Sprache erkennt man überall denselben Vermittler, ihre einfache Klarheit verdient hohes Lob. Dieser Stellenkommentar geht auch sonst über philologische Handwerklichkeit hinaus, zeigt Verbindungen, erzählt Ergänzungen, verweist auf Literatur und läßt sich durch ein Sachregister erschließen. Aus diesem Buch darf man sich heraus- und wieder hineinlesen, das Vergnügen daran darf sich gelegentlich in Arbeit verwandeln und immer einmal wieder auch in Bewunderung über die gelungene Arbeit, die schon darinsteckt.
Max Wehrli hat besonders die rhetorischen Formen, den Prosarhythmus im Zusammenspiel mit einer reicher und logisch genauer werdenden Syntax, eine verfeinerte, beweglichere Stilisierung des Details gerade auch bei der Schilderung seelischer Regungen hervorgehoben: "Die Lancelot-Prosa im Französischen wie im Deutschen entfaltet diese Kunst mühelos und mit sanfter Magie." Sie bezaubert in der Tat den Leser, der sich zum Beispiel an eine Szene wie die des einsamen Sterbens von König Ban noch lange erinnert: "da strackt er sich so sere das im all syn adern brachen in sym lib, und sin hercz zurbrach von ruwen und lag dot" - diese Beschreibung sollte wohl medizinisch-sachlich klingen, aber das Brechen der Adern hat auch, vielleicht zu Unrecht, für den modernen Leser eine poetische Qualität bekommen, weil wir weder so sprechen noch eine solche Vorstellung besitzen. Unsere neuhochdeutsche Übersetzung schiebt das poetische Element unbestechlich beiseite: "Er streckte sich so sehr, daß ihm alle Adern im Leib zerplatzten; sein Herz brach vor Schmerz, und er starb". Aber nun bleibt die doppelte Lektüre um so fester haften, der Leser hat sich als Leser und als Teilnehmender erfahren, und den unglücklichen König Ban beklagt er heimlich um so mehr, als die Geschichte seinen Tod so trocken berichtet!
Die neuere Forschung hat im Prosa-Lancelot all jene Qualitäten aufgesucht, die ihn als eine geschlossene Form erscheinen lassen, und seine Autoren haben ganz ohne Zweifel in dieser Hinsicht übermenschliche Anstrengungen gemacht, um die episodische Welt des Artusromans zu einer großen Synthese zusammenzufassen und ihr eine die ritterliche Kultur transzendierende neue geistliche Deutung zu geben. So wird es auch richtig sein, daß, mit den Worten des Herausgebers gesagt, "der Adel des späteren Mittelalters den Roman als Vermächtnis einer Vergangenheit gelesen hat, die zwar unwiederbringlich vergangen, aber eben deshalb geeignet war, den Traum von einer idealen, historisch beglaubigten und spirituell überhöhten Ritterwelt weiter zu träumen" - das mag für jene Rezipientengenerationen vielleicht sogar lebenswichtig gewesen sein, aber die Verabschiedung des Autors und die damit einhergehende Emanzipation des "idealen Lesers" zu einem wirklichen desavouiert die überanstrengte geschlossene Form.
Die Historisierung der Sagen- und Märchenwelt und ihre Ausrichtung auf das Heilsgeschehen bedroht überdies auch die Personen und ihr Leben oft auf bestürzende Weise mit ihrer eigenen Auflösung: Bei einem seiner ersten großen Abenteuer hebt der Ritter, von dem der Leser, aber nicht er selbst weiß, daß er Lancelot heißt, in der verhexten Burg einen schweren Sarg, um die Inschrift darunter zu lesen (man informiert uns eigens, daß er bei seiner Adoptiv-Fee lesen gelernt hatte!): "In diesem Grab wird liegen Lancelot vom See, der Sohn König Bans von Bonewig und seiner Ehefrau Alene. Er setzte den Sarg wieder ab und wußte, daß es sein eigener Name war, den er da gefunden hatte." Gerade die Tatsache, daß König Artus unter dem Druck der Ereignisse seine sagenhafte Idealität fast nirgends unter Beweis stellen kann, erweist sich als dramaturgisch vorauswissend - es beginnt damit, daß er zu jung und zu schwach ist, seinen ihn treu dienenden Lehnsmann König Ban gegen den räuberischen Claudas zu verteidigen; und es wird mit der inneren Selbstzerstörung des Artusreichs und dem Tod des Königs enden.
Wenn denn das Ziel dieses Romans die Gralswelt ist, dann hätte er sich sozusagen im Helden geirrt, denn Lancelot kann dieses Ziel gerade nicht erreichen, erst sein Sohn Galaad kann es (obwohl die Umstände seiner Zeugung für eine solche Apotheose die denkbar schlechteste Voraussetzung darstellen müßten, aber lassen wir das). Lancelot ist eben kein Held der Heilsgeschichte, und er ist um so mehr unser Held, weil er "an seiner Liebe festhält, obwohl er schon bald weiß, daß er an ihr scheitern wird. Dieses Wissen macht ihn bei all seinen Triumphen einsam, und man glaubt, Züge von Melancholie an ihm wahrzunehmen. Es sind diese Züge, die Lancelot bis heute anziehend machen", schreibt der Herausgeber, und auch Max Wehrli hat bei Lancelot die Haltung "der Nachdenklichkeit, der sentimentalen Melancholie" gespürt und durch die vergehende Zeit begründet, die nur noch Suche ist, von der man sagen könnte, sie "habe schließlich das Abenteuer aufgelöst im Strom ihrer eschatologischen Bewegung".
Wehrli spricht von einer "Götterdämmerung des schuldig werdenden Artusrittertums" und bezeichnet auch mit dieser Metapher deutlich, daß die Artuswelt als ein zwar christlich geprägtes, aber doch wesentlich diesseitiges Ideal durch seine epische Historisierung dekonstruiert wird. Das Gralsreich, das sie ablösen soll, ist nicht von dieser Welt, die "Freude" des arthurischen Ideals in seiner vorprosaischen Zeitlosigkeit bringt der Gral nicht zurück. Die Melancholie, die nicht nur den Helden ergreift, sondern über dem ganzen unheilvollen Heilsplan schwebt, gilt dem epischen Scheitern einer diesseitigen Humanität. Es ist schlimmer, wenn ein fiktives Gebäude einstürzt, als wenn ein reales fällt, denn für scheiternde Ideale gibt es nicht einmal eine Entschuldigung. Die erstaunliche Botschaft von der epischen Zerstörung der Ritterkultur ist für den heutigen Leser um so irritierender, je weniger ihr eschatologischer Ausweg eine geistige Realität darstellt.
Steinhoffs übersetzte Ausgabe des Prosalancelot verschärft also aufs glücklichste dessen als aktuell lesbare ästhetische Konfiguration, und sogar der abgelebte Stoff vermag im einzelnen noch menschlich zu rühren und im ganzen Fragen an eine Epoche zu stellen, die das Ende der Geschichte postulieren möchte, sozusagen ein Pfingstfest der Demokratie, das nie zu Ende geht.
Aber das alles greift weit vor; unser zweiter Band gilt noch der Liebe von Lancelot und Ginover und ihrer abenteuerlichen Welt, in die man sich nicht versenken kann, weil sie ihren Leser zu tragen scheint. Von der Löschung des Autors, der Entlassung des "idealen Lesers", der Historisierung des Geschehens, von der Kompetenz des Übersetzers und der Zuverlässigkeit des Kommentators profitiert schließlich ganz allein dieser reale Leser, fühlt sich sehr frei, darf eigene Meinungen haben, sich über gelungene Funde des Übersetzers freuen, über vermeintliche Entgleisungen auch einmal besserwisserisch den Kopf schütteln (das stärkt sein Leserbewußtsein). Wenn ihm danach zumute ist, darf er der melancholischen Betrachtung des Laufs der Welt ein Weilchen nachhängen, bis ihn ein grotesker Ritterkampf wieder in die Realität der Fiktion zurückbeordert (". . . Da hob er das Schwert und schlug es ihm in die Zähne bis hinter die Ohren"), und das alles, ohne sich zu langweilen.
Vielleicht war der Leser im Falle des Rezensenten auch nur froh, hier einmal vor jenem Typ von Autor geschützt zu sein, der durch wirkliche und imaginierte alte Bücher hindurchraunt, der sich hinter undurchsichtigen Freunden oder durchsichtigen Mittelsmännern versteckt, kurz gesagt wie ein Kind sich die Augen zuhält und "Such mich!" ruft. Dazu ist der Lancelot eine empfehlenswerte Alternative. Wünschen wir dem neuen Klassiker also für die ausstehenden Bände gutes Gedeihen, baldige Vollendung und einen Literaturpreis als angemessenen Dank des Publikums.
Lancelot und Ginover (Prosalancelot) I und II. Nach der Heidelberger Handschrift Cod. Pal. germ. 147, herausgegeben von Reinhold Kluge, ergänzt durch die Handschrift Ms. allem. 8071-8020 der Bibliothèque de l'Arsenal Paris. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Hans-Hugo Steinhoff. Bibliothek des Mittelalters, Bände 14 und 15. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1995. 2400 S., geb., 248,- DM (Leinen), 488,- DM (Leder).
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main