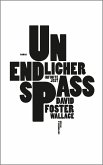Ein Giftanschlag mit Schokoriegeln, ein verbrühtes Kind, ein durchgedrehter Lehrer - auch in seinen neuen Erzählungen nimmt David Foster Wallace die Wirklichkeit ins Visier und erweist sich als scharfsinniger Beobachter und brillanter Erzähler. Er schlachtet unbarmherzig gesellschaftliche Schwachstellen aus und beschreibt, wie Heuchelei, Hass und das Böse in die Welt kommen: ganz langsam, ganz harmlos, im Kopf jedes Einzelnen.
Der "Megageheimtipp der amerikanischen Literaturszene." - Harald Schmidt

Saunders, July, Wallace: Die klügsten und besten amerikanischen Schriftsteller gehen mit Emphase auf den Menschen los – bis an die eigene Ekelgrenze
Es ist schon traurig, heute am Leben zu sein; aber besser so als andersherum. Das, in etwa, ist der tragische Kern der Sache, das ist der Ausgangspunkt, von dem aus George Saunders und Miranda July und David Foster Wallace die Welt betrachten und ihre Geschichten beginnen. Und wie so oft bei Tragödien, ist es nur eine Frage des Blickwinkels, dann wird daraus eine Komödie.
Diese Autoren schreiben über das postmoderne Bewusstsein: wie es strahlt, so hell, so toxisch; wie es flackert, so paranoid, so aggressiv; wie es erlischt, so einsam, so depressiv. Sie schreiben, aber das heißt nicht, dass sie Schriftsteller sind in jenem emphatischen Sinne des 19. Jahrhunderts wie ihre deutschen oder europäischen Kollegen. Sie haben im Grunde einen anderen Beruf.
Die einen essen immer noch Kekse und denken, das sei eine Proust’sche Madeleine, und versuchen sich zu erinnern, wie das früher wohl einmal geschmeckt hat und was da sonst noch war. Die anderen, Saunders, July, Wallace, wissen, dass da nichts mehr ist. Dass es kein Erinnern gibt, nur noch tückische Gegenwart. Dass sie nichts tun können, als diese Lüge ihr Leben zu nennen. Dass sie etwas sehr Widersinniges wagen, wenn sie sich mit Worten bewaffnen, und gerade daraus ihre Kraft schöpfen. Sie schreiben auf das Ende des Schreibens zu. Sie benutzen die Sprache, um eine Welt zu erkunden, die sich langsam von der Sprache verabschiedet. Sie erkunden mit Worten dieses Bewusstsein, das sich aus vorgefertigen Glückskonzepten und Lebenswahrheiten zusammensetzt. Sie verwenden ihre Geschichten wie Instrumente, um Löcher in diese hermetischen Existenzen zu bohren. Sie schaffen Figuren, die so komplex wirken wie Barbie-Puppen und doch alle Züge von tragischen Helden tragen. Sie spielen mit ihnen die Aporien unserer Zeit durch. Diese besonders klugen, besonders guten amerikanischen Schriftsteller wissen genug, um es bei ihrer Arbeit zu vergessen. Sie schreiben schon aus dem Off der Aufklärung.
Und sie sitzen dabei, ganz protoplatonisch, wieder in der Höhle, sehen die zitternden Zeichen an der Wand, versuchen daraus ein Bild zu schaffen, des Lebens, des Sinns. Sie sind Zweifelnde, Suchende. Sie sind weiter vorgedrungen in die Dunkelheit, als ihnen gut tut; sie haben schließlich diese Höhle gefunden, und wie sie nun einmal dort saßen, wirkte alles, was die anderen Menschen von draußen, von der Luft und vom Licht erzählten, irgendwie lächerlich.
So geht es zum Beispiel dem armen Mann in der Titel-Geschichte „Pastoralien” von George Saunders (Berlin Verlag, Berlin 2002), den manche schon den größten amerikanischen Satiriker seit Mark Twain genannt haben: Er sitzt tatsächlich in einer Höhle, er arbeitet als Steinzeitmensch in einem Freizeitpark und muss froh sein, wenn er ab und zu von der Parkleitung eine Ziege spendiert bekommt, die er sich dann überm Feuer braten darf. Manchmal schaut tagelang niemand vorbei. Mit Janet, die als seine Steinzeitfrau in der Höhle arbeitet, darf er sich nur durch Zeichen oder Grunzen unterhalten, es gab ja noch keine Sprache damals. Der Mann hat Angst um seinen kleinen Sohn und um seinen Job – scheitern wird er schließlich an sich selbst und an einer arbeitspsychologischen Evaluationslogik, die so modern ist, dass sie schon wieder vormodern ist.
„Obwohl, eins steht fest”, sagt sich dieser Mann, „Grübeln löst auch keine Probleme. Andererseits, Positives Denken über Probleme genauso wenig. Doch dann fühlt man sich immerhin positiv, was ja eine machtergreifende Wirkung hat oder jedenfalls haben sollte. Und Macht ist gut. Macht ist inzwischen notwendig. Inzwischen ist es notwendig, dass ich ein Fels in der Brandung bin, ja. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich nicht für alle Probleme der Welt zuständig bin.”
Dauerfeuer der Glücksindustrie
Das ist Logik der logosfreien Welt, das sind die semitherapeutischen Untiefen, in die ihn sein Denken führt. Fast immer geht es in den Geschichten von Saunders, auffallend oft auch in denen von Miranda July und David Foster Wallace, um die Suche nach dem geglückten Leben – und fast immer endet das Streben nach einem besseren Ich in der Katastrophe. Glück und Unglück haben in dieser Welt den gleichen Ursprung. Oder anders gesagt: Im Dauerfeuer der Glücksindustrie ist jeder das erste Opfer.
Das Besondere an diesen drei Schriftstellern, die alle an Thomas Pynchon und Don DeLillo geschult sind, ist nun, dass sie über dieser Diagnose nicht in den kulturpessimistischen Jammerton verfallen, den die europäischen Schriftsteller gern anschlagen. Miranda July oder David Foster Wallace gehen ohne Hochmut vor und mit so etwas wie echter Traurigkeit. Sie etwa nähern sich diesen postmodernen Zeiten lieber von innen, sie gehen hinein in die Sprache der Werbung und der Selbstverbesserung, sie recherchieren bis an die eigene Ekelgrenze.
„Wenn ich nach Hause komme, meditiert Carl. Ich mag diese Zeit, weil seine Augen dann geschlossen sind; das gibt mir die Möglichkeit, mehr so zu sein, wie ich gern in seiner Gegenwart wäre.” Die Geschichte von Miranda July heißt „Mon Plaisir” aus ihrem Band „Zehn Wahrheiten” (Diogenes Verlag, Zürich 2008), und am Ende geht das Paar natürlich auseinander, auch wenn die beiden eine kurze Phase des Glücks wiedergefunden hatten, als sie Statisten waren bei Filmaufnahmen und in einem Restaurant sitzen mussten und sich unterhalten sollten, ohne etwas zu sagen, nur den Mund sollten sie bewegen. Da waren sie sich noch einmal nah.
Diese Geschichten haben bei aller Einsamkeit und Enttäuschung einen Witz und eine Wärme, wie sie wohl nur entstehen, wenn man mit einer Emphase auf die Menschen losgeht, wie sie dann doch bei amerikanischen Schriftstellern eher zu finden ist. Sie haben eben, yes we can, die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie wollen wissen, wie es sich anfühlt, heute am Leben zu sein. Sie haben einen anderen Ansatz beim Schreiben: Wo die europäischen Schriftsteller eine Seele suchen, die sie ergründen, suchen die amerikanischen eher nach einer Mechanik, die sie erforschen.
David Foster Wallace etwa, der radikalste und mutigste unter ihnen, der sich am weitesten vorwagte – zu weit vielleicht, im September nahm er sich das Leben. Sein Schreiben, wenn man zum Beispiel die Geschichten „In alter Vertrautheit” (Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008) liest, war eine merkwürdige Art von Selbstverteidigung, bei der er sich selbst erst in Gefahr brachte. David Foster Wallace wollte die Welt von innen verstehen, und als er sah, dass da nichts mehr war, war seine Leere größer als die Welt. „Die Seele ist kein Hammerwerk” heißt eine seiner Geschichten, die ein dramatisches Erleben mit einer distanzierten Sprache in perfekten Einklang bringt: „Erst sehr viel später begriff ich, dass der Vorfall an der Tafel des Gemeinschaftskunderaums das wahrscheinlich dramatischste und aufregendste Geschehen war, in das ich in meinem ganzen Leben verwickelt sein würde.”
Im Grunde ist diese Balance von Neugier und Negieren eine sehr amerikanische Haltung. Diese Schriftsteller sind keiner Innerlichkeitsapostel; sie betrachten die Seele mit der Kühlheit des Naturforschers.GEORG DIEZ
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de