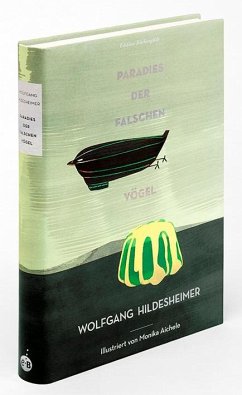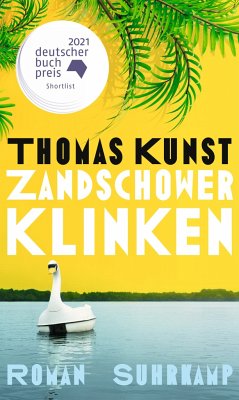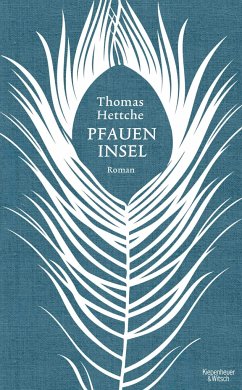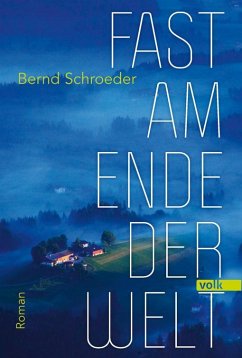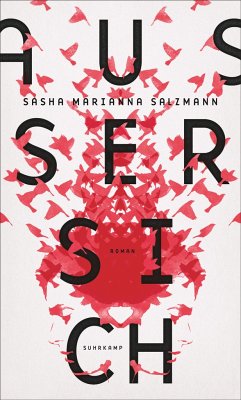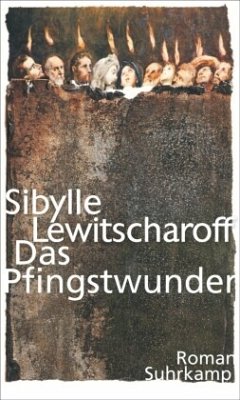vor seinem Häuschen auf dem norddeutschen Lande, fernab der Stadt, ohne Auto, ohne Telefon, ohne Radio, Zeitung oder Fernseher und vor allem ohne alles Digitale. Denn das Digitale ist böse, und das Internet ist ganz böse. "Gott hat sich ins Netz aufgelöst", erfahren wir: "Die neue Schöpfung besteht aus Einsen und Nullen." So kommt alles Schlimme in die Welt: Fracking, TTIP, Tschernobyl, Big Data, NSA, "diese ganze Soziale-Netzwerk-Scheiße", natürlich auch Smartphones, Drohnen, Pillen, Aktien, Crack und Öl. Deshalb hat Walter seinen Rückzug aus der schlechten neuen Welt gewählt und sich in die Abgeschiedenheit begeben, wo er am liebsten seine Ruhe pflegt, dem Wetter zusieht und den Vögeln lauscht.
Dabei geschieht ihm allerhand Dramatisches: Seine Frau hat sich das Leben genommen (aber darüber erfahren wir so gut wie nichts), seine Nachbarn werden ermordet (aber daraus folgt eigentlich nichts), die Tochter von Freunden gerät erst in die Drogenszene und dann in die Arme einer ominösen Gruppe junger Hacker (aber was sie treiben, wissen wir nicht), die Idylle auf dem Lande wird durch einen Energiekonzern bedroht, der aus tiefen Bodenschichten Gas gewinnen will (aber das wollen die Dorfbewohner nicht). Schließlich gibt es noch so etwas wie einen zentralen Spannungsbogen, weil Walter eine unbekannte Schöne wiederfinden will, der er auf einem seiner seltenen Ausflüge in die Stadt in die Arme gelaufen ist. Um sie aufzuspüren, gibt er Suchanzeigen auf und legt sich sogar ein Smartphone zu - erfolglos. Das Smartphone endet später im Jahr auf dem Hackklotz, wo er Brennholz für den Winter macht und gleich auch das Gerät mit extra scharfer Axt zerkleinert (die Schöne findet sich am Schluss durch Zufall wieder). Doch nicht einmal das Winterwetter wird mehr so, wie es soll.
Vor vier Jahren sorgte Ralph Dohrmann für Überraschung, als er mit "Kronhardt" einen sehr ungewöhnlichen Debütroman vorlegte, eine neunhundertseitige Industriellen-, Bildungs- und Familiensaga, die wie aus der Zeit gefallen wirkte, doch mit bemerkenswertem Charme für sich einnahm und es auf die Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse schaffte. Bei diesem Folgeroman aber ist aller Zauber des Unzeitgemäßen verflogen. Die Geschichte ist ein dünner Aufguss der bereits bekannten, die Zentralfigur ein blasser Schatten ihres Vorgängers, das Setting (abermals Bremen und sein Umland) nur noch schnittmusterhaft arrangiert. Da hilft es auch nicht, dass jeder Absatz stimmungsvoll den Wetterbericht mitteilt und jede Szene mit dem Soundtrack aktueller Vogelstimmen unterlegt wird (dem Kuckucksruf, dem "Woid-Woid" des Schilfrohrsängers, den "flötenden Trillern" der Bachstelze, dem "tiefen Grunzen" der Rohrdommel und was dergleichen Klänge mehr sind). Die kulturkritische Botschaft von "Eine Art Paradies" kommt derart einfältig daher, dass im Vergleich dazu "Ein bisschen Frieden" von Nicole als tiefgründige Zeitdiagnose erscheint.
Vor allem aber nervt die sprachliche Gestaltung: nichts als Hauptsätze. Vermutlich weil der fiese PR-Typ, den Walter einmal trifft, mit "verschachtelten Sätzen" spricht, muss der Erzähltext durchweg ohne alle Hypotaxe auskommen. Wenn nur die Wirklichkeit auch so schön unverschachelt wäre! Als E-Book übrigens ist Dohrmanns Roman günstiger erhältlich. Man kann ihn also einfach auf dem Smartphone lesen. Und anschließend problemlos löschen.
TOBIAS DÖRING
Ralph Dohrmann: "Eine Art Paradies". Roman.
Arche Literatur Verlag, Zürich 2015. 350 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
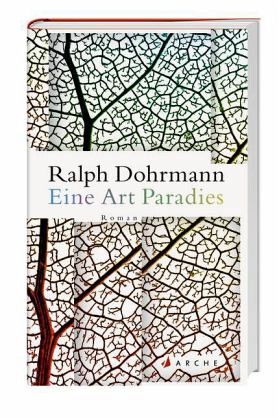




 buecher-magazin.deNatur- und Landschaftsbilder auf Facebook oder Twitter haben etwas Anachronistisches. Sie zeigen im digitalen Abbild genau das, was wir nicht mehr richtig genießen können, weil die digitale Welt uns in den Fängen hat. Walter von Quant, der Protagonist in Ralph Dohrmanns Roman, scheint dieser Welt nach dem Tod seiner Frau konsequent entkommen zu sein. Es gibt nur mehr Natur, wie ein Einsiedler (so nennen ihn die anderen Dorfbewohner scherzhaft) lebt er in seinem Haus mit Garten und kümmert sich nicht mehr groß um die Welt. Die Pappeln, die "die ganze Welt mit ihrem Rauschen erfüllen", haben das digitale Rauschen des weltweiten Datennetzes ersetzt. Doch die Welt jenseits des Rauschen existiert weiter, ob von Quant will oder nicht. Und sie will ihn zurück, diese Welt, bietet ihm eine neue Frau, eine neue Liebe. Wie der Held sich arrangiert, wie weit er aus seinem Rückzugsort herauskommen möchte, das erkundet Dohrmann in einer nüchternen, klar strukturierten Sprache. Es ist ein langsames Buch, wer das nicht mag, wird seine Schwierigkeiten haben, das kontemplative Element der Natur findet sich in vielen Sätzen, in vielen Gedanken von Quants. Und somit taugt auch dieses Buch für die kleine Flucht aus Digitalien, ohne die Illusion zu erzeugen, dass diese für immer sein könnte.
buecher-magazin.deNatur- und Landschaftsbilder auf Facebook oder Twitter haben etwas Anachronistisches. Sie zeigen im digitalen Abbild genau das, was wir nicht mehr richtig genießen können, weil die digitale Welt uns in den Fängen hat. Walter von Quant, der Protagonist in Ralph Dohrmanns Roman, scheint dieser Welt nach dem Tod seiner Frau konsequent entkommen zu sein. Es gibt nur mehr Natur, wie ein Einsiedler (so nennen ihn die anderen Dorfbewohner scherzhaft) lebt er in seinem Haus mit Garten und kümmert sich nicht mehr groß um die Welt. Die Pappeln, die "die ganze Welt mit ihrem Rauschen erfüllen", haben das digitale Rauschen des weltweiten Datennetzes ersetzt. Doch die Welt jenseits des Rauschen existiert weiter, ob von Quant will oder nicht. Und sie will ihn zurück, diese Welt, bietet ihm eine neue Frau, eine neue Liebe. Wie der Held sich arrangiert, wie weit er aus seinem Rückzugsort herauskommen möchte, das erkundet Dohrmann in einer nüchternen, klar strukturierten Sprache. Es ist ein langsames Buch, wer das nicht mag, wird seine Schwierigkeiten haben, das kontemplative Element der Natur findet sich in vielen Sätzen, in vielen Gedanken von Quants. Und somit taugt auch dieses Buch für die kleine Flucht aus Digitalien, ohne die Illusion zu erzeugen, dass diese für immer sein könnte. Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.02.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.02.2016