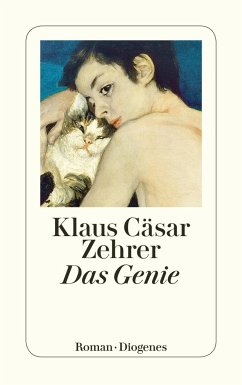Boston, 1910. Der elfjährige William James Sidis wird von der Presse als »Wunderjunge von Harvard« gefeiert. Sein Vater triumphiert. Er hat William von Geburt an mit einem speziellen Lernprogramm trainiert. Doch als William erwachsen wird, bricht er mit seinen Eltern und seiner Vergangenheit und weigert sich, seine Intelligenz einer Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, die von Ausbeutung, Profitsucht und Militärgewalt beherrscht wird.

Klaus Cäsar Zehrer schreibt einen Roman über den genialsten Menschen, der je
gelebt hat: das lebensuntüchtige Wunderkind William James Sidis
VON BURKHARD MÜLLER
Wer war der intelligenteste, der genialste Mensch aller Zeiten? Starke Indizien sprechen dafür, dass es sich dabei um William James Sidis gehandelt hat, Kind ukrainischer Einwanderer in den USA, geboren 1898, gestorben 1944. Wie kann es sein, dass Sie von ihm noch nie gehört haben? Offenbar hatte er Probleme damit, aus seinem Talent den Funken des Nutzens zu schlagen – und diese setzen sich fort, wenn man einen Roman daraus macht.
Der Autor, Klaus Cäsar Zehrer, bewegt sich mit seinem Buch „Das Genie“ so dicht an den Quellen entlang, dass man es, wären da nicht die vielen Dialoge (die ja wohl erfunden sind), genauso gut als Biografie bezeichnen könnte. Und Quellen gibt es in großer Zahl, denn Sidis Vater und Sohn schrieben unaufhörlich, noch mehr aber die Zeitungen über beide.
Boris, der Vater, flieht in jungen Jahren vor den Häschern des Zaren nach New York, verschenkt leichten Herzens sein letztes Geld und verlässt sich stattdessen auf das, was er im Kopf mit sich trägt. Auch er schon ist ein Hochbegabter, dem die Sprachen nur so zufliegen; als Sprachlehrer lernt er seine spätere Ehefrau Sarah kennen, die den weltfremden Gatten erdet und die praktischen Angelegenheiten in die Hand nimmt. Der berühmte Psychologe und Philosoph William James, dem zu Ehren er seinen Sohn benennt, nimmt ihn unter die Fittiche und ermöglicht ihm eine wissenschaftliche Laufbahn. Zwei Forschungsgebiete haben es ihm besonders angetan: die noch junge Hypnose, mit deren Hilfe er selbst den verehrten Meister James in ein gackerndes Huhn verwandelt; und die systematische Erziehung seines vorerst einzigen Kindes zum Genie.
Alle Menschen, so lautet Boris’ These, hätten das Zeug zu einem solchen – und lediglich die Inkompetenz und Fahrlässigkeit der Eltern und Lehrer verhindere, dass sie alle es wirklich würden. Um dem noch nicht mal Einjährigen vier Muttersprachen auf einmal beizubringen, besorgt er sich vier verschiedene Kopfbedeckungen, denn Kinder brauchen sinnliche Anhaltspunkte: Wenn er Englisch mit ihm spricht, trägt er einen Bowler, bei Französisch eine Baskenmütze, bei Russisch eine Fellkappe und bei Deutsch einen Filzhut.
Und der Erfolg gibt ihm recht. Als Psychotherapeut betreibt er mit Sarah ein hochklassiges Sanatorium für betuchte Patienten, das allerdings zunehmend mit der verhassten Psychoanalyse konkurrieren muss. Sohn William aber erweist sich als Wunderkind, wie man noch keins erlebt hat. Was beim Vater angelegt war, zeigt sich hier in voller Blüte: Alles was mit Gedächtnis, Sprachen, besonders aber Zahlen und Mathematik zu tun hat, fällt ihm stupend leicht. Mit vierzehn Jahren hält er vor der versammelten Harvard University einen Vortrag über die Geometrie vierdimensionaler Körper, für ihn eher eine Fingerübung. Schwer zu tragen hat er allerdings an der Unfähigkeit der journalistischen Berichterstatter, ein Hecatonicosachoron von einem Hecatonicocehedridgon zu unterscheiden. „Wozu hält man ein Referat, wenn so was dabei rauskommt.“ Ein Bekannter sucht ihn zu trösten: „Glaub mir, das merkt kein Mensch“, worauf William nur erwidert: „Umso schlimmer.“
Aber bei so viel Licht treten auch die vom Vater ererbten Schattenseiten schärfer hervor. William diskutiert im Vorschulalter mit Professoren über Platon, bleibt jedoch motorisch unsicher und wird infolgedessen bei der Einschulung zurückgestellt. Er kann von jedem Datum der letzten Jahrtausende auf Anhieb sagen, auf welchen Wochentag es fiel, er weiß alles über die Botanik der Schierlingstanne, hat aber Mühe, diesen Baum im Gelände zu identifizieren. Alles Menschliche und Soziale befremdet und ängstigt ihn. Überall, wohin er kommt, so heißt es einmal, sei er Mittelpunkt und Randfigur zugleich. Er stellt, mit einem Wort, einen extremen Fall von Autismus mit insulärer Hochbegabung dar. Um sich überhaupt irgendwie zurechtzufinden, gibt er sich eine Verfassung mit 154 Paragrafen, die bis ins Einzelne regeln, wie er zum Beispiel vorgehen muss, wenn er einen Apfel isst. Danach fühlt er sich sehr erleichtert.
Dass William James Sidis all das war, tat und konnte, muss man seinem Erzähler wohl glauben. Aber das Interesse an dieser kuriosen Rekord-Existenz lässt beim Leser doch relativ bald nach. Auf intellektuellem Feld bietet ihm nichts einen Widerstand, das praktische Leben aber ist für ihn mit Widerständen förmlich zugenagelt. Das lähmt Zehrers Buch von zwei Seiten. Weil William in der ersten Klasse unterfordert ist, kommt er stracks in die zweite, dann in die dritte, die vierte und so weiter bis zur Highschool. Zugleich aber wirkt dieses kleine Kind im Kreis von immer älteren Mitschülern ziemlich fehl am Platz, bis seine Lage völlig unhaltbar wird. Das ist ein Handlungsstrang, der sich über viele Seiten zieht, aber völlig absehbar ist, außer der steten Verschlimmerung keine Entwicklung zulässt und sich ebenso öde wie traurig liest.
Die Teile Zwei und Drei gestalten sich als Trauerspiel vom Wunderkind, das groß wird. Groß, nicht erwachsen. William, der lang von den Zeitungen wie ein Mondkalb gefeiert wurde, verkennt oder verspielt eine Chance nach der anderen. An der Uni lachen ihn seine Studenten aus, er verkracht sich mit der Familie, stößt die wohlmeinendsten Förderer vor den Kopf, und wo er nicht von selbst kündigt, fliegt er raus. Von seinem Verhältnis zu Frauen schweigt man am besten ganz. Dass er im und nach dem Ersten Weltkrieg den Kommunisten nahesteht und als Kriegsdienstverweigerer vorübergehend sogar im Gefängnis landet, geht eher auf ein Missverständnis zurück.
Sein Autor entwirft ihn hier nicht mit voller Konsequenz: Bei den Roxbury Riots in Boston trägt er die rote Fahne voran; doch als man ihn anschließend im Gerichtssaal nach seinem Verhältnis zur US-Flagge befragt, gibt er zu erkennen, dass er den symbolischen Wert eines solchen Stücks Tuch gar nicht versteht. Er, der geschworen hat, niemals zu lügen, verfällt dennoch auf den Trick, sich als Bibelforscher auszugeben, um nicht Soldat werden zu müssen. Auch die Rolle des reinen Toren füllt er also nicht aus. Der Klappentext spricht davon, das Leben des William James Sidis fasziniere, weil er unter widrigsten Umständen ein selbstbestimmtes Leben durchgesetzt habe. Das trifft darum nicht zu, weil sich bei dem verwirrten Protagonisten ein solches Selbst nirgends abzeichnet.
Seine Talente vermag er nicht zu bündeln, mal treibt ihn eine Universaltheorie des Weltalls um, mal Fantasien von der Erlösung der Menschheit, mal der Entwurf für ein ideales Straßenbahnnetz. Sein früher Weggefährte Norbert Wiener, obwohl im Vergleich mit William nur ein Genie zweiten Ranges, schafft es immerhin, die Kybernetik grundzulegen und wichtige Schritte zur Erfindung des Computers zu tun: so hat er sich der Nachwelt eingeprägt. William, der zuletzt Befriedigung darin findet, einfache Rechenaufgaben für eine Versicherung zu erledigen und The Peridromophile herauszugeben, ein selbstgebasteltes Magazin für Freunde des Straßenbahnwesens, hat keine Spuren seiner Tätigkeit hinterlassen – wenigstens nicht bis Zehrer kam, um die verschollenen Zeugnisse auszugraben. Als William, der von Stufe zu Stufe immer mehr verkommt, einem Schlaganfall erliegt, erst 46, neigt man fast dazu, seiner verhärmten Mutter recht zu geben: Am besten wäre er gleich nach seiner Harvard-Darbietung mit 14 Jahren gestorben.
Über William James Sidis ließe sich sagen, was Heinrich von Kleist über sich selbst gesagt hat: Die Wahrheit ist, dass ihm auf Erden nicht zu helfen war. Der Leser verfolgt seinen Lebensweg erst mit kalter, dann mit schmerzlicher Verwunderung. Das ist für einen Roman von 650 Seiten zu wenig.
Was beim Vater angelegt war,
zeigt sich beim Wunderkind
William in voller Blüte
Sein Weggefährte Norbert Wiener
schafft immerhin wichtige Schritte
zur Erfindung des Computers
Der unglückliche William James Sidis, von dem der Roman „Das Genie“ erzählt, ist eins der Wunderkinder, die auch Matt Damon in dem Film „Good Will Hunting“ inspiriert haben.
Foto: mago stock&people
Klaus Cäsar Zehrer:
Das Genie. Roman.
Diogenes Verlag, Zürich 2017. 651 Seiten, 25 Euro. E-Book 21,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de