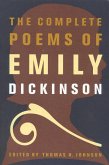Einst war sie eine Opfer-Ikone des Feminismus. Aber auch heute noch beeindruckt die poetische Energie von Sylvia Plaths Gedichtband „Ariel”
Moderne Lyrik wirkt verstörend, weil sie die schöne Ordnung lyrischer Formen und Themen zerstört, an die sich Ohr und Herz seit Jahrtausenden gewöhnt haben. Was aber die meisten Leser und Nicht-Leser moderner Lyrik befremdet, das gerade zieht Autoren an, deren Gemüt verstört ist und die ihr Leben selbst zerstören. „Sterben/ Ist eine Kunst, wie alles andere auch./ Ich kann es besonders gut.” Lakonisch rühmt sich Sylvia Plath einer Fähigkeit, die sie bald danach unter Beweis stellen wird: Erst dreißig Jahre alt, begeht sie 1963 in London Selbstmord. Getötet werden, tot sein und dennoch sprechen: aus dieser unvertrauten Perspektive schreibt sie ihre letzten Gedichte, die der Band „Ariel” versammelt. Plath erfindet poetische Bilder und politische Begründungen, um ihre persönliche Katastrophe mitteilbar zu machen. Das Gedicht „Lady Lazarus”, das eine von den „Nazis” (ein Sammelname für brutale Männlichkeit) getötete Jüdin spricht, spielt in angelsächsischen Ländern eine ähnliche Rolle wie Celans „Todesfuge” in Deutschland.
Allerdings war Celan, der ebenfalls Selbstmord beging, wirklich Jude; Sylvia Plath dagegen, unbedroht aufgewachsen im prosperierenden Amerika, stellt sich nur vor, eine Jüdin zu sein. Bedroht ist sie von innen, nicht von außen: Manisch-depressive Attacken bringen sie bereits in frühen Jahren in Kliniken, treiben sie zum versuchten und schließlich zum gelingenden Suizid. In den privaten Botschaften an ein anonymes Publikum, die sie „Ariel” aufträgt, schreibt Plath, anders als in den Tagebüchern, die Schuld an ihrer Krankheit den anderen zu, dem Vater, den Nachbarn, den Ärzten, dem Ehemann, den Männern überhaupt. Feministische Interpreten haben daher „Ariel” wie den Roman „Die Glasglocke” als Bekenntnis weiblicher Unterdrückung, als Manifest weiblichen Aufbegehrens verstanden und seine Verfasserin zur Ikone eines Opfertods verklärt.
Heute reden junge Frauen lieber von ihren Fähigkeiten und Leistungen als von ihren Leiden und Benachteiligungen. Deshalb muss sich Sylvia Plaths Ruhm in der Geschichte und im Kanon der modernen Lyrik anders, durch literarische Vorzüge behaupten. Jetzt erst, nachdem sie ihre zeitbedingte Funktion verloren haben, ist die poetische Energie der Gedichte unmittelbar zu spüren. Selbst in den Klagen überwältigt den Leser die Wildheit, am Leiden die gedrängte Formulierung, am Autobiographischen die Vergrößerung zur Tragödie, am Traum die Erhellung einer anderen Welt, in der das Chaos der Erscheinungen sich zu Wohlklängen und Verszeilen ordnet. „Ariel”, das Titelgedicht des Bandes, erweitert das Bild eines Pferdes zum Inbild des Wunsches, bewusstlos und einverstanden mit allen Dingen über die Erde zu fliegen: „Stillstand in Dunkelheit./ Dann körperlos blauer/ Schauer von Fels und Entfernungen.// Löwenweib Gottes,/ Wie eins wir werden,/ Am Fixpunkt von Fersen und Knien!” So hätte das Glück aussehen können, wenn es eines gegeben hätte. Vom Unglück des Lebens bleibt einzig das Glück der Verse.
Den Gedichtband „Ariel” gibt es in zwei Fassungen. Die Bibliothek Suhrkamp führt weiterhin die zweisprachige Ausgabe Erich Frieds von 1974, die sich auf die Ausgabe von Plaths Ehemann Ted Hughes stützt. Hughes, ein Lyriker von nicht geringerem Rang als seine Frau, hatte aus dem hinterlassenen Manuskript von 40 Gedichten ein Drittel gegen früher oder später entstandene ausgetauscht, um noch lebende Personen vor der lyrischen Aggression Sylvia Plaths zu schützen. Die von ihr ursprünglich getroffene Auswahl stellte 2004 Frieda Hughes, die Tochter des Paares, wieder her. Diese restaurierte Fassung liegt der Übersetzung Alissa Walsers zugrunde. Die jetzt aufgenommenen Gedichte wie „Der Schließer” oder „Lesbos” erinnern an eine Tradition polemischer und rabiat subjektiver Lyrik, die von dem frü;hgriechischen Dichter Archilochos über Horaz’ Epoden bis zu den „Jamben” Carduccis und Borchardts reicht.
Manches gelingt Alissa Walser besser, manches schlechter als ihrem Vorgänger Erich Fried, dessen Übersetzung sie im Nachwort ungerecht als „gleichmäßiges Rauschen” abtut. In Wahrheit kommt Walser von Fried nicht los, gerade weil sie penibel bemüht ist, die von Fried gefundenen Lösungen zu umgehen. Die schlichte Zeile „It is not mine. Do not accept it” hatte Fried schlicht übertragen: „Es ist nicht meines. Nimm es nicht an.” Walser will davon um jeden Preis abweichen – „Ist nicht meins. Lehn es ab.” – und verliert so das doppelte „it” und „not”. Sie verliert dabei auch das grammatische Subjekt im ersten Satz und ersetzt die stakkatohaften, aber korrekten Formeln der Dichterin durch einen nachlässigen Umgangston. Wenn jedoch Walser Plaths Metapher für das Auge, „the cauldron of morning”, zum „Hexenkessel des Morgens” steigert (Fried hatte sich mit „Kessel des Morgens” begnügt), trifft die Übersetzerin das Erschreckende an der Metapher sogar besser als das englische Original. Gut also, dass es beide Bände gibt. HEINZ SCHLAFFER
SYLVIA PLATH: Ariel. Urfassung. Englisch und deutsch. Übersetzt von Alissa Walser. Mit einem Vorwort von Frieda Hughes. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 227 Seiten, 22,80 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Der Gedichtzyklus "Ariel" machte die amerikanische Dichterin Sylvia Plath berühmt. Nun erscheint er erstmals in der Urfassung, von Alissa Walser eindrucksvoll übersetzt.
Von Tobias Döring
Am 12. Dezember 1962 zog die Lyrikerin Sylvia Plath mit ihren beiden kleinen Kindern von Devon in die Fitzroy Road nach London. Dort wollte sie nach der Trennung von ihrem Ehemann, dem Lyriker Ted Hughes, in einem Haus, das einst dem Dichter W. B. Yeats gehörte, ihr neues Leben in die Hand nehmen. "Die nächsten fünf Jahre meines Lebens sehen also himmlisch aus", schrieb sie an ihre Mutter in Amerika zwei Tage später voller Euphorie: "Ich spüre, wie Yeats' Geist mir Segen bringt." Es war der kälteste Winter Englands seit Kriegsende, mit klirrendem Frost und Bergen von Schnee. Da traf es sich besonders ungünstig, dass beim Einzug ins neue Heim der bestellte Gasofen noch nicht geliefert war. Doch mit Hilfe der Gasgesellschaft und zwei tüchtigen Lehrjungen gelang es noch am selben Tag, den Ofen zu installieren. Zwei Monate später, am 11. Februar 1963, legte Plath den Kopf in diesen Ofen und drehte den Hahn auf. Den Kindern, die im Nebenzimmer schliefen, hatte sie Brot und Milch bereitgestellt. Auf dem Küchentisch aber lag ein redigiertes Typoskript mit vierzig Gedichten, die wenig später ihren Weltruhm begründeten.
Man muss diese Geschichte, selbst wenn man Lyrikproduktion und Lebensführung aus prinzipiellen Gründen trennen will, doch immer wieder nacherzählen, denn sie bildet nicht nur einen Gründungsmythos zeitgenössischer Poetik, sondern zugleich auch ein Lehrstück über die Verfügungsmacht von Sprache und die Frage, wie sprachliche Benennung auf den oder die Benannten wirken, das heißt, was für eine Kraft, gerade auch Verletzungskraft von Worten ausgeht. "Worte" ist eins der letzten Gedichte, das Plath hinterließ, überschrieben; es setzt verbale Akte buchstäblich mit der Gewalt des Holzfällens in eins: "Äxte / Nach deren Schlag das Holz klingt", heißt es hier: "Der Saft / Steigt auf wie Tränen". In der Fassung des Gedichtbands "Ariel", wie er 1965 erschien, steht es an letzter Stelle. Es mag dort abschließend bezeugen, mit welcher Wucht ihr nachgelassenes Werk die Hinterbliebenen getroffen haben muss.
Ob es persönliche Betroffenheiten waren oder künstlerische Rücksichten, ist seither allerdings erbittert diskutiert worden. Jedenfalls nutzte der Ehemann nach ihrem Tod die Möglichkeit, in die Gestalt und Textfolge aller weiteren Plath-Publikationen einzugreifen und sie nach seinen Vorstellungen zu edieren. Da zwar die Trennung vollzogen, eine Scheidung aber nicht erfolgt war, ging mit ihrem Tod das Copyright auf Ted Hughes über, der es den Kindern überschrieb, zugleich aber zeitlebens die Kontrolle darüber ausübte. Aus dem Typoskript von "Ariel" beispielsweise entfernte er ein Dutzend Texte und fügte dem Band dafür dreizehn andere Gedichte, darunter "Worte", ein, die erst in ihren letzten Lebenswochen entstanden waren, als Plath sich im neuen Leben in der Fitzroy Road verzweifelt einzurichten suchte. Ihr Ton ist ungleich harscher, düsterer, unversöhnlicher. So wurde wohl der Band, wie Hughes ihn komponierte, um etliche Registertöne reicher und in seiner Spannweite dramatischer. Zugleich aber konnte er, sobald die Eigenmächtigkeiten des Herausgebers bekannt wurden, den Ruch von Zensur nicht mehr abschütteln.
Jahrzehntelang stand Hughes daher als untreuer Ehemann, konkurrierender Dichter und noch postum machtversessener Rivale im Kreuzfeuer der Kritik. Insbesondere die aufkommende feministische Wissenschaft meinte, in dieser unglücklichen Paarung ein Paradebeispiel patriarchaler Sprachmacht zu erkennen, und ging mit Hughes sehr scharf ins Gericht. Die Vorwürfe verstummten selbst dann nicht, als er 1981 Plaths "Collected Poems" vorlegte und darin nicht nur editorisch Rechenschaft ablegte, sondern auch die ursprünglich aus "Ariel" entfernten Texte für den Druck freigab. Daher wurde es weithin bemerkt und begrüßt, als 2004, sechs Jahre nach Hughes Tod, der Faber-Verlag unter dem Titel "Ariel: The Restored Edition" ein Faksimile des mittlerweile mythisch überhöhten Typoskripts herausbrachte. Es gewährt mit Plaths handschriftlichen Revisionen Einblick in den Schaffensprozess und lässt ahnen, wie sorgsam sie jedes Satzzeichen und jede Silbe, die letztlich erscheinen sollten, abwog.
In der deutschen Ausgabe dieser "Urfassung" ist dies leider nur noch für das Titelgedicht nachzuvollziehen. Dafür haben deutsche Leser den unschätzbaren Vorzug, ihre Neubegegnung mit Sylvia Plaths großen Gedichten durch Alissa Walsers neue Übersetzung anregen zu lassen und damit den Prozess des Abwägens wie Nuancierens lyrischer Sprachgebung bewusst nachzuvollziehen. Da die alte Übersetzung von 1974, die kein Geringerer als Erich Fried anfertigte und die in der Bibliothek Suhrkamp weiterhin lieferbar ist, bietet der Vergleich die Chance zu überprüfen, wie unsere eigene Sprache, zumal die Sprache von Geschlechter- und Familienbanden, die den Horizont der meisten Texte dieser Sammlung abstecken, sich im Verlauf einer Generation entwickelt hat.
Beispielsweise "Daddy", das Delirium aus kaltem Vaterhass und fiebriger Selbstüberschätzung, das zu Plaths meist anthologisierten Gedichten zählt: Fried, der es für unübertragbar erklärte und dann doch mit "Papi" übersetzte, gab ihm auch im Deutschen eine Reimstruktur, in der sich die Tirade wie ein ritueller Bannfluch anhört: "Meine Angst vor dir war stets absolut: / Dein Schnurrbart, und was deine Luftwaffe tut, / Und deine Rednergesten, / Und dein arisches >Auge voll blauer Glut". Alissa Walser dagegen belässt es neudeutsch bei "Daddy", verzichtet weitgehend auf Reime und kann sich daher insgesamt eine griffigere Wortwahl leisten: "Vor dir hab ich immer nur Angst gehabt, / Vor deiner Luftwaffe, deinem Beamtenblabla, / Deinem gepflegten Schnauzbart, / Deinem strahlen Auge arischen Blaus". Das erspart uns manche Ungelenkigkeit, läuft aber zuweilen auch Gefahr, das Sperrig-Ungeheuerliche, mit dem Plath ihren Kindervers aufbricht, zu glätten. Doch gerade in derart verstörenden Momenten trifft uns das Familiendrama, das darin nach Ausdruck drängt. Wenn Worte für Plath Äxte sind, sollte auch die Übersetzung deren Schlagkraft durchaus stärker einsetzen.
Im Vorwort erklärt die Tochter Frieda Hughes, wie die "Ariel"-Texte sämtlich die "Vision und Erfahrung" der Mutter "in einer von großem emotionalen Aufruhr bestimmten Zeit ihres Lebens" abbilde. Umso bemerkenswerter ist es, wie jetzt die ursprüngliche Folge zeigt, dass der Zyklus klar mit Hoffnungszeichen endet. Der letzte Text heißt "Überwintern" und geht häuslich-ländlichen Verrichtungen nach, die in der unwirtlichen Jahreszeit das Überleben sichern. Plaths vielgebrauchtes Sinnbild für die Wirrungen des Menschenlebens sind die Bienen. Ihnen gilt auch hier in diesem letzten Text, den sie zur Publikation vorbereitet hatte, alle Hoffnung: "Sie leben von Raffinade statt Blumen. / Sie nehmen es, wie es kommt. Die Kälte setzt ein."
Sylvia Plath: "Ariel". Urfassung. Gedichte. Englisch/deutsch. Übertragung und Nachwort von Alissa Walser. Vorwort von Frieda Hughes. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 227 S., geb., 22,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main