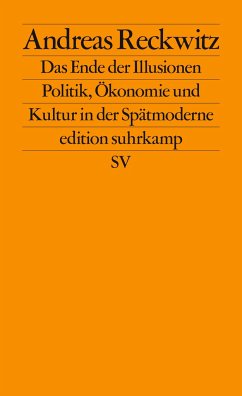Noch vor wenigen Jahren richtete sich die westliche Öffentlichkeit in der scheinbaren Gewissheit des gesellschaftlichen Fortschritts ein: Der weltweite Siegeszug von Demokratie und Marktwirtschaft schien unaufhaltsam, Liberalisierung und Emanzipation, Wissensgesellschaft und Pluralisierung der Lebensstile schienen die Leitbegriffe der Zukunft. Spätestens mit dem Brexit und der Wahl Donald Trumps folgte die schmerzhafte Einsicht, dass es sich dabei um Illusionen gehandelt hatte.
Tatsächlich wird erst jetzt das Ausmaß des Strukturwandels der Gesellschaft sichtbar: Die alte industrielle Moderne ist von einer Spätmoderne abgelöst worden, die von neuen Polarisierungen und Paradoxien geprägt ist - Fortschritt und Unbehagen liegen dicht beieinander. In einer Reihe von Essays arbeitet Andreas Reckwitz die zentralen Strukturmerkmale der Gegenwart pointiert heraus: die neue Klassengesellschaft, die Eigenschaften einer postindustriellen Ökonomie, den Konflikt um Kultur und Identität, die aus dem Imperativ der Selbstverwirklichung resultierende Erschöpfung und die Krise der Liberalismus.
Tatsächlich wird erst jetzt das Ausmaß des Strukturwandels der Gesellschaft sichtbar: Die alte industrielle Moderne ist von einer Spätmoderne abgelöst worden, die von neuen Polarisierungen und Paradoxien geprägt ist - Fortschritt und Unbehagen liegen dicht beieinander. In einer Reihe von Essays arbeitet Andreas Reckwitz die zentralen Strukturmerkmale der Gegenwart pointiert heraus: die neue Klassengesellschaft, die Eigenschaften einer postindustriellen Ökonomie, den Konflikt um Kultur und Identität, die aus dem Imperativ der Selbstverwirklichung resultierende Erschöpfung und die Krise der Liberalismus.

Es gibt keinen weichen Kapitalismus: Andreas Reckwitz über eine
neue Übergangsphase und sein Buch „Das Ende der Illusionen“
INTERVIEW: JENS BISKY
Andreas Reckwitz, geboren 1970 in Witten an der Ruhr, lehrt Vergleichende Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Für sein Buch „Die Gesellschaft der Singularitäten“ (2017) erhielt er gerade den Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Sachbuch mit der Begründung zu, es liefere „einen wertvollen, originellen Schlüssel für das Verständnis unserer spätmodernen Existenz“. In einem Berliner Café gibt Reckwitz Auskunft über sein neues Buch „Das Ende der Illusionen“, in dem er seine Untersuchungen zu Politik, Ökonomie und Kultur in der gegenwärtigen Gesellschaft fortsetzt.
SZ: Herr Reckwitz, wir durchleben eine politische und kulturelle Krise. Sie sagen, man verstehe sie nicht, wenn man allein auf die klassische Rechts-Links-Unterscheidung sehe. Warum?
Andreas Reckwitz: Wir leben in einer Phase eines grundlegenden politischen Paradigmenwechsels. Der ist nicht im Schema links versus rechts zu fassen – und das ist gar nicht neu. Wenn wir auf die politische Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg zurückblicken, dann ging es nur oberflächlich besehen immer um links versus rechts, also Sozialdemokraten gegen Konservative. Schaut man genauer, erkennt man, dass grundsätzliche politische Ordnungsparadigmen regelmäßig über das gesamte politische Spektrum hinweg geteilt wurden. An bestimmten Punkten wird das herrschende Paradigma dann umgestoßen und ein neues setzt sich durch. Das war nach 1945 so und in den Siebzigerjahren – und das ging quer durch das gesamte politische Spektrum. Wir befinden uns momentan in einer neuen, dritten Übergangsphase.
Was zeichnete das Paradigma nach 1945 aus?
Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte ein Regulierungsparadigma. Im Rahmen der industriellen Moderne ging es darum, über staatliche Wirtschaftssteuerung und den Wohlfahrtsstaat das Soziale zu steuern, darin waren sich alle einig. Das war auch mit bestimmten kulturelle Ordnungsvorstellungen verbunden, etwa dem skandinavische „Volksheim“ oder Ludwig Erhards „formierter Gesellschaft“. Dieses große Regulierungsparadigma wirkte bis in die Siebziger hinein.
Und dann war es, schreiben sie, so erfolgreich, dass es in eine Krise geriet.
Ein politisches Paradigma hat eine gewisse Zeit, in der es ein erfolgreicher politischer Problemlöser ist. Auch das Regulierungsparadigma funktionierte einige Jahrzehnte gut, es gab Vollbeschäftigung, soziale Integration. Aber in den Siebzigerjahren stieß es an seine Grenzen. Es hat auch nicht unbeabsichtigte Prozesse in Gang gesetzt, die zu seinem Untergang beigetragen haben.
Welche?
Es kam zu einer Doppelkrise, einer ökonomischen und einer kulturellen. Das nationale Wachstumsregime des Fordismus und Keynesianismus hatte sich erschöpft, begleitet von Massenarbeitslosigkeit und Deindustrialisierung. Auf der anderen Seite gab es auch eine kulturelle Krise. Den neuen Akademikern schien die formierte Gesellschaft überreguliert: Stichwort 1968 und die Selbstverwirklichungsrevolution.
Es folgte, sagen Sie, ein Dynamisierungsparadigma. Ist das ungefähr das, was wir sonst „Neoliberalismus“ nennen?
Ab 1980 findet ein großer Paradigmenwechsel statt. Er fällt mit dem Ende der industriellen Moderne zusammen. Der Neoliberalismus war ein Teil dieser Entwicklung, aber nicht alles. Grundsätzlicher wurde das Regulierungs- durch ein großes Dynamisierungsparadigma abgelöst: Dies hat einen neoliberalen und einen linksliberalen Flügel. Nun ging es nicht mehr um Ordnungsregulierung, sondern um Ordnungssprengung: eine Öffnung zugunsten der Märkte einerseits, der individuellen und kollektiven Identitäten andererseits. Das war eine Bewegung umfassender Liberalisierung, eng mit der Globalisierung verknüpft, von Thatcher bis Schröder.
Und warum ist das jetzt in der Krise? Herrschen nicht weiter sowohl linksliberale Eliten als auch ein neoliberaler Marktradikalismus?
Sicher, aber in den vergangenen Jahren traut man dem dynamisierenden Liberalismus ganz offenbar immer weniger Problemlösung zu. Der Aufstieg des Populismus ist ein Symptom dafür, die Finanzkrise war ein anderes. Die Debatten darüber, dass der enthemmte Neoliberalismus die Stabilität gefährdet und sozialen Ungleichheiten fördert, sind breit. Auch die kulturelle Dynamisierung hat nicht beabsichtigte Nebenfolgen: Hinter der Kultur individueller Selbstentfaltung breiten sich Partikularinteressen aus. Viele fragen sich, wo es eigentlich noch einen Ort für das Gemeinwohl gibt, wenn die Individuen vor allem versuchen, ihre subjektiven Rechte durchzusetzen oder man die Steuerung den Märkten überlässt. Diese Debatten sind Anzeichen einer Überdynamisierungskrise, von links bis rechts.
Der gegenwärtige kulturelle Kapitalismus scheint Ihnen härter als der Industriekapitalismus. Warum?
Der alte Industriekapitalismus wird seit den Achtzigern mehr und mehr durch einen kognitiven und kulturellen (teilweise auch digitalen) Kapitalismus überlagert. Indem die Güter nun „immaterieller“ werden – symbolische Güter, Erlebnisse, Dienste –, wird der Kapitalismus aber keineswegs weicher, ganz im Gegenteil. Der Grund ist, dass Märkte für kognitive und kulturelle Güter Winner-take-all-Märkte sind, in denen es extreme Ausschläge von Erfolg und Misserfolg gibt. Man sieht es am Kunstmarkt. Es gibt einige wenige Künstler, die reüssieren. Und daneben die vielen, denen das nicht gelingt. Ein anderes Beispiel wären die Immobilienmärkte. Da geht es schon lange nicht mehr um den Nutzen der einzelnen Wohnung, sondern um die Lage, den Blick, um soziale und symbolische Aspekte der Wohnung: einige Immobilien in den Metropolen haben dann extremen Wert, während die Häuser in der Provinz kaum etwas wert sind.
Auch im Industriekapitalismus der Nachkriegszeit besaßen einige die großen Vermögen, Fabriken und andere besaßen derlei nicht. Was hat sich geändert?
Sicher gibt es im Kapitalismus immer Ungleichheiten, wenn er ungeregelt ist. Um den kulturellen Kapitalismus zu verstehen, muss man sich die besonderen Güter- und Marktstrukturen ansehen. Die Industriemärkte sind gewissermaßen sachlicher, es geht primär um Preise und Funktionen. Märkte für kulturelle Güter neigen stärker zu Extremausschlägen, weil sie auf symbolischen und emotionalen Bewertungen beruhen. Wer hier Erfolg hat, hat es im Übermaß. Entsprechend viele reisen dann nach Venedig, wollen „Game of Thrones“ sehen, oder man zahlt einen exorbitanten Preis für ein Werk von Gerhard Richter.
Im Industriekapitalismus reichte es, diszipliniert arbeiten zu gehen, seine Familie zu ernähren – dann gewinnt man soziale Anerkennung. Das reicht heute nicht mehr aus?
Durch die Postindustrialisierung der Ökonomie seit den Siebzigern hat sich einiges grundsätzlich verändert. Wir haben in allen westlichen Ländern einen massiven Rückgang der Erwerbstätigkeit im industriellen Sektor. Stattdessen entwickelt sich eine Spreizung: Einerseits eine expandierende Wissensökonomie für Hochqualifizierte, andererseits der neue Servicesektor einfacher Dienstleistungen. Mit dieser ökonomischen Auseinanderentwicklung verändert sich die Sozialstruktur. Auf der einen Seite gibt es eine aufsteigende neue, akademisch gebildete Mittelklasse, auf der anderen Seite steht die prekäre Klasse, die Service Class. Und weiterhin existiert dazwischen die traditionelle Mittelklasse. In der neuen Mittelklasse, die in den Metropolregionen lebt und in mancher Hinsicht kulturell tonangebend geworden ist, genügt es nun tatsächlich nicht mehr, einfach zum Broterwerb zu arbeiten. Postmaterielle Werte wie Selbstentfaltung spielen hier auch in der Arbeitswelt eine Rolle; und die „Attraktivität“ des Berufs ist ein komplexerer Wert als nur die Höhe des Gehaltsschecks.
Die Öffentlichkeit hat meist die wenigen Reichen im Blick und das Dienstleistungsproletariat. Sie wollen mehr über die Mittelklasse reden. Wozu das?
Die Fixierung auf die Superreichen, das eine Prozent ganz oben, macht die Konfliktlinien innerhalb der 99 Prozent unsichtbar. Und hier ist die Aufspaltung der Mittelklasse zwischen der neuen und der alten Mittelklasse ganz zentral, um gegenwärtige Spannungen zu begreifen.
Welche?
Es sind nicht unbedingt Verteilungskonflikte, sondern mehr Konflikte um gesellschaftliche Werte, Weltbilder und Lebensgefühle. Die neue, urbane Mittelklasse ist mit den Liberalisierungsprozessen der vergangenen Jahrzehnte verbunden, sie ist globalisierungsfreundlich und stark bildungsorientiert, teilt Werte wie Flexibilität, Unternehmertum, Emanzipation, Diversität. Die traditionelle Mittelklasse befindet sich eher im kleinstädtischen Raum, vertritt eher Werte wie Sesshaftigkeit, Ordnung, Verwurzelung, und ist eher globalisierungsskeptisch. Sie sieht sich durch den Liberalisierungs- und Mobilisierungsschub in die kulturelle Defensive gedrängt – und beginnt jetzt ja auch teilweise zurückzuschlagen.
Ist der Populismus ein Widerstandsversuch der alten Mittelklasse?
Wenn man sehr pointiert formulieren will, ja. Arlie Russel Hochschild hat das in „Strangers in their Own Land“ sehr schön herausgearbeitet. Die Anhänger der populistischen Rechten sind gar nicht so sehr die sozial Abgehängten der Unterklasse als Teile der traditionellen Mittelklasse. Man sieht sich dort teilweise entwertet, als Leidtragender des sozialen Wandels. Dort können sich die Ordnungswerte radikalisieren bis hin zu nostalgischen Visionen von nationaler Schließung.
Wie verhält sich die soziale Schichtung zu Kategorien wie Gender und Herkunft?
Wenn man die spätmodernen Gesellschaften verstehen will, ist aus meiner Sicht die Klassendifferenz die primäre, die Unterscheidungen nach Geschlecht oder Ethnizität sind sekundär, sie knüpfen daran an.
Der Banker aus Indien steht dem Banker aus Frankfurt näher als dem Handwerker aus Mumbai?
Genau, das gilt selbst global. Keinesfalls stellen die „Migranten“ also einen Block neben den Einheimischen dar, sondern sie sind von vornherein Teil der differenzierten Sozialstruktur: es gibt migrantische Anteile in der neuen Mittelklasse, in der traditionellen Mittelklasse und in der prekären Klasse. Ähnliches gilt für das Geschlecht. Es scheint mir nicht sinnvoll vom „Aufstieg der Frauen“ und der „Krise des Mannes“ zu reden. Das stellt sich in jeder der drei Segmente sehr anders dar.
Sie hoffen auf einen „einbettenden Liberalismus“. Was spricht eigentlich genau gegen die Annahme, der Populismus werde das nächste dominierende Paradigma? Dann würde die Reihe schlicht lauten: Regulierung – Dynamisierung – verschärfte Ordnung.
Man kann natürlich kaum eine Prognose stellen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Populismus das nächste Paradigma sein wird. Ich hoffe das nicht und vermute es auch nicht. Die beiden bisher dominierenden Paradigmen waren jeweils Integrationsparadigmen, die in ihren besten Zeiten für viele attraktiv waren. Der rechte Populismus aber ist alles andere als integrativ, er wirkt vielmehr selbst polarisierend. Die Unterscheidung von Freund und Feind ist sein Lebenselixier. Die Fixierung der öffentlichen Debatte auf den Populismus tut uns aber nicht gut. Darüber vernachlässigen wir die eigentliche Aufgabe: nämlich den Liberalismus der vergangenen Jahrzehnte grundsätzlich zu transformieren.
Was soll ich mir unter einem „einbettenden Liberalismus“ vorstellen?
Das wäre einerseits ein neues Regulierungsparadigma, das aber die Dynamisierung nicht abwürgt, aber eben „einbettet“. Es steht hier eine Regulierung der Märkte an, etwa wenn es um Infrastruktur, Wohnen, Grundsicherung geht. Aber es geht auch um kulturelle Integration, um eine Sicherung von Grundwerten. Man denke nur an die Verrohung der Kommunikation im Internet.
Ihnen geht es ums Allgemeine. Was ist damit gemeint?
Die Herausforderung müsste sein, die Heterogenität, die die spätmoderne Gesellschaft auszeichnet und die nicht rückgängig gemacht werden kann oder sollte, die Heterogenität der Lebensstile, der Herkünfte, einzubetten in einen Raum öffentlicher Güter und verbindlicher Regeln, die für alle gelten. Die ökonomische und die kulturelle Frage sind hier zwei Seiten der gleichen Medaille.
Sie reden davon, dass auch das „Ich“ Grenzen des Wachstums habe.
Wir erleben die Schattenseiten der Überdynamisierung nicht nur auf der Ebene der Gesellschaft, sondern auch des Individuums. Der Wandel von Werten der Selbstdisziplinierung hin zur Selbstentfaltung war zunächst ein Emanzipationsprozess. Jetzt sieht man, dass man an Grenzen stößt, wenn es darum geht, das Leben nach den eigenen positiven Emotionen, nach Singularitätswünschen auszurichten. Die Kehrseite ist nämlich ein Grassieren negativer Emotionen – Enttäuschung, Wut, Trauer –, wenn man die hohen Ansprüche an das eigene Lebensglück im Vergleich zu den vermeintlich glücklicheren Anderen nicht erreicht.
Kommen da alte Werte zurück wie Disziplin und Pflichterfüllung?
Nicht notwendigerweise. Sehr stark wird es darum gehen, wie sehr sich Individuen von ihren Emotionen abhängig machen , den positiven wie den negativen. Der Boom von Praktiken wie Meditation und Achtsamkeit deutet ja darauf hin, dass man hier das Problem durchaus sieht. Eine Krux ist, wie es der spätmoderne Kultur angesichts des Selbstoptimierungsinteresses gerade in der neuen Mittelklasse gelingt, mit negativen Unverfügbarkeiten umzugehen, also mit jenem, was man nicht in der Hand hat: Niederlagen, Trennungen, unheilbare Krankheiten, Tod. Damit wird der moderne Fortschritts- und Steuerungsglaube herausgefordert.
Plagiat?
Am vergangenen Donnerstag wurden bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises in München Plagiatsvorwürfe gegen die Autorin eines in der Kategorie Sachbuch nominierten Buches öffentlich gemacht (SZ vom 9./10. November). Cornelia Koppetsch habe in „Die Gesellschaft des Zorns“ Passagen aus dem Buch „Die Gesellschaft der Singularitäten“ von Andreas Reckwitz zitiert, ohne diese Zitate kenntlich zu machen. Andreas Reckwitz hat gegenüber der SZ geäußert, er wolle sich zu dem Fall nicht äußern.
SZ
Nur scheinbar ist das spätmoderne Ich weich gebettet: Andreas Reckwitz im Hamburger Bahnhof in Berlin.
Foto: laif
Andreas Reckwitz:
Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Suhrkamp Verlag,
Berlin 2019.
304 Seiten, 14 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Geteilte kulturelle Grundwerte müssen sein: Der Soziologe Andreas Reckwitz hat einige Wünsche an das linksliberale Milieu.
Einem größeren Publikum ist der Soziologe Andreas Reckwitz vor zwei Jahren mit seiner Diagnose einer "Gesellschaft der Singularitäten" bekanntgeworden. In ihr verbreite sich "großflächig eine soziale Logik der Singularisierung", die darauf hinauslaufe, dass qualitative Differenzen, Individualität, Unverwechselbarkeit, der Wunsch nach Selbstentfaltung und die Erwartung eines außergewöhnlichen Lebens das Signum der Zeit ausmachten. Reckwitz nennt das eine "Kulturalisierung der Lebensformen".
Mit dieser Diagnose beginnt auch das nun vorgelegte Buch. Das Hauptmotiv freilich besteht in der titelgebenden Figur eines "Endes der Illusionen". Gemeint ist die Illusion eines Liberalismus, der offensichtlich an die Grenzen seines eigenen Fortschrittsoptimismus gerate. Reckwitz dekliniert dies in fünf Aufsätzen durch. Zunächst unterscheidet er zwei Formen der Kulturalisierung, eine öffnende und eine eher essentialisierende. Daran schließt sich eine Klassenanalyse an, die eine neue Mittelklasse von einer alten Mittelklasse und einer prekären Klasse unterscheidet. Der dritte Aufsatz widmet sich einer Analyse des kognitiv-kulturellen Kapitalismus, hauptsächlich bestehend aus dem Nachweis, dass Produkte und Dienstleistungen neben dem Materiellen nicht nur kognitive Wertschöpfungsanteile haben, sondern zunehmend kulturelle dazukommen. Danach werden in zwei Kapiteln Lösungsperspektiven formuliert. Mit Ausnahme des ersten Kapitels sind die Aufsätze eigens für diesen Band verfasst worden.
Stärker als in dem Vorgängerbuch geht Reckwitz hier auch auf die Kosten einer singularistischen Lebensform ein: Sättigungserfahrungen, Steigerungslogiken und Konkurrenz der Singularitäten, Zwang zur Selbstoptimierung und nicht zuletzt das Zu-Markte-Tragen der eigenen Unverwechselbarkeit. Der Erfolg und die Anschlussfähigkeit dieser Diagnose hängen ganz offensichtlich damit zusammen, dass Reckwitz hier einen Nerv getroffen hat. Dem Rezensenten sind dabei Texte von Ulrich Beck aus den neunziger Jahren in den Sinn gekommen. Dessen süffige Diagnosen haben letztlich dem damaligen urban-rot-grünen Milieu die entscheidenden Chiffren der Selbstbeschreibung geliefert - nicht nur als Apologie des Eigenen inszeniert, sondern mit einer guten Portion Selbstkritik versehen. So ähnlich funktioniert auch der Ansatz von Reckwitz, der einen von kreativwirtschaftlichen, linksliberalen und -libertären Elementen geprägten Lebensstil ins Visier nimmt, ein Milieu mit ziemlicher semantischer Durchsetzungskraft. Am Erfolg der Diagnose kann man sehen, wie anerkennungsbedürftig auch dieses Milieu ist.
Und wie damals wird heute in der fachwissenschaftlichen Kritik öfter darauf hingewiesen, dass Reckwitz' Diagnose womöglich nur für dieses Milieu taugt. Reckwitz geht auf solche Kritiken nicht explizit ein, aber als eine implizite Reaktion darauf kann man das neue Buch doch lesen. Denn den Fokus richtet er nun auf die Grenzen der diagnostizierten Lebensform: auf intrinsische Grenzen, die sich deren Steigerungslogik und Sättigungsgrad verdanken, und auf äußere Grenzen, die vor allem mit der Tendenz zur Schließung eines an rechtem und linkem Populismus und entsprechenden identitären Angeboten orientierten Milieus zu tun haben. Reckwitz sieht sowohl in einer übertriebenen Kultur der Öffnung als auch in der übertriebenen Kultur der Schließung Reaktionen auf das Ende der industriegesellschaftlichen Sicherheiten, Institutionenarrangements und Anerkennungsbedingungen unterschiedlicher Klassen. Letztlich relativiert er damit seine Diagnose einer Gesellschaft der Singularitäten, indem er explizit auf deren milieuspezifische Basis verweist.
Bestechend sind Reckwitz' Beschreibungen des kognitiv-kulturellen Kapitalismus und seiner Folgen, vor allem der Hinweis darauf, dass es nicht nur um kognitive Güter geht, sondern explizit um deren Kulturalisierung. Hier gelingen ihm überzeugende Einsichten und Diagnosen. Aber wo er Lösungsvorschläge macht, wird die Begrenztheit seines soziologischen Modells sichtbar.
In dem Kapitel über "erschöpfte Selbstverwirklichung" ist Reckwitz ganz in der Binnenlogik jenes Milieus, in dem wohl die stärksten Resonanzen auf seine Diagnosen erwartbar sind. Nachvollziehbar werden die Belastungen des spätmodernen Selbst und seine Enttäuschungen beschrieben. Als Remedium freilich wird aus der soziologischen Diagnose schlichte Ratgeberliteratur: Man solle doch versuchen, die Widersprüche auszuhalten, eine stärkere Distanz zu den eigenen Emotionen einnehmen und solidarische Dauerbeziehungen aufbauen. Hört sich gut an, behauptet aber, dass die Erschöpfung des Selbst durch guten Willen aufgehoben werden kann. War das nicht die Logik, die zu jener Überlastung geführt haben soll?
Das letzte Kapitel, in dem politische Lösungen andiskutiert werden, bleibt ähnlich unentschieden. Reckwitz argumentiert, dass der "apertistische", also öffnende Liberalismus der urbanen linksliberalen Singularier sich zugunsten eines "einbettenden Liberalismus" zurücknehmen solle. Ganz ähnlich wie das erschöpfte Selbst müsste solcher Liberalismus Distanz zu den eigenen Fortschrittsideen einüben und kulturelle Regelwerke schaffen, um so etwas wie kollektive Identitäten zu ermöglichen.
Das ist logisch gedacht: Wenn der linksliberale Universalismus der "singulären" Milieus eine Überforderung für die anderen Klassen ist, muss das Allgemeine eben etwas entgegenkommender, inkludierender eingerichtet werden. Auf der Ebene der Herstellung wirtschaftlicher und materieller Sicherheit ist da etwas dran - aber auf der Ebene der kulturellen Differenzen bleibt auch dieser Vorschlag auf dem Terrain der Ratgeberliteratur.
Das Buch schließt mit einem Appell an die "Arbeit an kulturellen Grundwerten und einer von allen geteilten kulturellen Praxis sowie deren Vermittlung und Durchsetzung" - was ein wenig an Leitkultur erinnert. Reckwitz' Rede von den "Regeln", auf die man sich zu einigen habe, ist dabei in schönstem scholastischem Habitus verfasst, wie Pierre Bourdieu gesagt hätte: Der Intellektuelle stellt sich die Ordnung der Gesellschaft als das Problem der Konsistenz verbindlicher Regeln vor. Schon die Frage, warum sich wer in welcher Situation an die Regel halten kann und will, kommt hier nicht vor, obwohl Reckwitz betont, sein Liberalismus rechne "mit der Eigendynamik und Nichtdeterminierbarkeit der Gesellschaft". Aber worin soll sich dieser neue Liberalismus dann einbetten? In den Staat? In den Nationalstaat? Oder doch in die Gesellschaft? Und was heißt das dann?
Es ist tatsächlich nur ein kurzes lucidum intervallum, in dem jene Eigendynamik und Nichtdeterminiertheit aufscheint - ist doch gerade das die gesellschaftstheoretische Herausforderung, die eine kulturalisierende Soziologie wie die von Reckwitz gar nicht recht sehen kann. So rechnen die Lösungsvorschläge von Reckwitz nicht wirklich mit der Eigendynamik politischer, ökonomischer, rechtlicher und nicht zuletzt medialer Logiken. Nur deshalb sehen sie so plausibel aus. Sie tun so, als könne man kulturelle Selbstverpflichtungen dekretieren, als könnten sich Lebensformen durch guten Willen ändern - und treffen so das Selbstbild genau jenes Milieus, an dem die Diagnose ansetzt, welche eben dieses Milieu so beeindruckt. Als Begriff von Gesellschaft bleibt dann nur die Common-Sense-Idee des "Wir alle", bestimmt durch von allen geteilte Regeln.
So stellt man sich Gesellschaftsdesign vielleicht als kreativwirtschaftlichen Akt vor, aber soziologisch kann das nicht überzeugen. Von der Eigendynamik und Nichtregierbarkeit einer funktional differenzierten, dezentralen, bisweilen steuerungsresistenten Gesellschaft wird man vor diesem Hintergrund eher überrascht werden. Selbsterschöpfung ist dann geradezu vorprogrammiert.
ARMIN NASSEHI
Andreas Reckwitz:
"Das Ende der Illusionen". Politik, Ökonomie und
Kultur in der Spätmoderne.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 305 S., br., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Nach der wegweisenden Studie Gesellschaft der Singularitäten beschäftigt sich Andreas Reckwitz in seiner Essaysammlung mit dem Strukturwandel der Gesellschaft. Der Soziologe seziert die neue Klassengesellschaft, die postindustrielle Ökonomie, die Konflikte um Kultur und Identität und den Imperativ der Selbstverwirklichung, woraus Erschöpfung und Demokratiemüdigkeit entspringen.« DIE ZEIT 20191227