Oktober 1962 - Zwischen den USA und der UdSSR herrscht der Kalte Krieg. US-Piloten entdecken während ihrer Kontrollflüge auf Kuba stationierte sowjetische Atomraketen. Ihr Ziel: die USA. Wenn es Präsident John F. Kennedy (Bruce Greenwood) nicht gelingt, zwischen beiden Weltmächten zu vermitteln, liegt ganz Amerika bald in Schutt und Asche. Heftig bedrängt von Militär und den Geheimdiensten, ringt Kennedy um eine Lösung. An Kennedys Seite: Sein Bruder Robert (Steve Culp) und Präsidentschaftsberater Kenny ODonnell (Kevin Costner) die fieberhaft versuchen, den Ausbruch des 3.Weltkriegs zu verhindern. Jede Entscheidung könnte die falsche sein. Die Zeit ist knapp. Sie haben nur eine Frist von 13 Tagen...
Bonusmaterial
- Audiokommentar von Cast & Crew - Historischer Audiokommentar u.a. von John F. Kennedy, Sergei Chruschtschow und Robert McNamara - Dokumentation: Roots of the Cuban Missile Crisis - Making of: Bringing History to the Silver Screen
Sie brachten die Atmosphäre durcheinander und retteten doch das gute Wetter: Der Film "Thirteen Days" aus historischer Sicht
Bei der Londoner Premiere von "Thirteen Days" richtete Kevin Costner einen Appell an den abwesenden Premierminister Blair: Er müsse sich den Film über die Kuba-Krise im Oktober 1962 unbedingt ansehen. Der amerikanische Schauspieler verwies auf die immer noch von Atomwaffen ausgehenden Gefahren und gab der Hoffnung Ausdruck, der Polit-Thriller werde die Sinne für die seiner Ansicht nach andauernde nukleare Bedrohung der Welt schärfen.
Spielfilme wie "Schindlers Liste" oder "Saving Private Ryan" prägen in der Gegenwart die Bilder, die wir uns von historischen Begebenheiten machen. Doch heißt das, daß wir uns in den Zeiten des medialen Overkills mit diesen Interpretationen abfinden müssen? Sind wir gezwungen, wie einer der führenden Historiker des Vietnamkrieges resignierend zu bekennen, daß man wohl auf Steven Spielberg warten müsse, um der Mehrheit der Amerikaner ein halbwegs realistisches Bild vom Krieg in Indochina zu vermitteln? In der Moderne, so hat uns Albert Camus gelehrt, sind wir durchaus in der Lage, Sisyphos als glücklichen Menschen zu begreifen. In erster Linie die Historiker müssen sich der Herausforderung stellen und die von Hollywood aufgetürmten Bilderberge nicht nur erklimmen, sondern auch - wo nötig - mit Entschlossenheit abtragen.
Wie also verhält sich Roger Donaldsons Film "Thirteen Days", der auf der Berlinale zu sehen war (F.A.Z. vom 13. Februar 2001) und nun in die deutschen Kinos gekommen ist, zur historisch belegten Realität? Die Erforschung der Kuba-Krise hat in den letzten zehn Jahren immense Fortschritte gemacht. Kein Ereignis des Kalten Krieges ist derart intensiv beleuchtet worden. Hinter diesem Interesse stand stets der - dem Anliegen Costners nicht unähnliche - Wunsch, aus dem vermeintlich gefährlichsten Moment der Supermächtekonfrontation für die Zukunft zu lernen.
Zwei glückliche Umstände haben unser Wissen über die Kuba-Krise nachhaltig vergrößert: Kennedy hat zum einen die Beratungen seines Krisenstabes heimlich auf Tonband aufgezeichnet. Die mittlerweile edierten Abschriften sind eine historische Quelle ersten Ranges. Sie ermöglichen intime Einblicke in den Entscheidungsfindungsprozeß einer demokratisch verfaßten Weltmacht während einer schweren außenpolitischen Krise. Zum anderen verfügen wir aus den russischen Archiven unterdessen über eine Reihe von aussagekräftigen Dokumenten sowjetischer Provenienz, die das Krisenverhalten Chruschtschows intensiv beleuchten. Die Kuba-Krise ist somit auch quellenmäßig keine rein amerikanische Angelegenheit mehr.
Doch diesen Eindruck hinterläßt "Thirteen Days". Es geht dem Film nicht so sehr um die Kuba-Krise als vielmehr um die Auseinandersetzungen innerhalb der amerikanischen Regierung. Wir erleben John F. Kennedy als Präsidenten, der, letztlich nur durch seinen Bruder Robert und seinen Intimus Kenneth P. O'Donnell (Kevin Costner) beraten, einen konsequenten Friedenskurs steuert. Die Falken im Pentagon - an erster Stelle General Curtis E. LeMay, der Oberkommandierende der Luftwaffe - hätten dies jedoch als Ausverkauf amerikanischer Interessen betrachtet. Folgte man dem Film, so stand Kennedy im Oktober 1962 kurz vor der Entmachtung. Nur durch großes Geschick sei es dem Präsidenten gelungen, dies zu vereiteln. Der Kampf in Washington sei mindestens ebenso schwer wie die Auseinandersetzung in der Karibik gewesen.
Die historische Realität stellte sich jedoch ganz anders dar: Gewiß gab es an unterschiedlichen Wegesmarken während der Krise Auseinandersetzungen zwischen Militärs und zivilen Entscheidungsträgern, so zum Beispiel in der Frage der Durchführung der Blockade um Kuba. Doch bestand in keiner Sekunde auch nur der Hauch eines Zweifels an der Unterordnung der Militärs gegenüber der politischen Führung. Im übrigen - dies sei für alle Verschwörungstheoretiker angemerkt - existiert auf dieser Welt wohl keine Nation, in deren gesamter Disposition und Tradition ein Militärputsch weiter von der Sphäre des Möglichen entfernt ist als in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Doch zurück zur Supermächtekonfrontation: Der Film vergibt durch seine ausschließliche Ausrichtung auf Washington die große Chance, die abstruse These von der drohenden Entmachtung des Präsidenten durch die Außenwahrnehmung des Kremls plausibel erscheinen zu lassen. Unlängst deklassifizierte Dokumente belegen nämlich, daß Chruschtschow während des gesamten Verlaufs der Krise eine tiefsitzende Furcht vor einem Putsch in Washington hatte. Die ideologischen Scheuklappen des Generalsekretärs der KPdSU ließen ihn glauben, daß Kennedy, den er als schwachen Präsidenten einschätzte, von einer Junta aus Generalität und Wirtschaftskapitänen gestürzt werden könne. Chruschtschows Befürchtungen wurden noch verstärkt durch eine Vielzahl von Geheimdienstberichten, die zum Teil zufällige Unterhaltungen Unbeteiligter in Washingtoner Bars als Erkenntnisse aus dem engsten Führungszirkel im Weißen Haus ausgaben.
Auf Basis dieser Fehlinformationen und im Einklang mit seinem ideologisch getrübten Blick befahl Chruschtschow noch vor Eintreffen des geheimen Raketentauschangebots, das Robert Kennedy am 27. Oktober 1962 über den sowjetischen Botschafter in Washington unterbreitet hatte, den Abzug der Raketen von Kuba. Die akute Phase der Krise war vorüber. Vereinbarungsgemäß zogen die Vereinigten Staaten im April 1963 die Jupiter-Raketen aus der Türkei ab, die dort unter dem Oberbefehl der Nato standen und somit nicht als alleinige Verfügungsmasse der amerikanischen Regierung angesehen werden konnten.
Während der Film über den kubanisch-türkischen Kuhhandel berichtet, blendet er zwei grundlegende Faktoren aus seiner Betrachtung aus: die Vorgeschichte der Krise sowie ausgerechnet die dem Praeceptor mundi Costner so wichtige Rolle der Nuklearwaffen. Da die Kuba-Krise in "Thirteen Days" nur als Folie für die inneramerikanischen Auseinandersetzungen genutzt wird, fehlt es gänzlich an der Einbettung in die größeren Zusammenhänge des Kalten Krieges, ohne die sich jedoch die Krise gleichsam im luftleeren Raum abspielt.
Mit keinem Wort wird auch nur angedeutet, daß Kuba für die Kennedy-Brüder nach der gescheiterten Landung in der Schweinebucht im April 1961 zu einer veritablen Obsession geworden war. Auf allen Ebenen bis hin zu Attentatsversuchen gegen Fidel Castro versuchten sie, die Scharte auszuwetzen. Die amerikanische Aggressivität gegen den Inselstaat 150 Kilometer vor der Küste Floridas gehört ebenso zur Vorgeschichte der Kuba-Krise wie die Verlautbarung der Vereinigten Staaten im Oktober 1961, daß sie trotz aller entgegenlautender Versicherungen aus Moskau der UdSSR im Nuklearbereich weit überlegen seien. Durch diesen Befreiungsschlag, der vor dem Hintergrund der andauernden Berlin-Krise zu verstehen ist, entzog Kennedy seinem Gegenspieler im Kreml das Fundament der gesamten Außenpolitik. Seit dem Flug des Sputnik im Oktober 1957 hatten die Sowjets wider besseres Wissen stets die strategische Überlegenheit bei den Kernwaffen für sich reklamiert. Kennedy hatte überzogen; er hatte seinen Gegner in die Ecke gedrängt. Chruschtschow blieb nur eine Alternative: erneutes öffentliches Eingeständnis der nuklearen Zweitrangigkeit oder Versuch des raschen Ausgleichs. Wer den Kremlherrn kannte, konnte nicht an seiner Entscheidung zweifeln.
Während der Kuba-Krise waren die Vereinigten Staaten bei den strategischen Nuklearwaffen der UdSSR mit etwa 17 zu 1 überlegen. Aus sowjetischer Sicht drohte ein Enthauptungsschlag. Kennedy war jedoch in dieser konkreten Situation nicht gewillt, diese eklatante Überlegenheit politisch auszuspielen: Seine Todesangst vor Atomwaffen und seine Gewißheit, daß ein militärischer Zusammenstoß zwischen G.I.s und Rotarmisten unweigerlich in einem nuklearen Armageddon enden werde, ließen ihn während der Krise nahezu handlungsunfähig werden. Kennedy war im gesamten Verlauf der "Dreizehn Tage" der entschiedenste Vertreter einer defensiven Grundhaltung. Er war davon überzeugt, daß Chruschtschow jeden amerikanischen Vorstoß gegen Kuba mit einer gleichartigen Aktion gegen Berlin beantworten würde. Für den Präsidenten bestand aus seiner Sicht der Dinge also keine Möglichkeit, die Bedrohung auf Kuba auf militärische Weise zu beseitigen. Chruschtschow mußte jedoch dem Faktum der amerikanischen Überlegenheit im strategischen Bereich sowie vor Ort in der Karibik Tribut zollen. Auch er tat auf militärischer Ebene alles, um einen "Aufstieg zum Äußersten" (Clausewitz) zu vermeiden.
Selbst Zwischenfälle wie der unautorisierte Abschuß einer U-2-Aufklärungsmaschine über Kuba oder das Eindringen eines amerikanischen Flugzeuges in den sowjetischen Luftraum konnten die Kontrahenten nicht zum Losschlagen verleiten. Erneut erwies sich in einer zugespitzten Krisensituation, daß allein die Verfügungsgewalt über Nuklearwaffen stabilisierend wirkte. Das nur scheinbar fragile Abschreckungsgebäude hatte sich einmal mehr nicht nur als schlagwetterfest, sondern auch als erdbebensicher erwiesen.
Ohne die allgegenwärtige Präsenz von Kernwaffen, ohne die Gewißheit, daß ein Einsatz von Wasserstoffbomben stets ein nuklearer Holocaust globaler Dimension geworden wäre, hätte aus dem kalten sehr schnell ein heißer Krieg werden können. Es ist diese Lehre aus der Kuba-Krise, die heute noch - entgegen den Auffassungen von Kevin Costner und vielen wohlmeinenden Kernwaffengegnern - aktuell ist. Premierminister Blair wird sie auch in Zukunft beherzigen.
HARALD BIERMANN
Der Autor publizierte 1997 die Untersuchung "John F. Kennedy und der Kalte Krieg: Die Außenpolitik der USA und die Grenzen der Glaubwürdigkeit".
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main


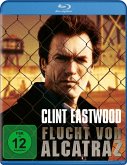






 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG