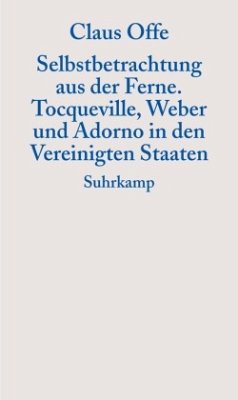Die drei Klassiker der europäischen Sozialtheorie, Alexis de Tocqueville, Max Weber und Theodor W. Adorno, haben in ihren Schriften, die während oder aus Anlaß ihrer Aufenthalte in Amerika entstanden sind, die Verhältnisse und Entwicklungen Europas immer vergleichend im Blick behalten. Zusammengenommen erstrecken sich ihre amerikanischen Beobachtungen auf einen Zeitraum von 120 Jahren.
Claus Offes Frankfurter Adorno-Vorlesungen haben diese einzigartige Konstellation zum Anlaß genommen, die Beobachtungen ihrerseits kritisch zu untersuchen und den Blick auf die fremde Kultur als Blick auf die eigene zu profilieren. Somit ergibt sich ein faszinierendes Vexierbild, das materialreich wie begrifflich luzide immer wieder neue theoretische wie historische Konstellationen auslotet. Dabei zielen die Beobachtungen, die die Amerikareisenden damals beschäftigten, auf Fragen, die gerade heute von großer Brisanz sind: Was können wir, die Bürger des »Alten Kontinents«, von den Verwandten auf der anderen Seite des Atlantiks lernen? Oder sie von uns? Wird Europa sich amerikanisieren oder umgekehrt Amerika sich europäisieren? Ist uns Amerika voraus, und wenn ja, im Guten oder im Schlechten? Aufgrund welcher Gemeinsamkeiten ist die Rede vom »Westen« überhaupt gerechtfertigt?
Claus Offes Frankfurter Adorno-Vorlesungen haben diese einzigartige Konstellation zum Anlaß genommen, die Beobachtungen ihrerseits kritisch zu untersuchen und den Blick auf die fremde Kultur als Blick auf die eigene zu profilieren. Somit ergibt sich ein faszinierendes Vexierbild, das materialreich wie begrifflich luzide immer wieder neue theoretische wie historische Konstellationen auslotet. Dabei zielen die Beobachtungen, die die Amerikareisenden damals beschäftigten, auf Fragen, die gerade heute von großer Brisanz sind: Was können wir, die Bürger des »Alten Kontinents«, von den Verwandten auf der anderen Seite des Atlantiks lernen? Oder sie von uns? Wird Europa sich amerikanisieren oder umgekehrt Amerika sich europäisieren? Ist uns Amerika voraus, und wenn ja, im Guten oder im Schlechten? Aufgrund welcher Gemeinsamkeiten ist die Rede vom »Westen« überhaupt gerechtfertigt?

Urteilen und Reisen: Claus Offes „Selbstbetrachtung aus der Ferne”
Die jüngst in Mainz beim Besuch von George W. Bush erklungenen Einheitsbekundungen sollten nicht darüber hinwegtäuschen: Amerika und Europa, die einander immer mehr ähneln, werden sich immer fremder. Gerne und viel wird von dieser Seite des Atlantiks aus über Amerika geurteilt. Vier Varianten des Urteils über Amerika unterscheidet Claus Offe in seiner Schrift „Selbstbetrachtung aus der Ferne”.
Dass sich aber Europas Intellektuelle in ihrer Mehrzahl ein eigenes Bild gemacht hätten, dass sie eine Ortsbesichtigung vorgenommen hätten, dass die Erfahrung des Neuen mit Menschen, Sitten und Räumen sie verändert hätte - das kann und will auch Offe nicht behaupten. Für die einen sind die USA in positivem Sinne Europas Zukunft, für die anderen das Reservoir guter Kräfte und Traditionen, die Europa längst verloren hat. Dann gibt es die Amerikakritiker: Sie erkennen in Amerika das Schreckbild
der Zukunft eines „amerikanisierten” Europas.
Und schließlich ist das Bild „eines rohen, unzivilisierten, kulturell und institutionell zurückgebliebenen Gesellschaftsgebildes” verbreitet. Letzteres nennt Offe den Antiamerikanismus. Im Guten wie im Schlechten gleichen sich die Haltungen der kontinentalen Denker gegenüber der Neuen Welt - was nicht heißt, dass sie Amerika kennen würden. Denn zuerst sehen sie immer sich selbst, gespiegelt im anderen.
Einige Neugierige aber gab es. Sie haben das Land bereist, die Augen geöffnet und dazugelernt. Sie haben unterschiedliche Schlüsse gezogen und darüber geschrieben. Alexis de Tocqueville, Max Weber und Theodor W. Adorno waren drei dieser Reisenden, als Entdecker oder als Flüchtlinge. Weber war nur dreizehn Wochen, Adorno dagegen elf Jahre da, und Tocqueville, dem wir das größte aller Amerikabücher verdanken, blieb neun Monate. Am Ende gibt Offe, der Adornos dialektischer Schule entstammt, Tocqueville den Vorzug. Er nennt ihn einen „Meister der Ambivalenz, der dialektischen Volten, der gleichzeitigen Betrachtung beider Seiten einer Medaille”, dem „keiner der beiden späteren Amerikareisenden” gleichkomme.
Bei Tocqueville, der wie ein ganzes „Autorenkollektiv” schreibt und kunstvoll seine Selbstwidersprüche verarbeitet, entdeckt Offe Züge, die ihn an Walter Benjamin erinnern. Tocqueville tritt dem Leser als „multiples Selbst” entgegen, aristokratischer Moralist, radikaler Demokrat und kalter Soziologe in einem. Er verliert die Angst vor der Demokratie und wird zum klassischen Liberalen, weil ihn die tägliche Erfahrung in Amerika lehrt, dass die Liebe zur Freiheit die Exzesse der Gleichheit kanalisieren kann: Das amerikanische Volk fand zur Demokratie ohne Revolution, die Demokratie war von Anfang an da, ohne die zerstörerische Dynamik, die der Autor in seinem Buch über die Französische Revolution analysiert.
Weber und die Eliteuniversität
Auch wenn Tocqueville 1831/32 von der Mikrotyrannei des Erwerbslebens spricht oder die „Kulturindustrie” kritisiert, kommt er doch immer wieder auf die wichtigste Tugend des freiheitsliebenden Volkes zu sprechen: Die Amerikaner begingen immer solche Fehler, die sie wieder gutmachen könnten, schreibt er, und das gelte auch für die Wahl der Staatsmänner. Der zivilgesellschaftliche Liberalismus des Autors kommt auch in seinem Lob des bürgerlichen und christlichen Vereinswesen zum Ausdruck: So lebten die Amerikaner ihren Individualismus auf eine Weise aus, die gleichzeitig die Gesellschaft zusammenhalte.
Das war bekanntlich auch ein Thema von Max Weber, dessen Bild insgesamt skeptischer ist. Auf Weber übten jedoch bereits die amerikanischen Universitäten Faszination aus - und er fürchtete, dass sie bald auch so bürokratisch werden könnten wie die deutschen im Jahre 1904. Dagegen sei an Amerikas Eliteuniversitäten „intellektuelle Rechtschaffenheit” die einzige Tugend, und die jungen Amerikaner beeindrucken ihn am meisten, haben sie doch „vor nichts und niemand, vor keiner Tradition und keinem Amt Respekt, es sei denn vor der persönlich eigenen Leistung des Betreffenden”.
Adorno schließlich gelingt es am wenigsten, seine widersprüchlichen Amerikaerfahrungen zu bewältigen oder auch nur seinen Selbstwiderspruch zu thematisieren. Amerika, das ist für ihn Kulturindustrie und Konsumismus - aber auch das Land der Rettung, wo das Alltagsleben humaner verläuft und die Widerstandskräfte gegen den Totalitarismus größer sind. Bei aller Kritik scheint er am Ende doch den USA den Vorzug vor Europa zu geben. Schließlich lobt er sogar die Shopping-Malls, und wie Tocqueville entdeckt er die zivilisierende Funktion der Sekten, Clubs und Höflichkeitsfloskeln.
Erst kürzlich hat der Stanforder Professor Russell Berman begründet, warum Adornos „Verteidigung von Autonomie und Individualismus” wirtschaftstheoretisch Friedrich von Hayek nahe stehe. So weit geht Offe nicht. Aber sein Buch, das die Enttäuschung über das gegenwärtige Amerika nicht verhehlt, ist ein größerer Freundschaftsdienst an der Neuen Welt als alle aktuelle politische Rhetorik.
TIM B. MÜLLER
CLAUS OFFE: Selbstbetrachtung aus der Ferne. Tocqueville, Weber und Adorno in den Vereinigten Staaten. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 144 Seiten, 14,80 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Claus Offe über Tocqueville, Max Weber und Adorno in Amerika
Als Donald Rumsfeld während des letzten Golfkrieges in einem seiner spitzen Statements das "alte Europa" gegen ein "neues" ausspielen wollte, konnte er auf einen fest verankerten rhetorischen Topos bauen. Denn seit langem heißt Europa zu begreifen, den Vergleich mit Amerika zu suchen. John Locke gibt 1690 eine dominante Tonlage vor: "Im Anbeginn war alle Welt Amerika." Dieses Land erscheint nicht nur als ein Experimentierfeld, auf dem die göttliche Vorsehung einen Neuanfang des Menschengeschlechts auf Erden inszeniert. Es läßt vor den Augen der Europäer exemplarisch die Weltgeschichte noch einmal sich vollziehen, von den ersten Siedlern, die als Jäger und Sammler durch die Natur streifen, über die Händler und Viehzüchter bis zu den Magnaten der Großindustrie. Amerika "hat es besser als unser Kontinent, der alte", kann Goethe 1827 in einer vielzitierten Zeile formulieren, denn der neue Kontinent wird nicht erdrückt von den Lasten der Tradition. Zur selben Zeit kann Hegel die Tonlage des Antiamerikanismus anklingen lassen, wenn er herablassend notiert, Europa verhalte sich zu Amerika wie Hamburg zu Altona oder Frankfurt zu Of-fenbach, Vororte, in denen sich der "Überfluß" der Reichsstädte sammelte, weil die Last der Abgaben für die Gewerbetreibenden nicht so schwer war.
Wenn Europäer Amerika beschreiben, beschreiben sie auch sich selbst. Das gilt von vornherein für die drei Autoren, denen Claus Offe seine Frankfurter Adorno-Vorlesungen gewidmet hat: Tocqueville, Max Weber und Adorno. Es gilt auch für Offe, wenn er versucht, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Amerika-Europa-Beschreibungen der drei Schrifteller und Wissenschaftler herauszuarbeiten. Dies schon deshalb, weil das gegenwärtige Verhältnis der beiden Kontinente markant durch den 11. September 2001 bestimmt ist.
Der zeitliche Bogen der Betrachtung spannt sich insofern vom frühen neunzehnten Jahrhundert bis in unsere Gegenwart. 1831/32 begibt sich Tocqueville für neuneinhalb Monate auf eine Studienreise durch die Vereinigten Staaten, 1904 nutzt Weber eine Konferenzeinladung zu einer dreimonatigen Rundreise, Adorno muß als Exilant von 1938 bis 1949 bleiben. Alle drei sind an Amerika als einem exemplarischen Fall der westlichen Modernisierung interessiert. Diesbezüglich, so Offe, gibt es drei Varianten der Beurteilung, die sich den Autoren zuordnen lassen.
Für Tocqueville ist Amerika in einem positiven Sinne Europa voraus. Zwar sieht er die selbstzerstörerischen Kräfte dieser Kultur, die "Tyrannei der Mehrheit" und die "Gleichgültigkeit als Frucht des Individualismus", aber er erkennt auch die Gegenkräfte, vor allem in den religiösen und sä-kularen Vergemeinschaftungen, so daß ihm am Ende die amerikanische Gesellschaft "hundertmal glücklicher" erscheint als die europäische. Daß "wir, wie die Amerikaner, früher oder später zu fast völliger Gleichheit gelangen werden," ist für Tocqueville eine aufmunternde Prognose.
Im Sinne eines verzagten Optimismus fällt die Beurteilung Webers aus. Auch ihm zufolge hat Amerika Kräfte in einem positiven Sinne entwickelt, aber es ist zweifelhaft, ob sie sich halten können, und noch zweifelhafter, ob sie einem erschöpften Europa als Vorbild dienen können. Webers pessimistische Theorie des "okzidentalen Rationalismus" grundiert sein AmerikaBild. Jedenfalls kann er sich, so Offe, nie zu einer klaren Antwort darauf durchringen, ob Amerika der okzidentalen Entwicklungslogik unterliegen oder sich als eigenständig behaupten werde. Ob Amerika für einen Ausweg aus dem "Gehäuse der Hörigkeit" steht oder für dessen globale Verfestigung, bleibt für Weber unentschieden.
Eindeutig ist dagegen die Antwort Adornos. Amerika bildet ihm zufolge die negative Avantgarde, an der sich die verhängnisvolle Zukunft Europas und die Tendenzen zur "verwalteten Welt" ablesen lassen. Freilich ist dieses Amerika-Bild durch einen auffälligen Bruch gekennzeichnet, den Offe an dem (von Adorno nicht autorisierten) Vortrag "Kultur und Culture" festmacht. Darin finden sich Passagen über die Vereinigten Staaten als Leuchtturm einer Zivilgesellschaft, die in ihrem Optimismus Tocqueville zu überbieten scheinen. Offe läßt keinen Zweifel daran, welchem der beiden Denker letztlich der Vorzug zu geben ist. Tocqueville gilt ihm als "Meister der Ambivalenz", während der Dialektiker Adorno inkonsequent im Gegensatz seiner Amerika-Beschreibungen verharre.
Offe weiß, daß seine Rekonstruktion der verführerischen Gefahr ausgesetzt ist, sich in die aktuelle politische Situation zu ver-wickeln. Gleichwohl liegt es auf der Hand, daß der Reiz seiner Darstellung aus dieser Situation hervorgeht. Offe gibt ihr über weite Strecken zurückhaltend, meist in Anmerkungen, nach. Erst zum Schluß kommt er offen auf seine Sicht der Vereinigten Staaten und deren Kampf gegen das "Böse" zu sprechen. Auch hier bleiben seine Ausführungen unaufgeregt, im sachlichen Tonfall des Sozialwissenschaftlers, der die verständliche Vorlesungssprache beibehalten hat. So empfiehlt sich das Buch allen, die inmitten der gegenwärtigen transatlantischen Entfremdung darüber nachdenken wollen, was es mit der Ferne und Nähe zwischen Amerika und Europa auf sich hat.
JOSEF FRÜCHTL.
Claus Offe: "Selbstbetrachtung aus der Ferne". Tocqueville, Weber und Adorno in den Vereinigten Staaten. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 144 S., br., 14,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Josef Früchtl empfiehlt die unter dem Titel "Selbstbetrachtung aus der Ferne" erschienenen Frankfurter Adorno-Vorlesungen Claus Offes, in denen der Verfasser sich mit dem Amerikabild dreier Denker auseinandersetzt: Alexis de Tocqueville, Max Weber und Theodor W. Adorno. Besondere Würze erhält das Bändchen, dem Rezensenten zufolge, durch die gegenwärtige Weltlage, den besorgten Blick auf die letzte verbliebene Supermacht und Donald Rumsfelds "spitzes Statement" vom "alten Europa". Offe zeichnet an den euphorischen bis skeptischen Statements der drei Meisterdenker exemplarisch nach, welche Haltungen einem europäischen Intellektuellen zum unbedingten amerikanischen Vorwärtsstreben möglich sind. Da ist Tocquevilles Begeisterung von 1832, Max Webers "verzagter Optimismus" und die Griesgrämigkeit des Exilanten Adorno, die in den USA lediglich eine Avantgarde des Negativen zu sehen vermag. Allerdings zieht Offe einen von Adorno nicht autorisierten Vortrag über "Kultur und Culture" zum Vergleich heran, und dieser, so Früchtl, weise einen Optimismus auf, der "Tocqueville zu überbieten" scheint.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH