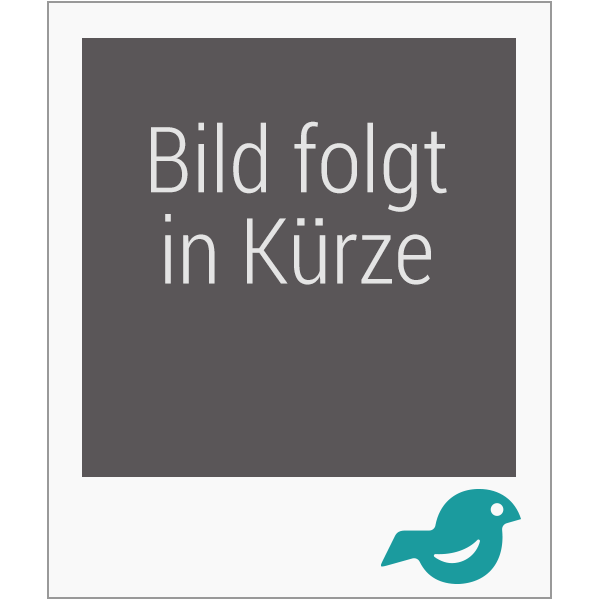
Dieter Schnaas
Buch
Kleine Kulturgeschichte des Geldes Dieter Schnaas
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar



Produktdetails
- Verlag: Brill Fink
- ISBN-13: 9783770550333
- ISBN-10: 3770550331
- Artikelnr.: 30209031
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2010Ein Seitenweg ins Paradies
Dieter Schnaas weiß der Geschichte des Geldes dämonische Seiten abzugewinnen und endet doch bei der Krise als Ankunft einer großen Vernunft.
Von Thomas Thiel
Nicht der Markt, sondern der Staat - das hat die Finanzkrise gezeigt - ist der letzte Garant für den Wert des Geldes. Seit es sich nicht mehr in Gold aufwiegen lässt, speichert das Geld seinen Wert nicht, sondern muss ihn behaupten. Und dass diese Behauptung ernstgenommen wird, dafür bürgt der Staat, indem er Kreditschöpfung und Eigenkapital in ein stabiles Verhältnis bringt.
Die Kulturgeschichte des Geldes des Wirtschaftsjournalisten Dieter Schnaas hat daher einen Gegner: die liberale Theorie, die das Geld als
Dieter Schnaas weiß der Geschichte des Geldes dämonische Seiten abzugewinnen und endet doch bei der Krise als Ankunft einer großen Vernunft.
Von Thomas Thiel
Nicht der Markt, sondern der Staat - das hat die Finanzkrise gezeigt - ist der letzte Garant für den Wert des Geldes. Seit es sich nicht mehr in Gold aufwiegen lässt, speichert das Geld seinen Wert nicht, sondern muss ihn behaupten. Und dass diese Behauptung ernstgenommen wird, dafür bürgt der Staat, indem er Kreditschöpfung und Eigenkapital in ein stabiles Verhältnis bringt.
Die Kulturgeschichte des Geldes des Wirtschaftsjournalisten Dieter Schnaas hat daher einen Gegner: die liberale Theorie, die das Geld als
Mehr anzeigen
neutralen Mittler unterschätzt und den Markt als Selbstregenten feiert. Schnaas will mit dieser Geschichts- und Staatsvergessenheit aufräumen und im Gegenzug das religiöse Fundament des Geldes aufscheinen lassen. Er entwirft dazu seinen anonymen Protagonisten wie einen Romanhelden auf dem Emanzipationsweg durch die Jahrhunderte: ein aufsässiger, doppelgesichtiger Dämon, der in jede Ritze dringt, Mentalitäten transformiert, Werte anfrisst, Ideen verkleinert, Hierarchien umformt, Beziehungen versachlicht und allem seine indifferente Zahlenlogik aufzwingt.
Schnaas schreibt packend, mit beeindruckender Gelehrtheit, Sprachgewalt und intellektueller Kombinationsfreude. Seine Vorliebe gilt dem großen ideengeschichtlichen Tableau, das er mit einer wuchernden religiösen und biologischen Metaphorik überzieht. Es stören lediglich der Übertreibungsgestus und die Forciertheit, mit der er das Geld vom Agenten zum gottgleichen Akteur ummodelt. Zumal es ihm mit diesem Identitätsschluss nicht wirklich ernst ist: Das Geld ist religiöses Surrogat und erfüllt gerade nicht letzte Zwecke. Doch über alle Umformungen hinweg, das ist seine These, bleibt es seinem religiösen Fundament als Gottesopfer verpflichtet.
Dieser Säkularisierungsweg ist unterteilt in eine Real- und eine Ideengeschichte. Erstere hat ihren Skandal im Jahr 1797, als die zahlungsfähige Bank of England das Geld mit Billigung des Staates von seinen Metalläquivalenten löste und die Einlösung ihrer Schuld in die Zukunft verschob. Von hier erfolgte der Sturz ins Bodenlose, in ein schier grenzenloses Geldwachstum ohne Gegenwert, eine Anhäufung von Schuld, die stets mit dem kommenden Wirtschaftswachstum vertröstet wird. Die Finanzkrise deutet Schnaas hier übereuphorisch als heilsamen Säkularisierungsschock, der nicht nur das verzerrte Verhältnis von Finanz- und Realwirtschaft korrigiert, sondern gleich eine neue Ära einleitet, in der die religiöse Aufladung des Gelds auf ein sachliches Arbeitsverhältnis zurückgefahren wird.
Bei der sittlichen Emanzipation vom Makel der Sündhaftigkeit brauchte das Geld nicht Max Webers protestantische Ethik. Es wurde von seinen Gegnern protegiert. Der Katholizismus schuf das Fegefeuer, um der sündhaften Seele des Wucherers einen Seitenweg ins Paradies offenzuhalten, und erlaubte den Zugriff auf das unverfügbare Attribut Gottes: die Zeit. Mit dem Ablasshandel geriet auch das Seelenheil in die Logik des Geldes. Dessen Geschichte lässt sich so auch in Epochen periodisieren, in denen bestimmt ist, was nicht unter seinen Einflussbereich fallen soll: von Zeit über Tugend und Liebe bis zu arbeitsfreien Wochenenden.
In glänzenden Analysen literarischer Werke schildert Schnaas diesen mentalen Kolonialismus des Geldes, sein Eindringen in Wertordnung und Seelenleben. Doch letztlich sieht er im Geld immer auch die erschließende und selbsttherapierende Kraft. Die Entfremdung und Ausbeutung der Arbeiter im Industrialismus des neunzehnten Jahrhunderts kuriert der Konsumentismus mit Acht-Stunden-Tag und Möglichkeit zur reflexiven Distanznahme.
Man darf sich nicht täuschen lassen: Wäre diese Kulturgeschichte des Geldes vor einigen Jahrhunderten erschienen, hätte sie wohl den Titel "Vom rechten Umgang mit dem Gelde" getragen. Das politische Temperament des Autors sprengt das gediegene Genre der Kulturgeschichte und mündet in ein Traktat des beherrschten Geldumgangs, der dem selbstgeschaffenen Mythos aufsitzt: Das zum selbstbewussten Helden stilisierte Geld muss es richten und retten.
Der weite ideengeschichtliche Entwurf schnurrt am Ende zusammen auf die idealisierte Kitschfigur des "selbst-interessierten, mit sich selbst identischen Verbrauchers", der zwischen Berufs- und Feierabendmentalität perfekt zu unterscheiden weiß und dem sein Geld ganz selbstverständlich ermöglicht, kommerzfreie Sphären auszubilden, in denen er bei Kunstgenuss, Familie und Sport die verknitterte Erwerbsmoral glattbügelt, während er mit dem übrigen Geld gerne als "Nebenkosten" verbuchte kapitalistische Kollateralschäden wie Naturzerstörung und Ausbeutung von Drittweltländern begleicht. Soll der Autor nur seinen Maximen folgen, in die vom Kulturmarketing eroberten Museen gehen, sich an den Verhandlungstisch der Liebe setzen und im Fitnessstudio aktiv regenerieren - er wird dort überall den Ruf des Geldes vernehmen: "Ich bin allhier."
Dieter Schnaas: "Kleine Kulturgeschichte des Geldes". Wilhelm Fink Verlag, München 2010. 188 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schnaas schreibt packend, mit beeindruckender Gelehrtheit, Sprachgewalt und intellektueller Kombinationsfreude. Seine Vorliebe gilt dem großen ideengeschichtlichen Tableau, das er mit einer wuchernden religiösen und biologischen Metaphorik überzieht. Es stören lediglich der Übertreibungsgestus und die Forciertheit, mit der er das Geld vom Agenten zum gottgleichen Akteur ummodelt. Zumal es ihm mit diesem Identitätsschluss nicht wirklich ernst ist: Das Geld ist religiöses Surrogat und erfüllt gerade nicht letzte Zwecke. Doch über alle Umformungen hinweg, das ist seine These, bleibt es seinem religiösen Fundament als Gottesopfer verpflichtet.
Dieser Säkularisierungsweg ist unterteilt in eine Real- und eine Ideengeschichte. Erstere hat ihren Skandal im Jahr 1797, als die zahlungsfähige Bank of England das Geld mit Billigung des Staates von seinen Metalläquivalenten löste und die Einlösung ihrer Schuld in die Zukunft verschob. Von hier erfolgte der Sturz ins Bodenlose, in ein schier grenzenloses Geldwachstum ohne Gegenwert, eine Anhäufung von Schuld, die stets mit dem kommenden Wirtschaftswachstum vertröstet wird. Die Finanzkrise deutet Schnaas hier übereuphorisch als heilsamen Säkularisierungsschock, der nicht nur das verzerrte Verhältnis von Finanz- und Realwirtschaft korrigiert, sondern gleich eine neue Ära einleitet, in der die religiöse Aufladung des Gelds auf ein sachliches Arbeitsverhältnis zurückgefahren wird.
Bei der sittlichen Emanzipation vom Makel der Sündhaftigkeit brauchte das Geld nicht Max Webers protestantische Ethik. Es wurde von seinen Gegnern protegiert. Der Katholizismus schuf das Fegefeuer, um der sündhaften Seele des Wucherers einen Seitenweg ins Paradies offenzuhalten, und erlaubte den Zugriff auf das unverfügbare Attribut Gottes: die Zeit. Mit dem Ablasshandel geriet auch das Seelenheil in die Logik des Geldes. Dessen Geschichte lässt sich so auch in Epochen periodisieren, in denen bestimmt ist, was nicht unter seinen Einflussbereich fallen soll: von Zeit über Tugend und Liebe bis zu arbeitsfreien Wochenenden.
In glänzenden Analysen literarischer Werke schildert Schnaas diesen mentalen Kolonialismus des Geldes, sein Eindringen in Wertordnung und Seelenleben. Doch letztlich sieht er im Geld immer auch die erschließende und selbsttherapierende Kraft. Die Entfremdung und Ausbeutung der Arbeiter im Industrialismus des neunzehnten Jahrhunderts kuriert der Konsumentismus mit Acht-Stunden-Tag und Möglichkeit zur reflexiven Distanznahme.
Man darf sich nicht täuschen lassen: Wäre diese Kulturgeschichte des Geldes vor einigen Jahrhunderten erschienen, hätte sie wohl den Titel "Vom rechten Umgang mit dem Gelde" getragen. Das politische Temperament des Autors sprengt das gediegene Genre der Kulturgeschichte und mündet in ein Traktat des beherrschten Geldumgangs, der dem selbstgeschaffenen Mythos aufsitzt: Das zum selbstbewussten Helden stilisierte Geld muss es richten und retten.
Der weite ideengeschichtliche Entwurf schnurrt am Ende zusammen auf die idealisierte Kitschfigur des "selbst-interessierten, mit sich selbst identischen Verbrauchers", der zwischen Berufs- und Feierabendmentalität perfekt zu unterscheiden weiß und dem sein Geld ganz selbstverständlich ermöglicht, kommerzfreie Sphären auszubilden, in denen er bei Kunstgenuss, Familie und Sport die verknitterte Erwerbsmoral glattbügelt, während er mit dem übrigen Geld gerne als "Nebenkosten" verbuchte kapitalistische Kollateralschäden wie Naturzerstörung und Ausbeutung von Drittweltländern begleicht. Soll der Autor nur seinen Maximen folgen, in die vom Kulturmarketing eroberten Museen gehen, sich an den Verhandlungstisch der Liebe setzen und im Fitnessstudio aktiv regenerieren - er wird dort überall den Ruf des Geldes vernehmen: "Ich bin allhier."
Dieter Schnaas: "Kleine Kulturgeschichte des Geldes". Wilhelm Fink Verlag, München 2010. 188 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Respekt vor der Kürze hat Rezensent Daniel Jütte. Was der Autor alles in grad mal 190 Seiten packt! Eine Kulturgeschichte des Geldes soll es sein, aber auch ein Hintergrundbericht zur Bankenkrise, historisch geordnet und mit jeder Menge Sachkenntnis geschrieben. So weit, so gelungen, findet Jütte. Sogar zu einleuchtender Kritik an gesamtgesellschaftlichen Haltungen und Sichtweisen zum und auf den Mammon ist Raum, staunt er. Dann stutzt er allerdings. Nämlich, wenn Dieter Schaas dem Geld gar ein befriedendes Talent und dem Kapitalismus selbstreinigende Kräfte attestiert. Zur Herausforderung wird die Lektüre aber durch etwas anderes. Die laut Jütte eigentlich recht scharfsinnigen Beobachtungen und Schlüsse des Autors nämlich werden im Buch offenbar durch eine Pointen- und Metaphernschleuse geschickt. Was da hinten raus kommt, erscheint dem Rezensenten wirklich schwer bis un-genießbar.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


