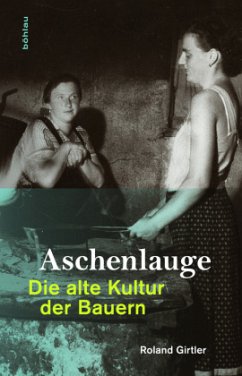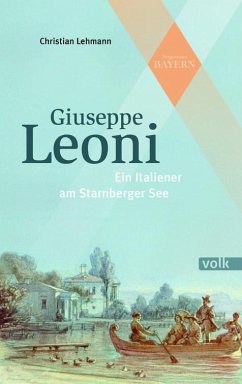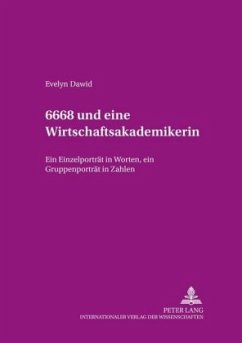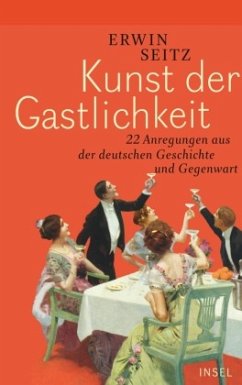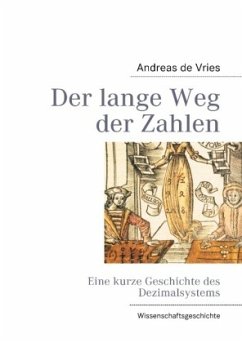Universitätsprofessor für Soziologie, ist das noch eine glatte Untertreibung. Die von ihm praktizierte Feldforschung besteht darin, viele Schwätzchen zu halten und anschließend deren Inhalt so in einem Buch auszubreiten, dass an keiner Stelle der Eindruck entsteht, der Autor könne dabei eigene Gedanken eingemischt haben. Dazu benötigt man aber gar keine künstlichen Veranstaltungen. Girtler verkörpert vielmehr das eindrückliche Beispiel einer ganz natürlichen und ungezwungenen Gedankenvermeidung.
Über Kellner ist in diesem Buch zu erfahren, dass es solche und solche gibt. Und alle haben sie irgendwelche Geschichten zu erzählen, die der Autor ganz famos findet und uns nicht vorenthalten möchte. Zumal die Damen und Herren, mit denen er plauscht, durchweg prächtige Leute sind. Die Kellner können sich wahrlich über diesen Feldforscher bei Topfengolatschen, Apfelstrudel oder einer "guten Jause" freuen. Sie sind die Leser, die Girtlers Hommage ans vorwiegend österreichische Kellnertum im Blick hat. Dass den Leuten gefalle, was er über sie schreibe, hielt Girtler schon bei früherer Gelegenheit für ein Argument zugunsten seiner feldforscherlichen Ausflüge.
Und so sieht das aus, was er diesmal über sie schreibt: "Eine freundliche Kellnerin, Carola ist ihr Name, bemüht sich gemeinsam mit Herrn Rene um die nach dem heurigen Wein dürstenden Gäste." Nämlich in einem Wiener Heurigen. Während im Café Landtmann gleich beim Burgtheater, wo der Herr Professor besonders gern verkehrt, neben den Herren Engelbert, Erich, Lajos, Michael, Boris, Friedrich, Sten, Elmar, Nino, Franz, Thomas, Dragan, Gottfried, Erwin, Rudi, Daniel, Endre, Gerli, Philipp, Aykut "und anderen" auch Herr Michael Schneider bedient, von welchem der Autor zu sagen weiß: "Er ist ein guter Kellner mit edlen Zügen, der auch seinen Witz hat." Leider wird aber auch der witzhabende Herr Michael vom Autor mit dessen Sprache beliehen und muss auf die Frage, wie er denn zum Kellnern gekommen sei, die Antwort geben: "Ich habe mir diese noch nie gestellt."
So sprechen sie also, und man fragt sich nach wenigen Seiten, woran diese Sprache erinnert, in der ein volkssprachlich naiver Ton fortwährend zu Elementen aus höheren Stillagen greift, um dadurch vollends komisch zu werden. Am ehesten wohl an die Sprache mancher Figuren bei Nestroy. Könnte nicht diese Selbstbeschreibung von einem der Nestroyschen Hausknechte stammen, die sich ihrem neuen Prinzipal andienen: "Meine Tätigkeit als Kellner in dem Beisl in der Lerchenfelderstraße im 8. Wiener Gemeindebezirk währte allerdings nicht lange. Der Wirt dieses Lokals war kein freundlicher Herr ... Nach ein paar Tagen meines Kellnerdaseins, über das ich noch erzählen werde, kam es zu einem Streit zwischen dem Wirt und mir. Dies führte zu meiner sofortigen Kündigung. Seit dieser Zeit habe ich höchste Sympathien für Kellner jeder Art, sowohl für jene in kleinen Lokalen als auch für die sehr noblen in prächtigen Kaffeehäusern."
Das ist aber nicht Nestroy, sondern des Herrn Professors Erinnerung an die ersten Anbahnungen seiner Neigung zum Kellnerstand. Manch braver Wirt und tüchtige Wirtstochter haben daran natürlich auch ihren Anteil, von den "braven Bauersleuten" seiner Bekanntschaft ganz abgesehen. Sittsam nämlich ist das Land und brav, das der Feldforscher auf seinem Weg von Wirthausstube zu Konditorei zu Bierzelt durchreist. Selbst im Gefängnis ist alles eigentlich wunderbar, wenn einen der Direktor der "würdigen Anstalt" in Stein in der Wachau durch diese "Erlebniswelt" führt und anschließend zur Mahlzeit bittet: "Ich hatte die Ehre, am Tisch des Direktors die Mahlzeit einnehmen zu dürfen. Meine Begleiter saßen an den anderen mit sauberen Tüchern gedeckten Tischen."
Festzuhalten ist auch, dass das Kellnern in Bordellen nicht etwa umgangen wird. Letztere finden sich neben dem Gefängnis unter "ungewöhnliche Betriebe" und sind nach der Bestimmung des Verfassers näherhin solche, "in denen Tänzerinnen auftreten und Gäste an ihnen Gefallen finden". Man stelle sich aber einmal vor, dass eine Kellnerin auf Abwege kommen kann, wenn sie "als Serviererin in einem Nachtlokal Gäste erfreut"! Wir führen das nicht aus - der Autor allerdings auch nicht wirklich -, sondern zitieren nur die Schauer über Schnitzlersche Dienstmädchenrücken treibende Kapitelüberschrift: "Die Kellnerin, die zur Dirne wurde".
Um zu den gewöhnlichen Betrieben zurückzukehren: Zum Kaffeehaus erwartet man natürlich ein stattliches Kapitel, findet aber unter dieser Überschrift gerade einmal drei Seiten. Immerhin erfahren wir, dass dort "der feine Gast Entspannung, Muße zum Lesen von Literaturwerken und das ruhige Gespräch mit Kollegen" pflege und der "Herr Kammerschauspieler Professor Rudolf Buczolich es in geradezu schönen Worten besingt".
Der Autor dagegen darf sich wohl darauf freuen, sein Buch bald in angemessener Umgebung präsentiert zu sehen: neben der Malakofftorte im Café Landtmann, beim Buchtelblech im Sperl und an vielen, vielen Orten mehr. Es muss ihm das beim Schreiben vorgeschwebt haben: die Durchdringung von Kulturwisssenschaft mit Topfengolatschen und Apfelstrudel, von deren Verzehr er uns so getreulich berichtet.
HELMUT MAYER
Roland Girtler: "Herrschaften wünschen zahlen". Die bunte Welt der Kellnerinnen und Kellner. Böhlau Verlag, Wien 2008. 401 S., Abb., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
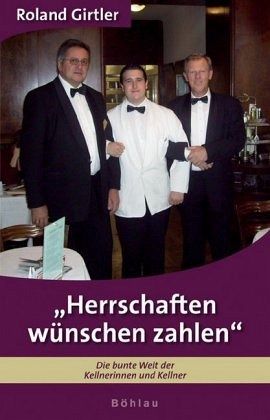




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.07.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.07.2008