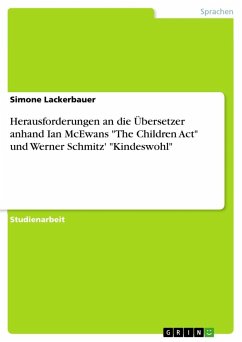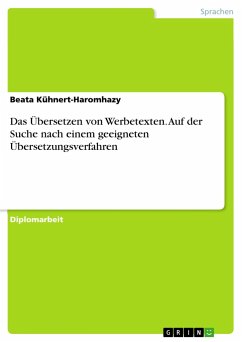Esther Kinsky, Autorin und vielfach ausgezeichnete Übersetzerin, beschreibt ausgehend von eigenen Erfahrungen das Verhältnis zwischen Namen und Dingen und die Veränderungen, die sich im Prozess des Übersetzens in diesem Verhältnis vollziehen. Wie wandeln sich die zu den Dingen gehörenden Bilder im Kopf und in der Erinnerung durch den steten Umgang mit der Umbenennung? Wie prägt die Erinnerung andererseits die Wertigkeit der Benennungen und beeinflusst damit die Wortentscheidungen, die man beim Übersetzen unentwegt trifft? Was geschieht in dem Raum, der sich zwischen den beiden Namen in der Herkunfts- und der Zielsprache auftut, während der Übersetzer die Bild- und Klangwelt des zu übersetzenden Textes "fremdspricht"? Kinskys Essay Fremdsprechen zeichnet die feine Grenzlinie nach, die zwischen eigenen und fremden Worten, zwischen eigener und fremder Sprache, zwischen eigenem und fremdem Leben verläuft.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Charmant und gedankenreich findet Burkhard Müller diesen Band von Esther Kinsky, in dem die Übersetzerin und Autorin Esther Kinsky die "Fallstricke des Übersetzens" um kreist. Beim Übersetzen, weiß Müller, sei es wie bei der Liebe: Je mehr man darüber rede, umso sicherer entziehe sie sich. Deswegen findet der Rezensent Kinskys Ansatz auch ganz richtig, sich anekdotenreich und mit einprägsamen Beispielen dem Thema zu nähern. Interessant auch, dass sie Attribute wie Brückenbauer und Kulturvermittler für Übersetzer ablehnt, die ihr viel zu sehr nach touristischem Fremdenführer klingen, und sich stattdessen eher im musikalischen Bereich agieren sieht, wo es um Klangräume und Resonanzboden geht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Esther Kinskys „Fremdsprechen“ ist ein ebenso charmantes und gedankenreiches Buch über die Fallstricke des Übersetzens
Mit dem Übersetzen steht es wie mit der Liebe: Man kann ohne Ende darüber reden, denn es handelt sich primär um eine Praxis, bei welcher der Diskurs immer wieder eine andere Facette funkeln lässt und sich der Kern desto sicherer verbirgt. Esther Kinsky, Übersetzerin aus dem Russischen, Polnischen und Englischen und selbst belletristische Autorin, weiß das und richtet sich danach, und das macht „Fremdsprechen“ zu einem so charmanten wie gedankenreichen Buch, mag es auch schmal sein – nein gerade weil es schmal ist, denn so gibt es zu verstehen, dass zu diesem Thema immer nur etwas und nie alles gesagt werden kann; dass es schlechthin unerschöpflich ist, genau wie die Liebe eben.
Mit dieser teilt das Übersetzen auch die Bedingung des Zweierlei: Damit es gelingen kann, muss eine Begegnung zwischen Fremden stattfinden. Was herauskommt, übersteigt in jedem Fall das, was jeder einzeln war. Gleich zu Anfang heißt es: „Ich halte nicht viel von der Betonung der Rolle des Übersetzers als ‚Brückenbauer‘ und Kulturvermittler. Der Übersetzer ist kein Fremdenführer, auch wenn die Fremde sein Gegenstand ist.“ Es kommt also darauf an, eine hinlängliche Vorstellung vom Wort „fremd“ zu gewinnen: Nicht in die Horizontale erstreckt es sich, in der Touristen über Brücken wandeln und sich gleich wie daheim fühlen, sondern hinab – die Kluft, der Abgrund nehmen ihm das Maß. Doch Kluft und Abgrund sollte man sich nicht als Figuren der Drohung und Verneinung denken. Vielmehr kommt erst in ihnen das Zweierlei zu seinem Recht: Klangraum und Resonanzboden sind sie. Nicht etwa bloß ein Echo wird von der Übersetzung beigestellt (wie Walter Benjamin, der hier zitiert wird, gemeint hatte), sondern die zweite Stimme, durch die, was lediglich eine Melodie war, seine harmonische Vollgestalt gewinnt.
Wie die Liebe den Kugelmythos, so hat auch das Übersetzen seine Ursprungsfabel von anfänglicher Einheit, Spaltung und resultierender Sehnsucht. Kinsky erzählt den Turmbau von Babel zwar als die Geschichte einer Strafe und des Verlusts der Unschuld, aber sie sieht in der Verwirrung der Sprachen auch eine Chance dafür, dass die kindliche „Stasis“ übergeht in die verwandelnde Tätigkeit des wahrhaft erwachsenen Menschen. „Das Wesentliche an der Sprache ist daher nicht der Status des abgeschlossenen Werks – ist es ein Kunstwerk, und wenn ja, wie und dank wem ist es bleibend, hat es Geltung? – sondern die Art und Weise, wie sie Zeugnis ablegt von der Auseinandersetzung mit den beiden Gegebenheiten des Menschseins: Sprache und Fremde.“ Die gern gestellte Frage nach dem Kunstwerks-Charakter der Übersetzung ist daher als unergiebig abzuweisen. Kunst, insofern sie das Schaffen im Geschaffenen zur Erstarrung bringt, steht niedriger als das Vermögen, das sich in ihr offenbart; es ist im Zeugnis sozusagen nur zufällig sichtbar geworden.
Kinsky erzählt von ihrer Urgroßmutter, die auf ihrem Einödhof elf Kinder großzog und völlig überrumpelt war, als ihre Enkelin (die Mutter der Autorin) aus der Schule mit den ersten Französisch-Vokabeln heimkam. „,Aber das geht doch nicht‘, soll sie gesagt haben, ‚ein Tisch ist doch ein Tisch, dazu kann man nicht einfach tah-ble sagen!‘“ Die Naivität der Urgroßmutter mag unhaltbar sein, die Sehnsucht tastet dennoch zurück nach der adamitischen Ursprache und gibt ihr jedenfalls den Vorzug gegenüber dem babylonischen Unding, das Kinskys Mutter später daraus macht, diesem „Hokuspokus“, „wenn sie vor fremdsprachigen Gästen die Worte wie verschreckte Kaninchen aus dem Sprachzylinder zog und fallenließ.“ Wem dieses frühzeitige Misstrauen gegen die Sprache der Mutter widerfahren ist, dem wird wohl auch in der Muttersprache unheimisch zumute. Die Bereitschaft für das Fremde setzt die Erkenntnis vom Defekt des Eigenen voraus; und was die Autorin die „fruchtbare Welt der Infragestellung von Gegebenem“ nennt, kann wohl nicht anders beginnen als mit einem Schmerz.
Und mit der Neugier. Die Bücher in Kinskys Kindheit hatten gewissermaßen ein Schlüsselloch, durch das sich in die andere Welt, aus der sie stammen, gucken ließ: das Vorsatzblatt, das den fremdsprachigen Originaltitel nennt. Mehr braucht die kindliche Phantasie nicht als die „Vorstellung, dass Kinder in Schweden, England oder Frankreich von denselben Szenen in anderen, mir völlig unverständlichen Worten zum Lachen, Weinen, Fürchten gebracht wurden (. . .) Wie ‚fühlt‘ sich das an, wenn es anders klingt?“
Kinskys Buch hat Überfluss an einprägsamen Beispielen und Anekdoten. Schon in derselben Sprache kann Verständigung schwer werden, wenn von den Großmüttern (es herrscht in diesem Buch, trotz seines Argwohns gegen Muttersprachen, eine eigentümlich matrilineare Tradition) die eine an einem kleinen, die andere an einem großen Fluss aufgewachsen ist; infolgedessen machen sie einander den Begriff „Fluss“ streitig, indem die eine den Fluss der anderen zum „Flüsschen“ herabstuft, die andere den Fluss der einen zum „Strom“ aufwertet, um ihren eigenen Fluss zu retten. Wie handhabt man die Vorliebe für Verkleinerungsformen in Sprache A, ohne in Sprache B zur infantilen Nervensäge zu werden? Wie spricht man Völkern, die kein Wort für Blau, sondern zwei verschiedene für Hell- und Dunkelblau haben, von der blauen Blume? Wie geht man mit der Farbe Weiß um, wenn sich in der einen Kultur damit die Assoziationen der Kälte und des Schnees, in der anderen solche der glühenden Hitze verbinden? Hier hat der Übersetzer, wie Kinsky es sieht, nur die Wahl zwischen „Lücke und Lückenbüßer“, das heißt zwischen Teufel und Beelzebub.
Um die erwartbare Frage vorwegzunehmen, was aus all dem denn für ihre eigene übersetzerische Praxis folge, legt Esther Kinsky im Anhang eine Probe ab. Ein von ihr selbst verfasstes Prosa-Langgedicht über die Stadt London (wo sie lang gelebt hat) steht links, ihre eigene deutsche Übersetzung rechts davon. Man mag das für ein wenig unfair halten, denn durch eine solche Personalunion immunisiert sie sich natürlich gegen die übliche mäkelnde Kritik, die glaubt, den Dichter vor seinem Dolmetsch retten zu müssen: Was hier steht, ist wahrhaft autorisiert! Aber sie zahlt auch einen Preis dafür. Denn indem sie zur Übersetzerin ihrer selbst geworden ist, hat sie sich von ihrem eigenen Werk entfremdet. „Ich möchte diese Erfahrung nicht noch einmal machen“ sagt sie, und es klingt, als wäre sie einer großen Gefahr, auf die sie sich im Übermut eingelassen hat, nur knapp entronnen.
BURKHARD MÜLLER
Esther Kinsky: Fremdsprechen. Gedanken zum Übersetzen. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2013. 141 Seiten, 17,90 Euro.
Mehr Chance als Strafe ist die
babylonische Sprachverwirrung
Um sich das Fremde zueigen
zu machen, muss auch das Eigene
zum Fremden werden
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
"Wer die Bücher von Esther Kinsky liest, erfährt von dem Glück, sich ins Unsichere zu begeben und sich von ihrer Sprache, in einem leichten Wogen, halten zu lassen." - Wiebke Poromkba, Chamisso Magazin, März 2016 Wiebke Poromkba Chamisso Magazin 20160301