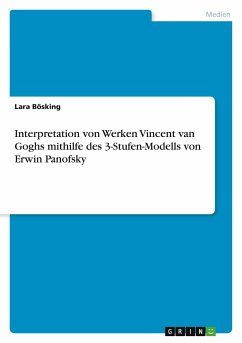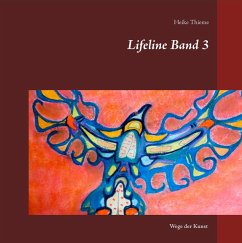Erwin Panofsky (1892-1968) war einer der bedeutendsten Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Bis 1933 lehrte er als der erste Ordinarius seines Faches an der Universität Hamburg und stand im engen Kontakt zur Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Nach der erzwungenen Emigration wurde er 1935 zum ständigen Mitglied des Institute for Advanced Study in Princeton berufen, an dem er bis zu seinem Tode wirkte. Ca. 24000 von insgesamt wohl 27000 Briefen von und an Panofsky hat Dieter Wuttke in vieljähriger Arbeit aufgespürt und daraus mehr als 3000 zur Publikation ausgewählt. Korrespondenzpartner Panofskys waren neben bedeutenden Kunsthistorikern seiner Zeit wie z.B. Aby M. Warburg, Fritz Saxl, Gertrud Bing auch Naturwissenschaftler wie Albert Einstein, Wolfgang Pauli und J. Robert Oppenheimer. Die Auswahl wird - eingeleitet, textkritisch aufbereitet, kommentiert, durch Verzeichnisse und Register erschlossen - in fünf Bänden erscheinen. Das Werk verstehtsich als ein Beitrag zur Mikro-Historie des Lebens und Wirkens von Erwin Panofsky, der keine Autobiographie hinterlassen hat. Es bietet Einblicke in die wechselvolle Geschichte des 20. Jahrhunderts aus der Perspektive einer exzeptionellen Persönlichkeit, wobei die Wissenschafts-, Sozial-, Personen- und Institutionengeschichte besondere Schwerpunkte bilden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Der Rezensent Horst Bredekamp ist schlichtweg begeistert und macht seiner Begeisterung in einer umfassenden und spannenden Besprechung Luft. Auf eineinhalbtausend Seiten, die über 700 (größtenteils unbekannte) Briefe aus den Jahren 1937 bis 1949, also aus Erwin Panofskys amerikanischer Wirkungszeit, versammeln, werden, so Bredekamp sowohl diejenigen auf ihre Kosten kommen, die nach "Reflexionen des Krieges und der Naziherrschaft" suchen, als auch jene, die Panofsky als Mensch und als Kunsttheoretiker kennen lernen wollen. Zunächst geben die Briefe Einblick in Panofskys Reaktion auf das amerikanische Exil, von dem er gesagt habe, er sei "nicht aus dem, sondern in das Paradies vertrieben" worden, und in sein großes Engagement für andere Flüchtlinge. Am politischsten zeige sich Panofsky in den Briefen an seine Söhne, die gleichzeitig den besten Einblick in die Psychologie Panofskys geben und "alle Züge" des "großen Pan" schillern lassen, der dem thelemischen "Tu was du willst!" den Vorrang gibt vor der Moral. Der für den Rezensenten "anrührendste" Briefwechsel ist der mit Panofskys Lehrer Wilhelm Vöge, dem er gesteht, "er sei durch eine einzige Vorlesung, diejenige Vöges über die von Dürer gezeichneten Hände König Maximilians I. im Wintersemester 1910/11, zum Kunsthistoriker geworden". Fassungslos hat den Rezensenten der Konflikt um die Mitautorenschaft von Raymond Klibansky an der erweiterten Ausgabe des Melancholie-Buches gemacht. Dieses Buch, so Bredekamps Fazit, ist einfach "immens" - in seinen Anforderungen an den Herausgeber und in seinem Gelingen: "Die Kommentare lassen kaum eine Lücke, das Namens- und Sachregister ist ein Kunstwerk in sich." Man lechzt nach mehr."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Korrespondenz der Jahre 1937 bis 1949 liegt vor: Der Kunsthistoriker Erwin Panofsky in seinen politischen und privaten Ansichten
Jetzt liegt der zweite Band der Korrespondenz des großen Kunsthistorikers Erwin Panofsky (1892 bis 1967) vor, den Dieter Wuttke mit liebevoller Hingabe und philologischer Akribie ediert hat. Er enthält nicht weniger als 762 Briefe von Panofsky selbst, seiner Frau Dora geb. Mosse, seinen beiden Söhnen und einer Vielzahl von privaten und öffentlichen Korrespondenten. Jede Epistel ist annotiert. Personennamen, Ereignisse, Titel von Schriften werden nachgewiesen. So haben wir ein biographisches Nachschlagewerk vor uns, das über Panofsky, seine Angehörigen, die deutsche Emigration nach 1933, die Geschichte des "Institute for Advanced Study", die Kunsthistorie und die "Humanities" in den Vereinigten Staaten nicht systematische, aber ungemein farbige Auskunft erteilt. Es ist eine fesselnde, aber auch zwiegesichtige Quellenausgabe, welche gelegentlich jenseits aller Diskretion Einblick in das Innenleben einer amerikanisch-deutschen Professorenfamilie nach der Austreibung von 1933 gewährt, zugleich aber eine ganze Wissenschaftslandschaft erhellt. Panofsky war ein ingeniöser Briefschreiber, und mindestens der Eingeweihte liest diese 1134 Seiten mit ebensoviel Spannung wie Vergnügen.
Es ist eine Auswahl aus der Korrespondenz zwischen 1937 und 1949. Der Abschied von Hamburg, wo Panofsky bis April 1933 Ordinarius gewesen war, liegt drei Jahre zurück. Seit zwei Jahren ist er "permanent member" des neu gegründeten "Institute for Advanced Study" in Princeton, damit von jenen Existenzängsten befreit, denen die Emigranten oft noch lange nach ihrer Ankunft ausgesetzt waren. So kann er 1947 in einem Brief an seinen alten Lehrer Wilhelm Vöge schreiben: "Im ganzen war uns die ,Austreibung' aus dem europäischen Paradies eher ein Segen in bezug auf das Wachsen unseres Horizonts und auch meiner eigenen Wirksamkeit." Als er im Sommer 1938 in Princeton ein eigenes Haus beziehen kann, schreibt er an den Direktor des Institutes: "Es ist ein seltsamer und etwas peinlicher Gedanke, wieviel Vorteil wir aus einem Ereignis gehabt haben, das über so viele Tausende Unglück gebracht hat." Im Juni 1940 wird er eingebürgert.
Seit 1930 war Panofsky als regelmäßiger Gastprofessor in Amerika gewesen. Nun aber - seit etwa 1937 - wird er zu jenen Vortragszyklen an amerikanischen Colleges und Universitäten eingeladen, die den Eingewanderten schnell zu dem leuchtenden Stern der Kunstgeschichte in seiner neuen Exilheimat werden lassen sollten. Vom März 1937 datiert der Brief, mit dem das Bryn Mawr College Panofsky einlädt, die angesehenen Mary Flexner Lectures zu übernehmen. Im Herbst hält Panofsky dann sechs Vorträge über "Humanistic Themes in the Art of the Renaissance", welche der Präsident des Colleges in einem Brief an das Institute in Princeton als ein "großes intellektuelles Vergnügen" feiern wird. Im Jahr darauf kommt von der Northwestern University eine ähnliche Aufforderung, und hier wird Panofsky im Herbst sechs Vorlesungen über "Albrecht Dürer, Artist and Thinker" geben. Der Erfolg war nicht geringer, wie wiederum ein Dankbrief aus Evanston zeigt. Aus diesen "Lectures" gingen die ersten englischsprachigen Bücher des früheren Hamburger Professors hervor: "Studies in Iconology" und "The Life and Art of Albrecht Dürer". Sie haben Panofsky in Amerika und in der ganzen Welt berühmt gemacht.
Diese Bücher waren vor allem einzigartig als Gewächse der intellektuellen und kulturellen Transplantation. Panofsky hat in ihnen die schwere Armierung des deutschen Professors umgeschmolzen nicht nur in eine andere Sprache, sondern in eine offene Mitteilung an ein neues Publikum. An einen früheren Hamburger Schüler schrieb er über Dürer: "Die Schwierigkeit ist, daß ich versucht habe, einigermaßen lesbar und doch nicht völlig dilettantisch zu sein mit dem Ergebnis, daß ich zwischen anstatt auf den beiden Stühlen sitze." Nun, Panofsky wußte, daß zum Witz des Humanisten das Spiel mit der Bescheidenheit gehörte. Die amerikanischen Leser waren von seinem Dürer wie elektrisiert. "Ich habe Tag und Nacht gelesen - dazzling", schrieb Fiske Kimball an den bewunderten Freund in Princeton.
Die "Studies in Iconology" waren 1939 erschienen, der Dürer folgte 1943. Das war in furchtbaren Zeiten. In diesen Stürmen schien das stille Princeton eine Insel der Seligen zu sein. Im Dezember 1939 schreibt Dora Panofsky an den alten Geheimrat Goldschmidt, welcher in Basel ein kümmerliches Emigrantendasein fristet: "Von hier ist wenig zu erzählen. Jeder sitzt so an seinen Problemen und vergißt darüber die Welt und die Ereignisse." Gewiß, Princeton war ein Hieronymusgehäuse für den Humanisten Panofsky, aber immer wieder pochten die Schrecken und Ängste der politischen Verfolgung vernehmlich an dessen Pforte. Die große Furcht war, daß die antisemitische Paranoia sich weiter ausbreiten könnte. Nach "München", im Oktober 1938, schreibt Panofsky an einen seiner Söhne: "Wir tun wahrscheinlich gut, irgendeinen Buschmann-Dialekt zu lernen, damit wir nach dem hiesigen Herauswurf (1941, taxiere ich bekanntlich) irgendwo vom Affenbrotbaum leben können."
Aber noch auf ganz andere Weise griff die Not der Zeit in die halkyonischen Tage des Princetoner Gelehrtendaseins ein. Im Januar 1939 schreibt Panofsky an seinen Sohn: "Ich bekomme jeden Tag zwei bis drei Notschreie von Juden, meist eingeschrieben, so daß ich noch zur Post rennen muß, um sie abzuholen", und fügt sarkastisch hinzu: "Es gibt doch wenig Arier in der Welt." Liest man den Briefwechsel durch, so sieht man, daß er sehr viel Zeit und Mühe darauf wandte, um sein wachsendes Ansehen dafür zu nutzen, an den amerikanischen Colleges und Universitäten Stellen für die aus Deutschland geflüchteten Kollegen zu finden. Allein für Alexander Dorner, einen Museumsdirektor aus Hannover, der ihm als "Moderner" wissenschaftlich gar nicht sonderlich nahestand, schreibt er im Lauf der Jahre wohl ein Dutzend solcher Empfehlungen. Klug, wie er war, schränkte Panofsky solche Befürwortungen auf den Kreis der Kunsthistoriker ein, wo er sich auf seine Fachkompetenz berufen konnte. Aber gelegentlich ging er doch weiter. Seine Liebe gehörte den alten Sprachen. Für Ernst Kapp, einen Altphilologen, der in Hamburg sein Kollege gewesen war, setzte er sich unermüdlich ein, einmal aber auch für den Gräzisten Rudolph Pfeiffer aus München, "die größte Autorität für hellenistische Dichtung". So wird die Hilfe für die Verstoßenen zum praktizierten Humanismus.
Wie aber steht es mit dem Verhältnis zu Deutschland, der Heimat, aus welcher der deutsche Jude verstoßen wurde? Dem alten Deutschland aus der Zeit vor Hitler gehört eine kaum verborgene Liebe. Im Briefwechsel mit den Söhnen, Freunden und Schicksalsgefährten erklingt die deutsche Sprache, die Panofsky modulationsreich und gefühlvoll, vor allem aber witzig gebraucht und gerne mit Zitaten aus Fontane, gelegentlich auch aus Jean Paul würzt. Oft hört man klassische deutsche Musik von Bach bis Beethoven, keinen Wagner und nichts Modernes. Aber die Beziehungen zum realen Deutschland sind zerstört. Zwischen 1937 und 1939 finden sich nur noch zwei Briefe aus Deutschland von treuen Hamburger Freunden, dem Kunsthallendirektor Pauli und dem Gräzisten Bruno Snell.
Nach 1945 werden die Verbindungen langsam und spärlich wiederaufgenommen. Die erste Nachricht vom 23. Juni 1945 kommt aus dem Zentrum des Schreckens. Ein amerikanischer Sergeant meldet, daß Martha Mosse, die Schwester von Panofskys Frau, die Haftjahre in Theresienstadt überlebt hat. Allmählich melden sich dann andere Stimmen. Kaum Kollegen, Ausnahmen: Bruno Snell, einzelne frühere Studenten, der Archäologe Peter H. Blanckenhagen, der Kunsthistoriker Heydenreich, die im Dritten Reich nicht mitgespielt hatten. Ein wirklich herzliches Verhältnis aber besteht zu Bertel Ziegenhagen, der treuen Hamburger Haushälterin, die von der ganzen Familie - auch von den beiden Söhnen - fürsorglich mit Care-Paketen beschickt wird. Es war wohl leichter, einem guten Herzen aus dem nichtakademischen Deutschland Vertrauen zu bewahren.
Am anrührendsten sind Panofskys Briefe an seinen Lehrer Wilhelm Vöge, der hochbetagt in der russischen Zone lebte. In der Verehrung für Vöge rettet er für sich die Erinnerung an das Gute, das er einst im alten Deutschland empfangen hatte. An Vöge schreibend, wählt er ein biblisches Gleichnis für die "cultural migration": "Sie waren der Engel, der dem Jacob erscheint und sagt ,Nun mache dich auf und zeuch aus diesem Lande' (frei nach Josua I/2)."
Hochaktuell lesen sich die Briefe aus den Monaten nach der Explosion der ersten Atombombe, an deren Entwicklung der Sohn Wolfgang beteiligt war. Erschrocken nahm Panofsky Anteil an einer Debatte, in welcher die Wissenschaftler bestürzt und schuldbewußt internationale Kontrolle forderten, während Truman und die Generäle vor allem den Rüstungsvorsprung gegenüber Rußland wahren wollten. Auf einmal stand das stille Princeton mit Einstein - bald auch mit Oppenheimer - im Brennpunkt eines bedrohlichen Geschehens von apokalyptischen Ausmaßen. Im Feuer von Hiroshima war das Hieronymusgehäuse abgebrannt.
Bleiben die vielen Briefe, welche sich mit dem privaten Geschick der Familie befassen. Sie haben ihren eigenen Zauber. Panofsky erscheint als der "weise Jude", liebevoll, aber nie sentimental. Anstand und Klugheit schätzt er, Moral ist ihm verdächtig, und verrückt ist die Welt allemal. Erhebt sich die Frage, ob man diesen intimen Teil der Korrespondenz öffentlich machen durfte. Im Falle großer Schriftsteller ist solches Publizieren Usance. Wenn wir die Briefe von Flaubert, Goethe oder Henry James lesen, hoffen wir, deren Werke eindringlicher zu verstehen. Gilt das gleiche für einen Gelehrten wie Panofsky, der um die Separation von Leben und Werk wußte? Ich erinnere mich an ein Gespräch, in dem er um Unterstützung für einen Kollegen gebeten wurde, der "das Herz auf dem rechten Fleck" habe. Panofskys lächelnde Replik lautete: "Aber was hat er denn auf dem rechten Fleck geschrieben?" Damit war auf die Distanz zwischen menschlicher Empfindung und forscherlicher Arbeit verwiesen. Nur mit seiner Arbeit ist der Wissenschaftler eine öffentliche Person. Diese Ausgabe der Korrespondenz aber veröffentlicht den ganzen Menschen Panofsky. Man kann sich auch daran erfreuen, aber es hat etwas Problematisches. Trotzdem ist man Dieter Wuttke dankbar, daß er dieses unvergleichliche Zeugnis der "cultural migration" aus der Alten in die Neue Welt zugänglich gemacht hat. Sollte je eine intellektuelle Biographie Panofskys geschrieben werden, wird sie aus diesen Briefen ebensoviel Nahrung ziehen können wie aus Panofskys gelehrten Büchern.
WILLIBALD SAUERLÄNDER
Erwin Panofsky: "Korrespondenz". Korrespondenz 1910 bis 1968. Eine kommentierte Auswahl in 5 Bänden. Band II: 1937-1949. Herausgegeben von Dieter Wuttke. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2003. 1363 S., Abb., geb., 180,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Zwischen Princeton und Fräulein Bertel Ziegenhagen: Exil, Krieg und Nachkrieg in den Briefen des Kunsthistorikers Erwin Panofsky
Trotz mancher Untiefen und Wiederholungen im Bereich des Familiären hält auch dieser zweite, von Dieter Wuttke herausgegebene Band der Korrespondenz des Kunsthistorikers Erwin Panofsky das Interesse des Lesers stets wach und die Spannung auf den Fortgang des editorischen Großprojektes aufrecht. Der weit über siebenhundert, weitgehend unbekannte Briefe umfassende Band ist den Jahren 1937-1949 gewidmet, als Panofsky nach seiner Emigration in Amerika zu wirken begann. Die Mischung aus Souveränität, Wortwitz, bisweilen auch Bosheit und „Gossip” lässt den Leser nicht los. Der Band lässt Panofsky als sehr speziellen Familienmensch, natürlich als Kunsthistoriker, aber auch als politischen Beobachter, Akteur und Organisator in kaum vergleichbarer Dichte sichtbar werden.
Wer in den eineinhalbtausend Seiten nach Reflexionen des Krieges und der Naziherrschaft sucht, erhält eine Fülle von Informationen – allerdings zunächst aus dem Schweigen. Panofskys Verhalten angesichts der Katastrophe gründete auf Voltaires Candide-Maxime, „den Garten zu pflegen”. Zwar hat er seinem Freund Fritz Saxl im April 1943 anvertraut, angesichts seines Überdrusses am Schreiben würde er lieber eine Position an der Front in Afrika oder Syrien einnehmen, aber in den übrigen Briefen dieser Zeit ist eine geradezu grimmige Entschlossenheit zu spüren, es sich und seiner Familie so gut und würdig als möglich gehen zu lassen und Hitler nicht auch zum Sieger über die Gedanken der Emigranten zu machen – und sei es in Form eines schlechten Gewissens über die eigene Rettung.
Panofsky hatte das Glück, kurz nach Albert Einstein an das Institute for Advanced Study in Princeton berufen zu werden und damit einen Ort des Exils zu finden, der in der Welt der Wissenschaft seinesgleichen suchte. Er war, wie er betonte, nicht aus dem, sondern in das Paradies vertrieben worden. Aber er hat sich dort keineswegs gegenüber Erde und Hölle abgeschirmt. Vielmehr hat er unermüdlich geholfen, Emigranten den Weg nach Amerika zu öffnen.
Wilhelm Pinder und die Bomben
Die Korrespondenz verdeutlicht, in welchem Maß er, hierin Walter W.S. Cook, dem Direktor des Institute of Fine Arts in New York, vergleichbar, eine Art Ein-Mann-Agentur der Arbeitsplatzvermittlung war, die zahlreichen Emigranten Armut und Isolierung ersparte. Zur Erfolgsgeschichte dieses Agierens gehörte, dass es in Diskretion geschah. Erst im März 1941 wurde Panofsky einer der lokalen Chairmen des „United Jewish Appeal” zur Unterstützung verfolgter Juden, womit er, wie er in geradezu diebischer Freude bemerkt, in offizieller Eigenschaft Briefe an jüdische Kollegen schreiben konnte, die eher hofften, als solche nicht bekannt zu sein.
Seine häufig wiederholte Beschränkung allein auf strenge Kunstgeschichte erlaubte es Panofsky, allzu große Erwartungen abwehren zu können, was ihn freilich nicht hinderte, sich immer wieder für Vertreter auch anderer Disziplinen einzusetzen. Die Altphilologen Rudolf Pfeiffer und Ernst Knapp gehörten ebenso hierzu wie etwa der Gestaltpsychologe Rudolf Arnheim, der Historiker Hans Baron, der Wissenschaftshistoriker Edgar Zilsel oder auch der Musikwissenschaftler Leo Schrade, den er vor seinem Bruder, dem Kunsthistoriker und bekennenden Nationalsozialisten Hubert Schrade, ausdrücklich in Schutz nahm.
Panofskys Urteile in Bezug auf in Deutschland verbliebene Kollegen waren schonungslos. Als sich Alfred Barr, der junge Gründungsdirektor des New Yorker Museum of Modern Art in aller Naivität im Mai 1937 danach erkundigte, ob die „Deutsche Kunstgeschichte” Wilhelm Pinders ins Englische übersetzt werden solle, antwortete ihm Panofsky, dass dieser in der Tat sehr modern sei, in seinem höchst subjektiven Stil allerdings grundsätzlich mit Schaum vor dem Mund und Tränen in den Augen schreibe. Besonders zu denken gibt Panofskys vielleicht bösester, dem aus Göttingen nach England emigrierten Nikolaus Pevsner gewidmeter Scherz. Als dieser noch im Jahre 1940 Pinder ein Buch widmete, wünschte er ihm „einen Bombensplitter in den Unterleib”.
Pest und Manhattan-Projekt
Panofskys erschüttertes Urvertrauen kehrte im Grunde nie zurück, und hierzu trugen auch manche Verhältnisse in seiner neuen Heimat bei. Über Züge des amerikanischen Antisemitismus, so etwa, wenn in einem Sommerort notorisch keine Zimmer für Juden verfügbar waren, berichtet er in einer anklagelosen Lakonie. Ab 1938 warnt er davor, dass die „Pest” auch in den Vereinigten Staaten offen ausbrechen und ab 1941 „Fascismus” herrschen würde. Noch als nach dem Krieg in Hamburg die „Warburgstraße” eingeweiht wird, bemerkt er trocken, im Gegenzug werde wohl in Washington ein „Horst Wessel Square” eingerichtet. Panofskys Urangst kommt vor allem in seinen Befürchtungen vor Wahlsiegen der Republikaner zum Tragen, von denen er gemäßigt deutsche Verhältnisse erwartete. Aus diesem Grund hat er sich vehement für die Wahl und Wiederwahl von Roosevelt eingesetzt.
In den Briefen vor allem an seine Söhne fallen seine entschiedensten politischen Äußerungen. Das ihn ausgangs des Krieges vermutlich bewegendste Ereignis hat er aber vornehmlich mit dem befreundeten Schriftsteller Booth Tarkington endlos diskutiert: Entwicklung und Abwurf der Atombombe. Sie trieben ihn auch deshalb jahrelang um, weil sein Sohn Wolfgang als Physiker nicht unerheblich am Manhattan-Projekt beteiligt war. Panofskys Einschätzung, mit der A-Bombe werde die gesamte Menschheit erpressbar, gilt bis heute prinzipiell ebenso wie die zwiespältige Konsequenz: präventive Kontrolle oder Weltregierung.
Bei allen auch zwiespältigen Erlebnissen und aller Kritik hat Panofsky keinen Augenblick daran gezweifelt, dass es das Privileg seines Lebens war, gerade in die USA gekommen zu sein. Er gehörte zu den wenigen Intellektuellen, die bereits vor 1933 die amerikanische Zivilisation nicht als Dekadenz, sondern als kulturelle Bereicherung empfunden hatten. Hierin lag sein Grundkonflikt gegenüber Personen und Kollegen, die nach Amerika gleichsam mit hochgezogenen Augenbrauen kamen.
Nach dem Krieg fand der Einsatz für die Emigranten seine reziproke Fortsetzung im unentwegten Senden von Care-Paketen an in Deutschland hungernde und frierende, demoralisierte Freunde und Kollegen. Die fast illiterat ungelenken, dabei politisch wachsamen Briefe seiner ehemaligen Hamburger Haushälterin Bertel Ziegenhagen sind von der Würde einer einfachen, aufrechten Frau, wie sie Brecht hätte erfinden können.
Zu den anrührendsten Briefwechseln gehört die nach dem Krieg einsetzende Korrespondenz Panofskys mit seinem Lehrer Wilhelm Vöge, dem er bekennt, er sei durch eine einzige Vorlesung, diejenige Vöges über die von Dürer gezeichneten Hände König Maximilians I. im Wintersemester 1910/11, zum Kunsthistoriker geworden. Wenn Panofsky zur Verehrung irgend fähig war, so gegenüber diesem alten Mann, der in der sowjetischen Besatzungszone frierend sein Dasein fristete, weiterhin forschte und gelegentlich selbstverfasste Sonette schickte. Panofsky wusste nicht, dass auch Vöge mit seiner jüngeren Vergangenheit nicht im Reinen sein konnte.
Panofskys tastendes Neuknüpfen der Beziehungen zu Schulkameraden, Kommilitonen und Kollegen gehört zum dichtesten Teil der Korrespondenz. Er ist hochgradig erleichtert, vor allem auf Hamburger Personen wie seinen alten Freund und Hausgenossen Bruno Snell zu treffen, die sich nicht kompromittiert hatten. Er entwickelt geradezu väterliche Gefühle für den Archäologen Peter Heinrich von Blanckenhagen, der im Widerstand in Deutschland überlebt hatte und bereits 1947 eine Professur in Chicago erhält.
Die Nachricht, dass sein Hamburger Lehrstuhl freigehalten worden sei, erfüllt ihn mit Genugtuung, und als er das Angebot erhält, auf ihn zurückzukehren, ist er keineswegs, wie früher vermutet worden ist, entrüstet, sondern fühlt sich geehrt. Er tauscht sich ausgiebig über Fragen der Entnazifizierung mit einem seiner letzten Schüler, Ludwig Heinrich Heydenreich aus, der zum ersten Direktor des Münchner Zentralinstituts für Kunstgeschichte werden wird. Für die Karrieren der nach 1945 gewendeten Historiker und Kunsthistoriker prägt Panofsky dagegen die neodarwinsche Formel des „survival of the fattest”.
Ein alter, bellender Seelöwe
Der Integration von Emigranten und der Unterstützung leidender Menschen im Nachkriegsdeutschland folgte als dritte Phase der von Princeton ausgehenden Aktivitäten Panofskys die Überwindung der Isolierung deutscher Kollegen. Panofsky, der Deutsch als die „Muttersprache” der Kunstgeschichte bezeichnete, gleichwohl aber ablehnte, weiterhin in Deutsch zu publizieren und mit Heydenreich eine an Victor Klemperers „Lingua tertii imperii” erinnernde Kritik des kunsthistorischen Jargons vornahm, lag offenbar daran, anderen die Erfahrung der unpathetischen Sprachkultur des Englischen zu vermitteln.
Auch in diesen Jahren aber ging es darum, in Not geratenen Personen zu helfen. So wirkte er daran mit, dass der Romanist Erich Auerbach aus Istanbul nach Princeton an das Institut kam – der dort allerdings auf Robert Curtius traf, mit dem Konflikte vorprogrammiert waren. Panofsky hatte Sympathien für beide, und auch wenn Curtius es sich in Princeton mit so gut wie allen verscherzte, hielt Panofsky ihm die Treue, was sich in der bärbeißigen Sympathieerklärung äußerte: „Er sieht aus und benimmt sich wie ein alter Seelöwe; wenn er nicht isst, bellt er, und wenn er nicht bellt, isst er, aber was er bellt, ist ersten Ranges.”
Eine makabre Wende nahmen die Bemühungen um Kollegen im November 1948, als Cook, der zahllosen Emigranten die Eingliederung ermöglicht hatte, nun selbst schutzbedürftig wurde. Nach der Eröffnung einer Ausstellung über abstrakte Kunst wurde er dem Vorwurf ausgesetzt, Kommunist zu sein, und entlassen. Panofsky organisierte ein alle wichtigen Institute der USA einschließendes Protestschreiben, das zum Verbleiben Cooks als Direktor des New Yorker Institutes führte. Die von einem der Trustees ausgegangene Affäre bestärkte Panofsky in seiner Meinung, diese Art von Aufsichtsrat sei so wertvoll wie ein Blinddarm: „zwecklos, aber ein dauernder Herd möglicher Entzündungen”.
Panofsky war überaus gesellig, wahrte aber zugleich im persönlichen Umgang stets Distanz und war, abgesehen allenfalls von Walter Friedländer und Hanns Swarzenski, ohne jene Art Freunde, denen man Geheimnisse anvertrauen würde. Nur zu einem einzigen Kollegen hatte er, sowohl menschlich wie wissenschaftlich, eine geradezu symbiotische Beziehung: zu Fritz Saxl, dem Mitautor des Melancholie-Buches von 1923. Der Briefwechsel über die Frage, in welcher Weise Raymond Klibansky als Koautor auf der erweiterten Ausgabe erscheinen solle, macht den Leser fassungslos.
Panofsky hatte im September 1937 eingewilligt, dass dessen Name auf der Titelseite erscheinen solle, aber an nicht mehr als eine die Mitarbeit nennende Form gedacht, da er Klibanskys Anteil auf das Überprüfen von Fußnoten beschränkt sah. Dass dieser ohne sein Placet im Sommer 1939 in den Ankündigungen der Warburg-Publikationen als Mitautor genannt war, erfüllte ihn so sehr mit „Entsetzen”, dass er seinen eigenen Namen eliminiert wünschte.
Panofsky blieb in dieser Frage auch nach dem Krieg unerbittlich, und erst als ihm Henri Frankfort, der neue Direktor des Warburg Institute, eröffnete, er werde im Zweifelsfall auf das Angebot eingehen, seinen Namen zugunsten von Klibansky von der Titelseite zu streichen, kam es zu dem Kompromiss, diesen als „Mitarbeiter” in die zweite Zeile zu setzen. Auf welche Weise das Buch, nochmals umgearbeitet, schließlich mit Klibanksy an erster Autorenstelle im Jahre 1964 erschien, wird wohl in einem der Folgebände zu lesen sein.
Ein prekärer Siegeszug
Der vorliegende Band der Korrespondenz umfasst auch jene Phase, in der es Panofsky gelang, seine Methode zu einer Art internationalem Stil der Kunstgeschichte zu machen. Durch seine Wahl in den Vorstand des CAA, der amerikanischen Vereinigung von Künstlern, Kunstpädagogen und Kunsthistorikern, die zahlreiche Grundsatzpapiere nach sich zogen, enthält die Korrespondenz auch ein Bündel bedeutender methodischer Reflexionen. Mit Panofsky steigendem Bekanntheitsgrad äußerten sich in den USA Bedenken und auch Aversionen gegenüber der mit ihm identifizierten, transdisziplinären Ikonologie, die das Hauptkriterium der Kunst, die Schönheit ausblende und die künstlerische Form durch textliche Vergleiche um ihre Spezifik bringe.
Panofsky musste dies umso absurder anmuten, als er in diesen Jahren im Blick auf die frühe Niederländische Malerei mit eben diesen vorgeblich fehlenden Formspezifika beschäftigt war. Im Rückblick ist bedeutsam, dass Panofsky sich mehrfach gegen neuplatonische Deutungen aussprach, die später, zur Methode der Seelenrettung karikiert, den Königsweg der deutenden Kunstgeschichte austreten sollten.
Kein Werk, dies wird in den Selbstbeschreibungen deutlich, hat er so sehr mit dem Eros der eigenen Person verbunden wie die Arbeit über Abt Suger und die Erfindung der Gotik. In dem kleinen, gewitzten, überaus klugen Abt, dem er eine Mischung aus Scheinheiligkeit und Frömmigkeit sowie „fantastischer Eitelkeit und echter Güte” attestierte, fand Panofsky Züge von Personen wie Wilhelm von Bode, aber auch seiner selbst.
Disney und die Avantgarde
Panofsky steht im Ruf, für die Moderne nicht sonderlich empfänglich gewesen zu sein. Seine Distanz zur zeitgenössischen Kunst, wenn es sie denn gegeben haben sollte, lag darin, dass er den Film gegenüber der Avantgarde für das bedeutendere Ereignis hielt. So entsprang seine Ablehnung der Verwendung von Beethoven-Musik für Disney-Filme weniger aus der Wertschätzung des Komponisten als vielmehr des Trickfilmproduzenten.
Immer wieder verwendete sich Panofsky nicht nur für die „Film Library” des New Yorker Museum of Modern Art, sondern ermutigte auch dazu, Professuren für Film Studies einzurichten. Wenn es ein für alle Seiten unproduktiver Kurzschluss war, dass die Kunstgeschichte seither zwar auch Filmstudien zulässt, diese aber nicht systematisch betreibt, so liegt dies auch am aktiven Einsatz Panofskys für die Einrichtung einer autonomen Filmwissenschaft. Es gibt Anzeichen, dass sich diese Schere wieder zu schließen scheint.
Einen Großteil der Briefe besteht aus Schreiben an die beiden Söhne. Sie wirken in manchen Partien auf den ersten Blick ermüdend, insgesamt aber vermitteln sie den vielleicht besten Einblick in die Psychologie Panofskys. Alle Seiten des kleinen, großen „Pan” werden offen oder zwischen den Zeilen deutlich, und es mutet aus heutiger Sicht erstaunlich an, mit welcher Nonchalance er seine Überzeugung, in persönlichen Fragen der Moral könne die Moralität ein größeres Übel als das thelémsche „Tu, was Du willst!”, seinen Söhnen vermittelte: „Ein Mann mit ehrlicher Familienzuneigung und etwas sexuellem Schuldbewusstsein kann ein viel angenehmerer Mann und Vater sein als ein hundertprozentig treues Ekel.”
Sein bekannter Horror vor den aus familiärer Nähe geforderten Pflichten führte durch die kalten Duschen, die er nach allen Seiten hin ausschüttete, zu Klärungen, die tiefere Bindungen erzeugten als desinteressierte Duldungen. Als er – nicht ohne Freude – bemerkt, dass seine Enkel in fast lenkungsloser Freiheit aufwachsen, mahnt er, dass Erziehung weniger mit Autoritarismus denn mit „Selbstverteidigung” zu tun habe.
Im Vorwort des Herausgebers klingt an, welch immense Anforderung eine derartige Edition verlangt. Die Kommentare lassen kaum eine Lücke, das Namens- und Sachregister ist ein Kunstwerk in sich. Wenn die Serie der Korrespondenzbände insgesamt abgeschlossen sein wird, wird Erwin Panofsky wohl der am aufwendigsten in Briefen dokumentierte Wissenschaftler sein. Auch dieser zweite Band zeigt, wie sehr dies den Einsatz lohnt.
HORST BREDEKAMP
ERWIN PANOFSKY: Korrespondenz 1937 bis 1949. Hrsg. von Dieter Wuttke. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2003. 1391 Seiten, 180 Euro.
Erwin Panofsky.
Foto: Harrassowitz
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de